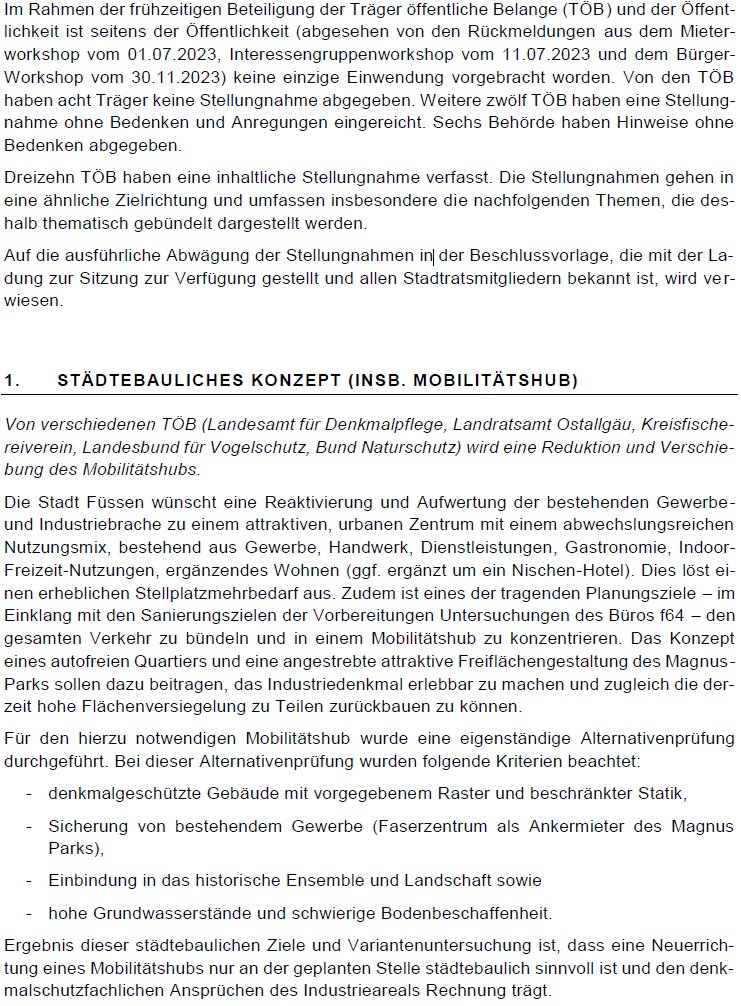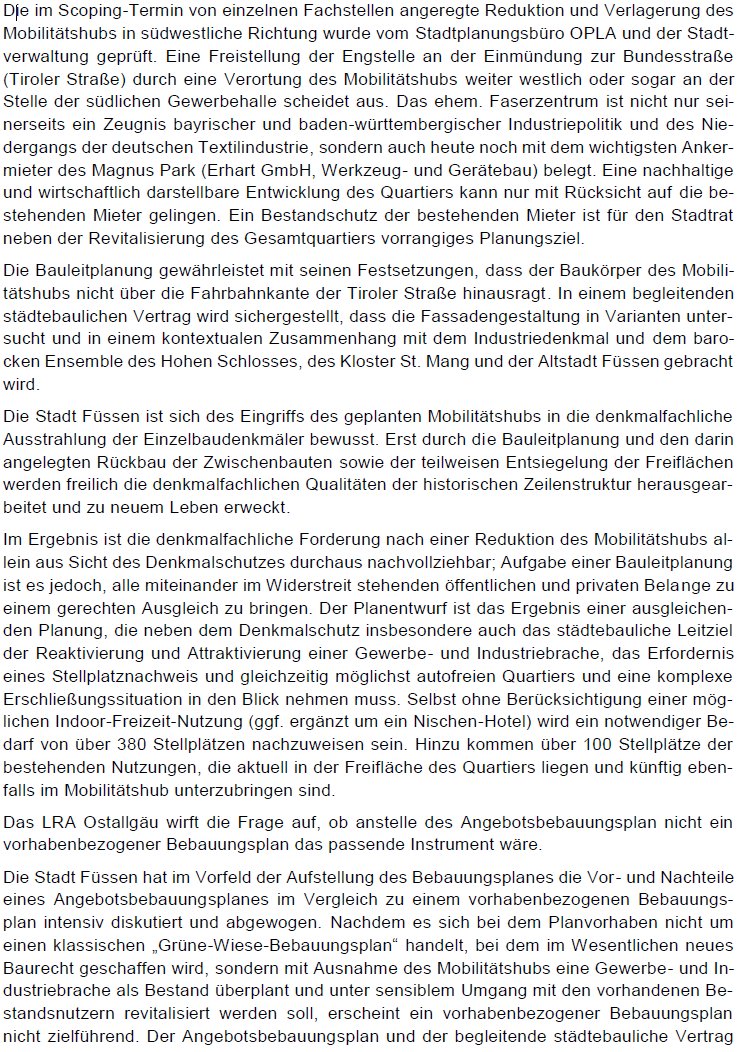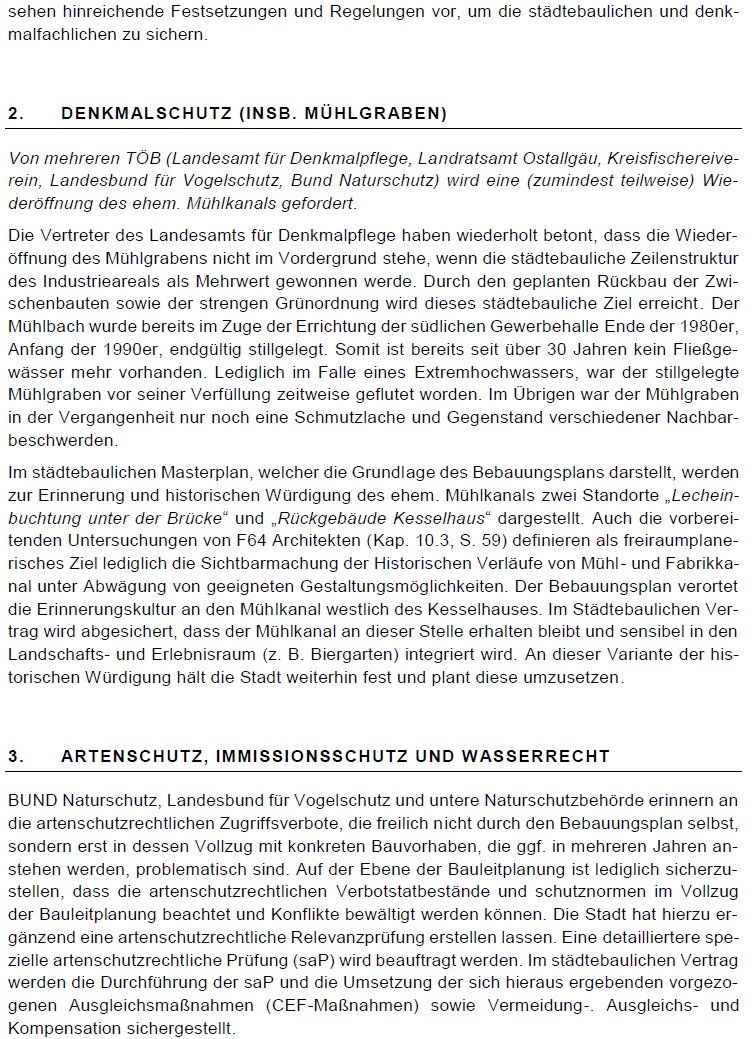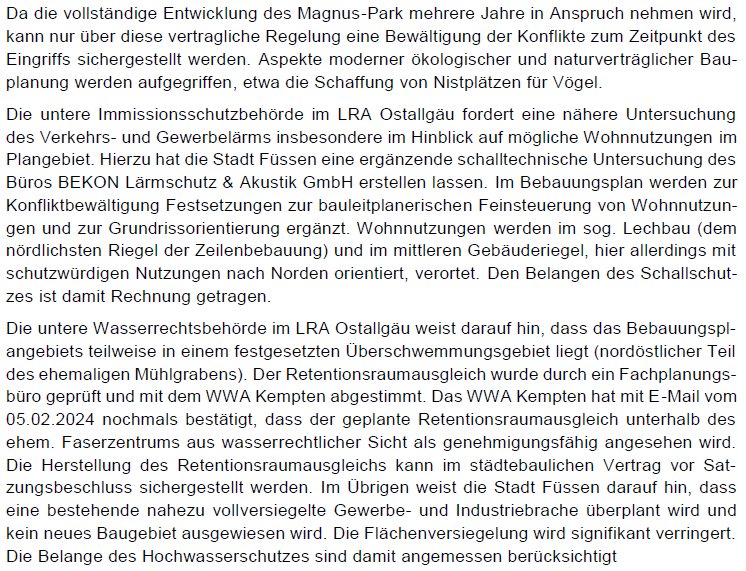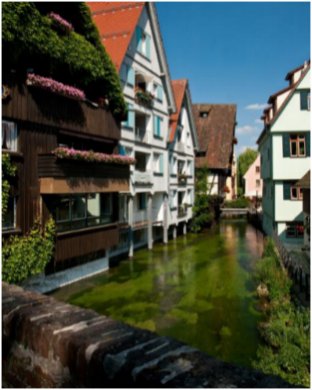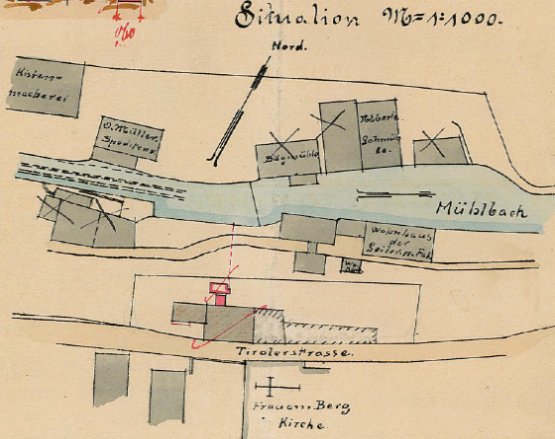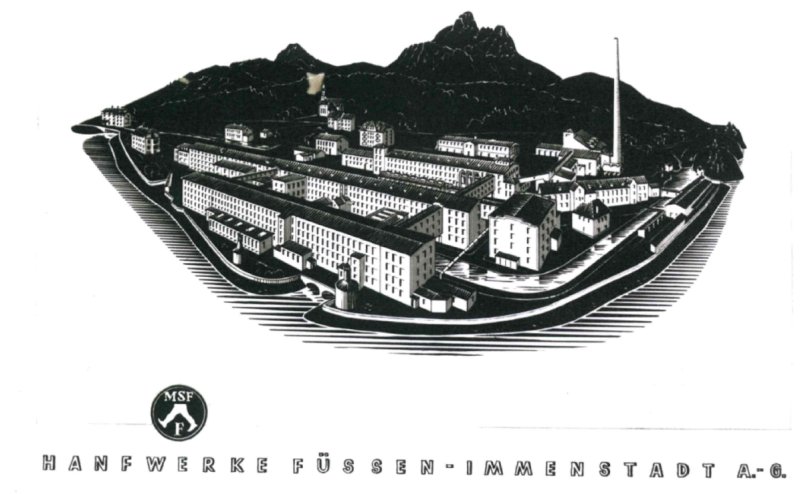Datum: 19.03.2024
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Großer Sitzungssaal des Rathauses Füssen
Gremium: Stadtrat
Öffentliche Sitzung, 17:00 Uhr bis 18:10 Uhr
Nichtöffentliche Sitzung, 18:11 Uhr bis 18:35 Uhr
Öffentliche Sitzung
Sitzungsdokumente öffentlich
Download Niederschrift öffentlich.pdf
zum Seitenanfang
1. Bürgerfragestunde
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
0241. Sitzung des Stadtrates
|
19.03.2024
|
ö
|
beschliessend
|
1 |
Diskussionsverlauf
Frau Dr. Deubzer appelliert an die Mitglieder des Stadtrates, in der heutigen Sitzung das Bürgerbegehren zu bewilligen. Der Wunsch nach Abstand von der Bebauung am Dreitannenbichl soll laut dem Verein Füssen - West nachgekommen werden.
zum Seitenanfang
2. Vollzug des Art. 18a der Gemeindeordnung (GO); Beschlussfassung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens "Erhalt des Dreitannenbichls (=Oblisberg) als Gesamtgrünfläche"
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
0241. Sitzung des Stadtrates
|
19.03.2024
|
ö
|
beschliessend
|
2 |
Sachverhalt
Am 27.02.2024 wurde bei der Stadt Füssen ein Schreiben der vertretungsberechtigten Personen Evelyn Vesenmayer, Dr. Elke Deubzer und Beate Achtstätter mit 1.600 beigefügten Unterschriften über die Durchführung eines Bürgerentscheides „Erhalt des Dreitannenbichls (=Oblisberg) als Gesamtgrünfläche“ eingereicht (Bürgerbegehren).
Über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheidet der Gemeinderat unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats nach Einreichung des Bürgerbegehrens (Art. 18a Abs. 8 Satz 1 GO).
Überprüfung der formellen Zulässigkeit des Bürgerbegehrens:
Art. 18a Abs. 1 GO ist erfüllt:
„Die Gemeindebürger können über Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde einen Bürgerentscheid beantragen (Bürgerbegehren)“.
Art. 18a Abs. 3 GO ist erfüllt:
„Ein Bürgerbegehren findet nicht statt über Angelegenheiten, die kraft Gesetz dem ersten Bürgermeister obliegen, über Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung, über die Rechtsverhältnisse der Gemeinderatsmitglieder, der Bürgermeister und der Gemeindebediensteten und über die Haushaltssatzung.“
Art. 18a Abs. 4 Satz 1 GO ist erfüllt:
„Das Bürgerbegehren muss bei der Gemeinde eingereicht werden und eine mit Ja oder Nein zu entscheidende Fragestellung und eine Begründung enthalten sowie bis zu drei Personen benennen, die berechtigt sind, die Unterzeichnenden zu vertreten.“
Die Fragestellung des Bürgerbegehrens lautet:
„Sind Sie dafür, dass die Stadt Füssen alle rechtlich zulässigen Mittel ergreift, die darauf abzielen, den Dreitannenbichl (Oblisberg, Grundstück Fl.Nr. 970/17 der Gemarkung Füssen) als Gesamtgründfläche zu erhalten?“
Die Begründung lautet:
„Der Stadtrat der Stadt Füssen hat beschlossen, einen ca. 5 m breiten Streifen im Norden der Grünfläche des Dreitannenbichls (Oblisberg, Grundstück Fl.Nr. 970/17 der Gemarkung Füssen) zur Erschließung des Grundstücks Fl.Nr. 970/28 der Gemarkung Füssen für den Neubau eines 5-geschossigen Arbeitnehmerwohnheimes zu veräußern. Der Dreitannenbichl (Oblisberg) ist ein Wahrzeichen von Füssen-West. Er ist ein Dokument, wie es dort früher einmal aussah und eine wichtige Grünfläche in diesem Stadtteil mit der höchsten Bevölkerungsdichte. Es soll sichergestellt werden, dass das Grundstück am Dreitannenbichl (Fl.Nr. 970/17), das bislang im Eigentum der Stadt Füssen stand, auch in Zukunft nicht verändert wird. Es soll weder als Ganzes noch in Teilen bebaut werden und für künftige Generationen als geologisches und ökologisches Wahrzeichen unserer Heimat erhalten bleiben.
Mit Ihrer Unterschrift können Sie dazu beitragen, dass die Stadt entsprechende Maßnahmen trifft, um den Erhalt des Dreitannenbichls als Gesamtgrünfläche zu erreichen. Konkret könnte die Stadt einen Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans erlassen und zur Sicherung dieser Planung eine Veränderungssperre oder alternativ die Zurückstellung vom Baugesuch beschließen und beim Landratsamt Marktoberdorf beantragen“.
Als vertretungsberechtigte Personen wurden Evelyn Vesenmayer (Vertreter Franz Efkes), Dr. Elke Deubzer (Vertreter Herbert Gorski) und Beate Achtstätter (Vertreterin Gabriele Bruhns) benannt.
Art. 18a Abs. 5 und 6 sind erfüllt:
Absatz 5:
„Das Bürgerbegehren kann nur von Personen unterzeichnet werden, die am Tage der Einreichung des Bürgerbegehrens Gemeindebürger sind. Für die Feststellung der Zahl der gültigen Unterschriften ist das von der Gemeinde zum Stand dieses Tages anzulegende Bürgerverzeichnis maßgebend.“
Absatz 6:
„Ein Bürgerbegehren muss in Gemeinden von 10.001 bis 20.000 Einwohnern von mindestens 9 v.H. der Gemeindebürger unterschrieben sein.“
Das Bürgerbegehren wurde bei der Stadt Füssen am 27.02.2024 eingereicht.
Die Überprüfung der Unterschriften hat folgendes Ergebnis ergeben:
Stimmberechtigte (Stand 27.02.2024): 12.234
Erfordernis 9 v.H. (Art. 18a Abs. 6 GO): 1.101
Erfordernis 0 v.H. in Prozent 11,67 %
Geleistete Unterschriften: 1.603
Ungültige Unterschriften: 175
Gültige Unterschriften: 1.428
Gültige Unterschriften in Prozent: 130 %
Ergebnis:
Die für die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens erforderlichen Voraussetzungen nach Art. 18a Abs. 1, 3, 4, 5 und 6 GO sind alle erfüllt.
Stellungnahme des Landratsamtes Ostallgäu vom 12.03.2024:
Gemäß Herrn Regierungsdirektor Kinkel, Abteilungsleiter Kommunalrecht, Sicherheit und Verbraucher, ist das eingereichte Bürgerbegehren – vorbehaltlich der notwendigen Anzahl an Unterschriften - auf Grundlage der dort vorgelegten Unterlagen, zulässig.
Nach Art. 18a Abs. 10 Satz 1 GO ist der Bürgerentscheid an einem Sonntag innerhalb von drei Monaten nach der Feststellung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens durchzuführen; der Gemeinderat kann die Frist im Einvernehmen mit den vertretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens um höchstens drei Monate verlängern.
Der Bürgerentscheid soll zusammen mit Europawahl am Sonntag, 9. Juni 2024 stattfinden.
Nach Art. 10 Abs. 1 GLKrWG dürfen am Tag einer Bezirkswahl, Landtagswahl, Bundestagswahl Europawahl, einer Abstimmung über einen Volksentscheid oder während der Eintragsfrist für ein Volksbegehren keine Gemeinde- oder Landkreiswahlen oder sonstige Abstimmungen stattfinden. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration (Art. 10 Abs. 2 GLKrWG). Sie können zugelassen werden, wenn gegen die Durchführung der Wahl oder der Abstimmung keine Bedenken bestehen und eine Beeinflussung der Wahl oder der Abstimmung nicht zu befürchten ist. Von einer Zustimmung wird in jedem Fall ausgegangen.
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass der Bürgerentscheid entfällt, wenn der Gemeinderat die Durchführung der mit dem Bürgerbegehren verlangten Maßnahme beschließt (Art. 18a Abs. 14 Satz 1 GO).
Beschluss 1
Der Stadtrat beschließt, dass das Bürgerbegehren „Erhalt des Dreitannenbichls (=Oblisberg) als Gesamtgrünfläche“ zulässig ist (Art. 18a Abs. 8 Satz 1 GO).
Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 0
Beschluss 2
Der Stadtrat lehnt es ab, dem Antrag des Bürgerbegehrens stattzugeben ((Art. 18a Abs. 14 Satz 1 GO).
Abstimmungsergebnis
Dafür: 18, Dagegen: 1
Beschluss 3
Der Bürgerentscheid findet zusammen mit der Europawahl am 9. Juni 2024 statt (Art. 18a Abs. 10 GO).
Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 0
Beschluss 4
Die Kosten des Bürgerentscheids trägt die Gemeinde. Stimmberechtigt ist jeder Gemeindebürger. Die Möglichkeit der brieflichen Abstimmung ist zu gewährleisten. Bis zur Durchführung des Bürgerentscheids darf eine dem Begehren entgegenstehende Entscheidung der Gemeindeorgane nicht mehr getroffen oder mit dem Vollzug einer derartigen Entscheidung nicht mehr begonnen werden (Art. 18a Abs. 9 GO).
Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 0
zum Seitenanfang
3. Auszahlung von Erfrischungsgeld und Gewährung von Stunden für Wahlhelfer zur Europawahl 2024 und Bürgerentscheid „Erhalt des Dreitannenbichls (=Oblisberg) als Gesamtgrünfläche“
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
0241. Sitzung des Stadtrates
|
19.03.2024
|
ö
|
beschliessend
|
3 |
Sachverhalt
Am 09.06.2024 finden die Europawahl 2024 und der Bürgerentscheid „Erhalt des Dreitannenbichls (=Oblisberg) als Gesamtgrünfläche“ statt. Hierzu werden wieder Wahlhelfer benötigt, welchen ein entsprechendes Erfrischungsgeld gezahlt werden soll.
Bei der Landtags- und Bezirkswahl vom 08.10.2023 wurde hierzu seitens des Stadtrates damals ein Erfrischungsgeld für Wahlhelfer, welche Angestellte der Stadt Füssen sind, in Höhe von 30,00 Euro und für Wahlhelfer, welche nicht bei der Stadt Füssen angestellt sind, in Höhe von 50,00 Euro beschlossen. Zusätzlich zu den 30,00 Euro Erfrischungsgeld erhielten städtische Angestellte je nach Einteilung in Urnenwahl- bzw. Briefwahllokal 12 bzw. 10 Stunden als Ausgleich.
Für die kommende Europawahl 2024 wird seitens der Bundeswahlleiterin ein Erfrischungsgeld von mindestens 35,00 Euro empfohlen.
Dementsprechend sollte für städtische Angestellte eine Wahlhelferentschädigung in Höhe von 35,00 Euro und zusätzlich ein Stundenausgleich, je nach Einteilung von 8 Stunden für Briefwahllokale bzw. 10 Stunden für Urnenwahllokale bei dieser Wahl erfolgen. Erfahrungsgemäß ist diese Zeitspanne bei dieser Wahl zur Erfüllung ausreichend.
Die Höhe des Erfrischungsgeldes für nicht städtische Wahlhelfer soll weiterhin bei 50,00 Euro liegen.
Insbesondere, da in der Stadt Füssen am 09.06.2024 neben der Europawahl auch ein Bürgerentscheid und somit zwei Wahlen stattfinden, empfehlen wir die Erhöhung auf 35,00 Euro.
Beschlussvorschlag
Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt ein Erfrischungsgeld in Höhe von 35,00 Euro für Wahlhelfer, die bei der Stadt Füssen beschäftigt sind und für alle anderen Wahlhelfer ein Erfrischungsgeld in Höhe von 50,00 Euro. Zudem erhalten die Wahlhelfer, die bei der Stadt Füssen beschäftigt sind, einen Stundenausgleich von 8 Stunden bei Einsatz im Briefwahllokal und 10 Stunden bei Einsatz im Urnenwahllokal.
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt ein Erfrischungsgeld in Höhe von 35,00 Euro für Wahlhelfer, die bei der Stadt Füssen beschäftigt sind und für alle anderen Wahlhelfer ein Erfrischungsgeld in Höhe von 50,00 Euro. Zudem erhalten die Wahlhelfer, die bei der Stadt Füssen beschäftigt sind, einen Stundenausgleich von 8 Stunden bei Einsatz im Briefwahllokal und 10 Stunden bei Einsatz im Urnenwahllokal.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 0
zum Seitenanfang
4. Vollzug des Gemeindelandkreiswahlgesetzes (GLKrWG) und der Gemeindelandkreiswahlordnung (GLKrWO); Bildung des Abstimmungsausschusses für den Bürgerentscheid
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
0241. Sitzung des Stadtrates
|
19.03.2024
|
ö
|
beschliessend
|
4 |
Sachverhalt
Für die Durchführung eines Bürgerentscheides in Füssen ist die analoge Anwendung der Vorschriften des Gemeindelandkreiswahlgesetzes (GLKrWG) und der Gemeindelandkreiswahlordnung (GLKrWO zu beschließen.
Nach Art. 5 Abs. 2 GLKrWG und § 5 Abs. 1 GLKrWO sind Mitglieder des Abstimmungsausschusses der Abstimmungsleiter als vorsitzendes Mitglied (erster Bürgermeister) und vier von ihm berufene Beauftragte der Wahlvorschlagsträger als Beisitzer; hierbei sind die politischen Parteien und Wählergruppen entsprechend ihrer Bedeutung im Wahlkreis nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Die Bedeutung der politischen Parteien und Wählergruppen für die Berufung der Beisitzer und deren Stellvertretung bemisst sich nach der bei der letzten Stadtratswahl (15.03.2020) erhaltenen Stimmenzahl. Daneben hat der Wahlleiter einen Schriftführer zu bestellen, der nur stimmberechtigt ist, wenn er zugleich Beisitzer ist.
Der Abstimmungsausschuss für den Bürgerentscheid am 9. Juni 2024 setzt sich wie folgt zusammen:
Abstimmungsleiter: Maximilian Eichstetter, Erster Bürgermeister
Stellv. Abstimmungsleiter: Andreas Rösel, Leiter des Wahlamtes
Beisitzer:
- Wahlvorschlag der CSU (41.362 gültige Stimmen bei der letzten Stadtratswahl)
Beauftragte: Nicole Eikmeier, Im Venetianerwinkel 36, 87629 Füssen
Stellvertreter: Andreas Eggensberger, Hopfen am See, Bergstr. 5a, 87629 Füssen
Nicole Eikmeier und Andreas Eggensberger rücken beide für Bürgermeister Eichstetter nach, der sowohl Beauftragter als auch erster Listenkandidat der CSU war.
- Wahlvorschlag der Freien Wähler Füssen (28.776 gültige Stimmen)
Beauftragte: Gerlinde Wollnitza, Schwarzenbergweg 3, 87629 Füssen
Stellvertreter: Hasso Fröhlich, König-Ludwig-Promenade 6, 87629 Füssen
- Wahlvorschlag der Wählergruppe Füssen-Land (18.695 gültige Stimmen)
Beauftragter: Alfons Böck, Mariahilfer Str. 17, 87629 Füssen
Stellvertreter: Herbert Dopfer, Hopfen am See, Enzensbergstr. 3, 87629 Füssen
- Wahlvorschlag der Grünen (17.973 gültige Stimmen)
Beauftragte: Teresa Poldinger, Wachsbleiche 7, 87629 Füssen
Stellvertreter: Wolfgang Bader, Schartschrofenweg 10, 87629 Füssen
Schriftführerin: Tanja Hofmann, Verwaltungsfachwirtin (nicht stimmberechtigt)
Beschlussvorschlag
Der Stadtrat beschließt für die Durchführung des Bürgerentscheids am 9. Juni 2024 die analoge Anwendung der Vorschriften des Gemeindelandkreiswahlgesetzes und der Gemeindelandkreiswahlordnung in der z.Zt. gültigen Fassung.
Der Abstimmungsausschuss, der zur Ermittlung und Feststellung des Abstimmungsergebnisses des Bürgerentscheids einberufen wird, setzt sich wie oben ausgeführt zusammen.
Die obigen Ausführungen der Verwaltung sind Bestandteil dieses Beschlusses
Beschluss
Der Stadtrat beschließt für die Durchführung des Bürgerentscheids am 9. Juni 2024 die analoge Anwendung der Vorschriften des Gemeindelandkreiswahlgesetzes und der Gemeindelandkreiswahlordnung in der z.Zt. gültigen Fassung.
Der Abstimmungsausschuss, der zur Ermittlung und Feststellung des Abstimmungsergebnisses des Bürgerentscheids einberufen wird, setzt sich wie oben ausgeführt zusammen.
Die obigen Ausführungen der Verwaltung sind Bestandteil dieses Beschlusses
Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 0
zum Seitenanfang
5. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2024
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
0241. Sitzung des Stadtrates
|
19.03.2024
|
ö
|
beschliessend
|
5 |
Sachverhalt
Die Stadt Füssen erhielt nach den bereits in 2022 bewilligten Mitteln auch im Jahr 2023 Bedarfszuweisungen nach Art. 11 BayFAG in Form von Stabilisierungshilfen. Auf Grundlage des Antrags der Stadt vom April 2023 entschied der Verteilerausschuss des Landtags in seiner Oktobersitzung 2023 der Stadt Füssen Mittel i. H. v. 5,3 Mio. EUR zukommen zu lassen. Mit Schreiben vom 20. November 2023 ging der Förderbescheid mit umfangreichen Auflagen bei der Stadt Füssen ein. Alle Stadträte erhielten den Bescheid umgehend per E-Mail übermittelt. Ebenso erfolgte im Rahmen der Sitzung des Haupt-, Finanz-, Sozial- und Kulturausschusses vom 12.12.2023 eine Präsentation über die Auflagen und Auswirkungen.
Der Förderbescheid enthält wie bereits auch schon im Jahr 2022 etliche Auflagen, welche an die Gewährung der Stabilisierungshilfezahlung geknüpft sind. Die Auflagen müssen bis spätestens 31.03.2024 erfüllt sein. Im Förderbescheid ist auch ein Widerrufsvorbehalt enthalten. Dieser weist explizit auf die Rückforderung der Stabilisierungshilfe hin, sollte gegen Auflagen verstoßen werden. In den Ausführungen zum Widerrufsvorbehalt spricht die Regierung von Schwaben auch den fortwährenden Bestand des Konsolidierungswillens an. Läge kein Konsolidierungswille mehr vor, so wäre die Bewilligungsbehörde gezwungen, die Gewährung der Stabilisierungshilfe abzulehnen.
Die Ergebnisse der Überarbeitung des Investitionsprogramms einschließlich der geforderten Reduzierungen der Gesamtinvestitionen, Eigenanteile und Kreditaufnahmen sind in dieser Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts darzustellen. Die Fortschreibung und Umsetzung des vorgelegten Haushaltskonsolidierungskonzepts ist durch den Stadtrat bis spätestens 31.03.2024 mit dem Ziel zu beschließen, mittelfristig wieder die finanzielle Leistungsfähigkeit zu erreichen.
Für die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts gelten folgende Auflagen:
- Umfassende Prüfung der Anpassung der Miet- und Pachteinnahmen für städtische Liegenschaften
Umfassende Prüfung der Veräußerung von nicht rentablen und nicht für originäre Pflichtaufgaben erforderliche Immobilien und Grundstücke
Konkrete und zielgerichtete Überprüfung, inwieweit das vorhandene Vermögen für die städtische Aufgabenerfüllung benötigt wird bzw. erforderlich ist
Umfassende Prüfung der Reduzierung von Ausgaben bei den freiwilligen Leistungen und insbesondere bei den defizitären Einrichtungen
Umfassende Prüfung der Verbesserung der Kostendeckungsgrade bei den öffentlichen Einrichtungen insbesondere (damit nicht abschließend) benannt sind Kindertagesstätten, Bundesstützpunkt Eishockey und Curling, Museum/Theater/Bibliothek, Jugendhaus, Turnhallen, Freibad, Stadtgärtnerei, Stadtwerke (insbesondere Parkierung)
Durchführung einer konstruktiven Aufgabenkritik im Rahmen des Monitorings zur Haushaltskonsolidierung bei den städtischen originären Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben
Prüfung der Beschränkung von Investitionstätigkeiten auf unabweisbare Maßnahmen im Pflichtaufgabenbereich bzw. rentierlichen Bereich
Prüfung von Kosteneinsparungen im Pflichtaufgabenbereich bzw. rentierlichen Bereich
Investitionen im freiwilligen Bereich sind einer kritischen Prüfung zu unterziehen und dürfen nur im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit angegangen werden
Bislang getroffene Konsolidierungsmaßnahmen sind fortlaufend dahingehend zu prüfen, ob Anpassungen bzw. Neuerungen zur Beibehaltung und Intensivierung des Konsolidierungskurses erforderlich sind
Fortlaufende Prüfung ist im Rahmen der Fortschreibung des Konsolidierungskonzepts zu dokumentieren
Die Stabilisierungshilfe verfolgt das Ziel durch eigene Konsolidierung im Haushalt und mit Hilfe der Gewährung von Stabilisierungshilfen die Stadt Füssen durch Abbau der überdurchschnittlichen Verschuldung sowie durch eine nachhaltige Verringerung der Zins- und Tilgungsleistungen wieder hinreichend finanzielle Handlungsspielräume zu ermöglichen.
Als Nachweis hierzu dient ein stringentes Haushaltskonsolidierungskonzept, welches den Vorgaben des Ministeriums entspricht und mit dem Ziel fortgeschrieben, beschlossen und umgesetzt wird, mittelfristig wieder die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu erreichen. Die vom Ministerium getroffenen Auflagen dienen dazu, dass die gewährten Stabilisierungshilfemittel auch ihren Zweck verfolgen.
Verstöße gegen Auflagen und ein fehlender Konsolidierungswille können zur Rückzahlung der gewährten Hilfen führen. Es liegt somit allein in den Händen der Stadt Füssen den Konsolidierungsweg aus eigenem Interesse, nachhaltig und konsequent zu verfolgen.
Die Verwaltung möchte nochmals darauf hinweisen, dass eine Verbesserung der Kostendeckungsgrade bei freiwilligen Leistungen sowie kostenrechnenden Einrichtungen zwingend erforderlich ist. Insbesondere hat die Stadt sich im Rahmen der Aufgabenkritik mit dem städtischen Vermögen und dessen wirtschaftlicher Verwendung zu beschäftigen.
Ziel und ein zwingendes Muss sollte der im vergangenen Jahr bestrittene Weg mit der Behandlung einzelner Einrichtungen und Aufgaben in den jeweiligen Finanzausschuss bzw. Stadtratssitzungen sein, um richtungsweisende Entscheidungen herbeiführen zu können.
Beschlussvorschlag
Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt die beiliegende 2. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für die Stadt Füssen. Dieses bildet zusammen mit dem Ursprungskonzept aus 2022 sowie der 1. Fortschreibung 2023 auch weiterhin die Grundlage für die künftige Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt und setzt die Leitlinien des künftigen Handels der Stadt mit dem Ziel, mittelfristig wieder finanziell handlungsfähig zu werden. Das Konzept dient dazu als eine politische Grundsatzerklärung mit Selbstverpflichtung sowohl für die Politik und Verwaltung für die bevorstehenden finanzpolitischen Herausforderungen zu verstehen.
Spätestens zur jeweiligen Haushaltsaufstellung und Haushaltsberatung ist dieses Konzept den aktuellen Entwicklungen anzupassen und fortzuschreiben. Dieser Fortschreibung voraus geht künftig jeweils ein Monitoring, ob und inwieweit die gesetzten Ziele erreicht wurden bzw. was ggf. zusätzlich getan werden muss, damit diese erreicht werden.
Diskussionsverlauf
Stadträtin Deckwerth hakt nach, ob zu diesem Thema nun keine Diskussion mehr stattfinden soll?
Der Erster Bürgermeister äußert sich hier nochmals und erklärt, dass aus allen Bereichen die Mitarbeiter zu den einzelnen Posten Stellung beziehen mussten. Jede einzelne Haushaltsstelle wurde somit nochmals hinterfragt, bearbeitet und auf Einsparmaßnahmen geprüft. Hier finden Sie nun die Zusammenfassung mit dem Ergebnis.
Frau Deckwerth führt an, dass sie hier mit der Vorangehensweise nicht mitgehen kann, bedankt sich aber bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Aufarbeitung. Sie wird der Abstimmung daher nicht beipflichten.
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt die beiliegende 2. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für die Stadt Füssen. Dieses bildet zusammen mit dem Ursprungskonzept aus 2022 sowie der 1. Fortschreibung 2023 auch weiterhin die Grundlage für die künftige Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt und setzt die Leitlinien des künftigen Handels der Stadt mit dem Ziel, mittelfristig wieder finanziell handlungsfähig zu werden. Das Konzept dient dazu als eine politische Grundsatzerklärung mit Selbstverpflichtung sowohl für die Politik und Verwaltung für die bevorstehenden finanzpolitischen Herausforderungen zu verstehen.
Spätestens zur jeweiligen Haushaltsaufstellung und Haushaltsberatung ist dieses Konzept den aktuellen Entwicklungen anzupassen und fortzuschreiben. Dieser Fortschreibung voraus geht künftig jeweils ein Monitoring, ob und inwieweit die gesetzten Ziele erreicht wurden bzw. was ggf. zusätzlich getan werden muss, damit diese erreicht werden.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 18, Dagegen: 1
zum Seitenanfang
6. Antrag auf Gewährung einer Stabilisierungshilfe 2024
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
0241. Sitzung des Stadtrates
|
19.03.2024
|
ö
|
beschliessend
|
6 |
Sachverhalt
Mit Stadtratsbeschluss vom 26.04.2022 wurde einstimmig beschlossen Stabilisierungshilfen für das Jahr 2022 zu beantragen (Antrag auf Gewährung einer Stabilisierungshilfe (komuna.net)). Mit Förderbescheid vom 02.12.2022 wurde der Stadt unter erheblichen Auflagen in Aussicht gestellt Stabilisierungshilfen nach Art. 11 BayFAG in Höhe von 2.000.000 € zur Schuldentilgung zu erhalten, sofern die aufschiebenden Bedingungen bis 31.03.2023 erfüllt werden. Die Bedingungen wurden dem Stadtrat im Rahmen der Haushaltsberatungen erläutert.
Im Jahr 2023 wurde mit Stadtratsbeschluss vom 28.03.2023 beschlossen, erneut Stabilisierungshilfen zu beantragen (Antrag auf Gewährung einer Stabilisierungshilfe (komuna.net)). Mit Förderbescheid vom 20.11.2023 wurde der Stadt erneut unter erheblichen Auflagen Stabilisierungshilfe in Aussicht gestellt nach Art. 11 BayFAG in Höhe von 5.300.000 Euro zur Schuldentilgung zu erhalten, sofern die Auflagen bis 31.03.2024 erfüllt werden. Die Auflagen wurden dem Stadtrat im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 erläutert. Der Stadtrat wurde zudem ausführlich über die Möglichkeit des Widerrufs der Hilfsmittel informiert, sofern die Auflagen nicht eingehalten werden, sowie der Konsolidierungswille nicht mehr vorliegt.
Auch für das Jahr 2024 beabsichtigt die Stadt Füssen erneut Stabilisierungshilfen zur Schuldentilgung zu erhalten und den entsprechenden Antrag auf den Weg zu bringen. Die Antragsfrist endet am 19.04.2024. Die Entscheidung fällt voraussichtlich Anfang November 2024 im Rahmen der Sitzung des Verteilerausschusses. Aufgrund der umfassenden einzureichenden Antragsunterlagen arbeitet die Verwaltung bereits an der Antragsstellung.
Die Stabilisierungshilfen sind eine Sonderform der Bedarfszuweisung, welche sich in zwei Säulen aufteilt. Die Säule 1 betrifft die Stabilisierungshilfe zur Schuldentilgung, die Säule 2 betrifft die Stabilisierungshilfe als Investitionshilfe. Im dritten Antragsjahr kommt für die Stadt Füssen weiter nur die Säule 1 in Betracht. Die Säule 2 kann erst in Anspruch genommen werden, wenn mindestens dreimal eine Stabilisierungshilfe nach Säule 1 bewilligt wurde. Weitere Zugangsvoraussetzung zur Säule 2 ist das Vorliegen und die Fortführung des stringenten und nachhaltigen Konsolidierungswillens einschließlich jährlicher Fortschreibung und Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzepts anhand des 10-Punkte-Katalogs. Hinzu kommt die Beschränkung der Kreditaufnahmen im laufenden Haushaltsjahr auf höchstens 150% der ordentlichen Tilgung. Alternativ hierzu können auch die letzten beiden abgerechneten Haushaltsjahre und die drei auf das laufende Haushaltsjahr nachfolgenden Jahre (mittelfristige Finanzplanung) mit einbezogen oder die letzten fünf abgerechneten Haushaltsjahre herangezogen werden. Letzter maßgeblicher Baustein ist die Vorlage eines aussagekräftigen Investitionsprogramms für das letzte abgerechnete, sowie das laufende Haushaltsjahr und den Finanzplanungszeitraum zur Darlegung des Investitionsbedarfs.
Im Antrag der Stabilisierungshilfe 2024 können Kredite angegeben werden, welche zwischen November 2024 und Dezember 2025 zur Prolongation anstehen sowie die ordentlichen Tilgungsleistungen im Jahr 2025. Das Antragsvolumen umfasst nach aktuellem Stand auf dieser Basis ca. 6 Mio. EUR. Über die tatsächliche Höhe der Hilfezahlungen entscheidet der Verteilerausschuss.
Für alle Anträge auf Gewährung einer Stabilisierungshilfe muss der rechnungsgelegte Haushalt 2023 und der verabschiedete Haushaltsplan 2024 vorhanden sein. Zudem sind dem Antrag beizufügen
- Aufstellung der freiwilligen Leistungen
Rechtsaufsichtliche Haushaltswürdigung bzw. Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2024
Fortgeschriebenes/überarbeitetes Haushaltskonsolidierungskonzept inkl. der „Tabellarischen Übersicht“ zum HHK
Aktuelles Investitionsprogramm
Aufstellung der Investitionen in die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung und ggf. die für Zwecke der Stabilisierungshilfen getroffene Zuordnung der Kreditaufnahmen zu diesen Bereichen
Aufstellung aller bestehenden Darlehen
Aufstellung zu den Tätigkeiten bzw. Verbindlichkeiten außerhalb des Haushalts
Grundsätzlich gilt, dass nur konsolidierungswillige Kommunen, die aufgrund objektiver Indikatoren als strukturschwach gelten bzw. von der negativen demografischen Entwicklung besonders betroffen sind und sich unverschuldet in einer finanziellen Schieflage befinden bzw. deren finanzielle Leistungsfähigkeit gefährdet ist, Stabilisierungshilfen erhalten können. Die Einhaltung eines stringenten Konsolidierungskurses (einschließlich Erstellung/Fortführung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes) ist unerlässlich.
Weiter sind die Stabilisierungshilfen an die Voraussetzungen geknüpft, dass
- eine strukturelle Härte vorliegt
- eine finanzielle Härte vorliegt
- ein nachhaltiger Konsolidierungswille vorhanden ist.
Hervorzuheben ist hier die Forderung des nachhaltigen Konsolidierungswillens. Die Stabilisierungshilfe fordert hier u. a. sämtliche Möglichkeiten zur Selbsthilfe auszuschöpfen. Insbesondere betrifft dies
- Erhebung kostendeckender Gebühren
- mindestens durchschnittliche Hebesätze bei Grund- und Gewerbesteuer
- keine Überschreitung des 10 % Anteils der Stadt am beitragsfähigen Erschließungsaufwand nach KAG i. V. m. BauGB.
- keine überdurchschnittlich hohen freiwilligen Leistungen. Hier sind auch die defizitären Einrichtungen der Kommune einzubeziehen.
Weitere Details zur Stabilisierungshilfe sind der Internetpräsenz des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat unter folgendem Link zu entnehmen:
Beschlussvorschlag
Der Stadtrat nimmt Kenntnis von den Voraussetzungen, Auflagen und Bedingungen und beschließt die Beantragung der Stabilisierungshilfen 2024 beim Freistaat Bayern unter o. g. Voraussetzungen. Die Verwaltung wird beauftragt alle notwendigen weiteren Schritte zu veranlassen.
Diskussionsverlauf
Stadträtin Deckwerth bemängelt, dass hier wie beim TOP 5 für sie der gleiche Kritikpunkt gelte. Sie wird trotzdem entgegen ihrer Auffassung dafür stimmen, ihr fehlt hier ebenfalls die Würdigung.
Beschluss
Der Stadtrat nimmt Kenntnis von den Voraussetzungen, Auflagen und Bedingungen und beschließt die Beantragung der Stabilisierungshilfen 2024 beim Freistaat Bayern unter o. g. Voraussetzungen. Die Verwaltung wird beauftragt alle notwendigen weiteren Schritte zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 0
zum Seitenanfang
7. Bebauungsplan S 55 - Mühlbachgasse;
Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange, Billigung des Entwurfes zur Beteiligung nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
0241. Sitzung des Stadtrates
|
19.03.2024
|
ö
|
beschliessend
|
7 |
Sachverhalt
Der Stadtrat billigte am 26.09.2023 in öffentlicher Sitzung den Vorentwurf des Bebauungsplans S 55 – Mühlbachgasse und beauftragte die Verwaltung mit der Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit mittels einer öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange.
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB nach § 2 Absatz 4 aufgestellt. Von der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde dennoch nicht abgesehen.
Ziel ist es, das Areal unter Berücksichtigung des Denkmal-, Natur- und Immissionsschutzes in ein innovatives, nachhaltiges und zukunftsfähiges Urbanes Stadtquartier mit einer vitalen Mischung an Nutzungen zu transformieren.
Der Vorentwurf des Bebauungsplans bestehend aus Planzeichnung, Textteil und Begründung mit Vorprüfung des Einzelfalls zur Umweltprüfung lag in der Zeit von Dienstag, 14.11.2023 bis Freitag, 15.12.2023 im Rathaus der Stadt Füssen im Flur des ersten Obergeschosses öffentlich aus und konnte dort während der Öffnungszeiten von jedermann eingesehen werden. Die Unterlagen waren zudem im Internet auf der städtischen Homepage und dem amtlichen Landesportal zur öffentlichen Einsichtnahme eingestellt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden parallel dazu beteiligt und ebenfalls die Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme gegeben.
Ergänzend dazu fand am 30.11.2023 ein Termin vor Ort statt, bei dem der Öffentlichkeit die Planungen vorgestellt wurden und die Gelegenheit bestand, die Inhalte zu erörtern (Bürger-Workshop).
Ergebnisse der eingegangenen Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge siehe in ausführlicher Form als Anlage im Ratsinformationssystem, dto. der zur Billigung vorgeschlagene Entwurf des Bebauungsplanes als Grundlage für die zweite Öffentlichkeits-, Behörden- und Trägerbeteiligung.
Nachstehend die Zusammenfassung der Stellungnahmen und Anregungen:
Stellungnahmen und Anregungen mit Abwägung
Vorbemerkungen
Das Gelände sowie die Gebäude der ehemaligen „Mechanische Seilerwarenfabrik Füssen“, später Hanfwerke Füssen-Immenstadt AG, sind seit der Einstellung der ursprünglichen Produktion zunehmend in einen maroden Zustand verfallen. Durch einen Eigentümerwechsel konnten das Areal, mit neuen Namen „Magnus Park“, bereits in einigen Teilbereichen saniert und einer neuen Nutzung zugeführt werden. Die derzeit renovierten Hallen und Büroräume werden unter anderem von Dienstleistern, Jungunternehmern, Künstlern, Handwerkern, Bildungseinrichtungen und weiteren Gewerbetreibenden genutzt.
Ziel ist es, das Areal unter Berücksichtigung des Denkmal-, Natur- und Immissionsschutzes in ein innovatives, nachhaltiges und zukunftsfähiges Urbanes Stadtquartier mit einer vitalen Mischung an Nutzungen zu transformieren.
Um diese Entwicklung zu ermöglichen, dabei die städtebauliche Ordnung sowie nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten und verkehrliche, grünordnerische, denkmalschutzrechtliche sowie immissionsschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen, ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes gem. § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich.
Der Bebauungsplan S 55 umfasst vollständig die Flurnummern 333, 333/1, 335, 350, 350/1, 3176/4 sowie Teilflächen der Flurnummern 3143, 3176, 3181 der Gemarkung und Stadt Füssen mit einer Fläche von ca. 6,27 ha. Der Geltungsbereich liegt südlich der Stadt Füssen und wird im Norden, Osten und Westen durch den Lech begrenzt. Südlich an das Planungsgebiet angrenzend befindet sich die Bundesstraße B17. Der Geltungsbereich ist über diese erschlossen.
Beteiligungsverfahren
Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB
Im vereinfachten Verfahren kann von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden. Der betroffenen Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange kann innerhalb angemessener Frist Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben oder wahlweise die Auslegung nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt werden. Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung, von dem Umweltbericht, von der Angabe welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung abgesehen. Um die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange frühzeitig und umfassend einzubinden, hat sich die Stadt entschieden, dennoch ein zweistufiges Verfahren mit frühzeitiger Beteiligung durchzuführen. Ergänzend wurde ein Bürger-Workshop am 30.11.2023 durchgeführt.
Die nachfolgend aufgeführten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden in der Zeit vom 14.11.2023 bis einschließlich 15.12.2023 am Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt. Die Planung wurde gem. § 3 Abs. 1 BauGB im gleichen Zeitraum öffentlich ausgelegt. Zudem fanden am 01.06.2023 ein Mietworkshop mit Vertretern der Verwaltung (Herrn Hartl und zweitem Bürgermeister Christian Schneider), am 11.07.2023 ein Workshop mit einer Interessensgruppe und ein Bürgerworkshop am 30.11.2023 statt. Die Ergebnisse des Bürgerworkshops vom 30.11.2023 sind nachfolgend mit aufgeführt. Weitere Stellungnahmen von Seiten der Öffentlichkeit gingen nicht ein.
Keine Stellungnahmen haben abgegeben:
01 Abwasserzweckverband Füssen
05 Bayerische Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen (BSV)
11 Erdgas Allgäu Ost GmbH & Co. KG
12 Feuerwehr Füssen
17 Gemeinde Rieden am Forggensee
22 Kreisbrandrat
28 Landesverband des bayerischen Einzelhandels
31 Regionalverkehr Allgäu GmbH (RVA)
Seitens der Öffentlichkeit wurden abgesehen der Workshop-Ergebnisse keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorgebracht.
Stellungnahmen ohne Bedenken oder Anregungen haben abgegeben:
02 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung vom 20.11.2023
13 Füssen Tourismus und Marketing vom 01.12.2023
14 Gemeinde Eisenberg vom 06.12.2023
15 Gemeinde Hopferau vom 29.11.2023
16 Gemeinde Pfronten vom 24.11.2023
18 Gemeinde Schwangau vom 13.12.2023
19 Handelsverband Bayern e.V. vom 12.12.2023
20 Handwerkskammer für Schwaben vom 20.11.2023
21 Industrie- und Handelskammer für Schwaben vom 15.12.2023
24 Kreishandwerkerschaft Kaufbeuren – Ostallgäu vom 20.11.2023
29 Landratsamt Ostallgäu - Kommunales Bauamt - Kreisstraßenverwaltung und Kommunale Abfallwirtschaft vom 15.12.2023
36 Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben e.V. vom 20.11.2023
Stellungnahmen mit Hinweisen
04 Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben vom 15.12.2023
09 Deutsche Telekom Technik GmbH vom 11.12.2023
10 Elektrizitätswerk Reutte GmbH & Co. KG vom 27.11.2023
25 Kreisheimatpflege – Bodendenkmalpflege vom 15.12.2023
33 schwaben netz GmbH vom 01.12.2023
35 Stadtwerke Füssen vom 24.11.2023
Stellungnahmen mit Bedenken oder Anregungen haben vorgebracht:
1. TÖB
03 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 14.12.2023
06 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege vom 12.12.2023
07 Bayerisches Landesamt für Umwelt vom 04.12.2023
08 BUND Naturschutz Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren vom 11.12.2023
23 Kreisfischereiverein Füssen e. V. vom 11.12.2023
26 Kreisheimatpflege – Baudenkmalpflege, Planungs- und Bauwesen vom 14.12.2023
27 Landesbund für Vogelschutz Kreisgruppe Ostallgäu/Kaufbeuren vom 30.11.2023
29 Landratsamt Ostallgäu - Bauplanungsrecht/Städtebau, Untere Wasserrechtsbehörde, Untere Naturschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde, Untere Bodenschutzbehörde vom 15.12.2023
30 Regierung von Schwaben vom 13.12.2023
32 Regionaler Planungsverband Allgäu vom 15.12.2023
34 Staatliches Bauamt Kempten vom 23.11.2023
37 Wasserwirtschaftsamt Kempten vom 15.12.2023
2. Öffentlichkeit
01 Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung vom 30.11.2023
1. Träger öffentlicher Belange
Stellungnahmen mit Hinweisen
- Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben vom 15.12.2023
|
|
- Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage
|
|
|
Im Bereich des Bebauungsplanes S 55 „Mühlbachgasse“ der Stadt Füssen liegt kein aktuelles oder geplantes Verfahrensgebiet nach dem Flurbereinigungsgesetz. Auch weitere Maßnahmen in Zuständigkeit des Amtes für Ländliche Entwicklung Schwaben sind in dem betroffenen Bereich weder in Durchführung noch in Planung. Die Entwicklung eines teilweise leergefallenen Industriegebietes für weitere gemischte Nutzung anstelle der Neuausweisung von entsprechendem Bauland wird begrüßt. Das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben hat daher keine Einwände. Eine weitere Beteiligung ist daher nicht erforderlich.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme. Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme.
|
|
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplanvorentwurfs.
|
|
|
- Deutsche Telekom Technik GmbH vom 11.12.2023
|
|
- Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:
|
|
|
Im Planungsbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Deutschen Telekom. Deren Bestand und Betrieb müssen weiterhin gewährleistet bleiben. Sollten diese Anlagen von den Baumaßnahmen berührt werden, müssen diese gesichert, verändert oder verlegt werden, wobei die Aufwendungen der Telekom hierbei so gering wie möglich zu halten sind.
Es sind Kupfer- und Glasfaserleitungen im südlichen Bereich des Plangebiets vorhanden.
Falls im Planungsbereich Verkehrswege, in denen sich Telekommunikationsanlagen der Deutschen Telekom befinden, entwidmet werden, bitten wir gesondert mit uns in Verbindung zu treten.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme und darin enthaltene Hinweise zu den bestehenden Telekommunikationsanlagen. Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme und sind auf Ebene der nachfolgenden Ausführungsplanung vom jeweiligen Grundstückseigentümer / Bauherrn zu berücksichtigen.
|
|
Sollten Sie im Rahmen dieses Verfahrens Lagepläne unserer Telekommunikationsanlagen benötigen, können diese angefordert werden bei:
E-Mail: Planauskunft.Sued@telekom.de
Fax: +49 391 580213737
Telefon: +49 251 788777701
Die Verlegung neuer Telekommunikationslinien zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsinfrastruktur im und außerhalb des Plangebiets bleibt einer Prüfung vorbehalten.
Damit eine koordinierte Erschließung des Gebietes erfolgen kann, sind wir auf Informationen über den Ablauf aller Maßnahmen angewiesen. Bitte setzen Sie sich deshalb so früh wie möglich, jedoch mindestens 4 Monate vor Baubeginn, in Verbindung mit:
Deutsche Telekom Technik GmbH
Technik Niederlassung Süd, PTI 23
Gablinger Straße 2
D-86368 Gersthofen
Diese Adresse bitten wir auch für Anschreiben bezüglich Einladungen zu Spartenterminen zu verwenden.
Für die Beteiligung danken wir Ihnen.
|
|
|
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplanvorentwurfs.
|
|
|
- Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co. KG vom 27.11.2023
|
|
- Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage.
|
|
|
Die Elektrizitätsversorgung des Bebauungsplangebietes „Mühlbachgasse“ ist sichergestellt über unser regionales Verteilungsnetz (20 kV Leitungen), sowie der 20 kV-Trafostationen „Tiroler Straße“ welche sich außerhalb des überplanten Bereiches befindet.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme. Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme.
|
|
Der überplante Bereich ist momentan ein sog. geschlossenes Verteilernetz welches im Kundeneigentum ist. Das o. g. Bebauungsplangebiet ist derzeit nicht erschlossen. Der Stromanschluss der Neubauten erfolgt grundsätzlich über 1 kV-Erdkabel, welche im Zuge der Erschließung noch zu verlegen sind.
|
Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme und sind auf Ebene der nachfolgenden Ausführungsplanung vom jeweiligen Grundstückseigentümer / Bauherrn zu berücksichtigen.
|
|
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplanvorentwurfs.
|
|
|
- Kreisheimatpfleger – Bodendenkmalpflege vom 15.12.2023
|
|
- Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für die Beteiligung.
Das Plangebiet ist derzeit zum großen Teil schon bebaut.
Durch die Maßnahme sind mehrheitlich Baudenkmäler betroffen; das Plangebiet liegt - wie richtig beschrieben - nicht direkt in einem derzeit bekannten Bodendenkmal. Lediglich an den Rändern des Plangebietes finden sich schon bekannte Bodendenkmäler, die auch alle beide angegeben sind.
Der richtige Umgang mit weiteren Bodendenkmälern, die vielleicht während neuer Bodeneingriffe zutage treten ist sehr gut beschrieben. Daher habe ich aus Sicht des für Bodendenkmäler zuständigen Kreisheimatpflegers grundsätzlich keine Anregungen.
Zusätzlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass gerade in der Gegend um Füssen und um den heutigen Forggensee die ältesten Bodendenkmäler des Landkreises Ostallgäu bekannt sind. Darüber hinaus gibt es über den Landkreis verteilt Einzelfunde aus der Mittelsteinzeit, die auch im Plangebiet nicht auszuschließen sind. Diese möglichen Einzelfunde hätten mit Füssen und auch mit dem Plangebiet (Gipsmühle, Seilwarenfabrik, Hanfwerke) nichts zu tun, denn sie lägen einige tausend Jahre vor der Gründung von Füssen und auch der Industrieanlagen, die neu überplant werden.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme und den Informationen zu den ältesten Bodendenkmälern des Landkreises Ostallgäu. Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme.
|
|
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplanvorentwurfs.
|
|
|
- Schwaben netz GmbH vom 01.12.2023
|
|
- Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Sehr geehrte Damen und Herren, in Beantwortung Ihres oben genannten Schreibens teilen wir Ihnen mit, dass wir gegen den Bebauungsplan keinen Einwand erheben.
|
|
|
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Planungsbereich bereits Erdgasleitungen von uns betrieben werden, deren Bestand und Betrieb zu sichern ist.
Aktuelle Bestandspläne können auf der Homepage der schwaben netz gmbh unter folgender Adresse angefordert werden: „https://planauskunft.schwaben-netz.de/“
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme. Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme und sind auf Ebene der nachfolgenden Ausführungsplanung vom jeweiligen Grundstückseigentümer / Bauherrn zu berücksichtigen.
|
|
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplanvorentwurfs.
|
|
|
- Stadtwerke Füssen vom 24.11.2023
|
|
- Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Stellungnahme der beitragsveranlagenden Stelle:
|
|
|
Von Seiten der beitragsveranlagenden Stelle für leitungsgebundene Anlagen nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) ist es mir ein Anliegen, auf die Notwendigkeit der Festsetzungen für das Maß der baulichen Nutzung in Bebauungsplänen hinzuweisen, im besten Fall nach GFZ. Dies wurde bei der B-Plan-Aufstellung S 55 „Mühlbachgasse“ berücksichtigt und auf GFZ 3,0 festgesetzt.
Für spätere Berechnungen der zulässigen Bebauung bzw. der Beitragspflicht ist eine Übersicht des bisherigen Bestandes nach einzelnen Gebäuden mit Angabe der Geschossfläche zudem unabdingbar. So wie es sich darstellt, werden Gebäudeteile abgebrochen. Diese wären in die Übersicht mit aufzunehmen, allerdings mit dem Hinweis „Abbruch vorgesehen“. Der Bestand ist beitragsrechtlich abgegolten. Zu einer Nachveranlagung kommt es erst, wenn die GFZ des Bestandes durch spätere Zubauten überschritten wird.
Meine heutige Stellungnahme hat keine Auswirkungen auf den Aufstellungsprozess des B-Plans S 55. Dennoch bitte ich, dies im Rahmen der Planungen zu berücksichtigen und, da mir die Zuständigkeiten nicht bekannt sind, ggf. bei geeigneter Stelle die Übersicht über den bisherigen Bestand anzufordern und mir zukommen zu lassen.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme. Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme und sind auf Ebene der nachfolgenden Ausführungsplanung vom jeweiligen Grundstückseigentümer / Bauherrn zu berücksichtigen.
|
|
Stellungnahme der technischen Abteilung:
|
|
|
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Bereich der Mühlbachgasse (Einfahrt Brücke) ist das komplette Areal versorgungstechnisch in privater Nutzung. Derzeit ist dies über einen Wasserzählerschacht (Übergabeschacht blauer PIN oben rechts im Bild) Q³/6 DN50 erschlossen. Hier ist zu prüfen ob der zukünftige Trinkwasserbedarf gedeckt werden kann mit dem jetzigen Bestand.
Der Grundschutz (Löschwasser DVGW W 405) wird über die Tiroler Straße sowie den Lech als unerschöpfliche Quelle sichergestellt. Hier ist für das angefragte Bauvorhaben in Zusammenarbeit eines Brandschutzgutachters die Löschwasserbedarfsermittlung durchzuführen. Ebenso ist die Art sowie das Maß (Festsetzungen) der baulichen Nutzungen gemäß Baunutzungsverordnung zu beachten und zu prüfen.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme. Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme und sind auf Ebene der nachfolgenden Ausführungsplanung vom jeweiligen Grundstückseigentümer / Bauherrn zu berücksichtigen.
Die Löschwasserversorgung aus dem Lech kann über die seit dem 19. Jahrhundert vorhandene und zuletzt wieder freigelegte Löschwasserentnahmestelle sichergestellt werden. Die Feuerwehraufstellfläche ist vom Stadtrat einstimmig gebilligt worden.
Zum Thema Löschwasser gab es bereits Abstimmungen zwischen dem Grundstückseigentümer, dem Kreisbrandrat Herrn Barnsteiner und einem geprüften Sachverständiger für vorbeugenden Brandschutz (EIPOS).
|
|
|
|
|
Stellungnahme vom Fachbereich Wasserversorgung:
|
|
|
In Anlehnung an unsere Stellungnahme vom Fachbereich Wasserversorgung vom 13. November 2023 erhalten Sie nachfolgendes Statement vom Fachbereich Abwasser der Stadtwerke Füssen:
|
|
|
Das Areal um die Mühlbachgasse ist im Privatbesitz. Die Entsorgungseinrichtungen wie Abwasserkanäle, Pumpstationen sowie Anlagen zur Regenwasserbehandlung liegen somit in privater Verantwortung.
Nach aktuellem Stand bedeutet dies, dass vom Eigentümer sämtliche Abwasser-Infrastruktur auf dem Areal bis zum Übergang Zufahrt/Tiroler Straße zu errichten, betrieben und zu unterhalten ist.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme. Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme und sind auf Ebene der nachfolgenden Ausführungsplanung vom jeweiligen Grundstückseigentümer / Bauherrn zu berücksichtigen.
|
|
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplanvorentwurfs.
|
|
|
Stellungnahmen mit Bedenken oder Anregungen
- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 14.12.2023
|
|
- Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage:
|
|
|
Bereich Forsten:
Innerhalb des Satzungsgebietes liegt kein Wald i.S.d. § 2 Bundeswaldgesetz (BWaldG) i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG).
Feuergefahr:
Zum Schutz der angrenzenden Waldflächen weisen wir darauf hin, dass offene Feuerstätten oder unverwahrtes Feuer (z. B. Lagerfeuer- oder Grillplätze) auf den Grundstücken, welche weniger als 100 Meter Abstand zum Wald haben, gem. Art. 17 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BayWaldG, erlaubnispflichtig sind. Dieser Hinweis sollte in die Satzung aufgenommen werden.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme und dem Hinweis zur Feuergefahr der angrenzenden Waldflächen und Art. 17 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BayWaldG.
Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme und sind im weiteren Betrieb und der weiteren Nutzung des Grundstücks vom Eigentümer zu beachten.
Um darauf aufmerksam zu machen, wird die Stadt Füssen den vorgeschlagenen Hinweis in die textlichen Hinweise und nachrichtlichen Übernahmen der Satzung mit aufnehmen.
|
|
Bereich Landwirtschaft:
Es werden keine Einwendungen erhoben.
|
|
|
|
|
Der Bebauungsplanvorentwurf wird entsprechend der fachlichen Würdigung/ Abwägung redaktionell durch einen Hinweis zur Feuergefahr ergänzt.
|
|
|
- Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege vom 12.12.2023
|
|
- Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Zuständiger Gebietsreferent:
Bau- und Kunstdenkmalpflege: […]
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, wie folgt Stellung:
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme.
|
|
Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange:
Die Konversion und das Erhaltungsziel für das ehemalige historische Hanfwerkeareal von Füssen wurde im Rahmen mehrerer vorangegangener Arbeitstermine mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege erläutert. In diesem Zusammenhang wurde der Gebäudebestand hinsichtlich seiner Denkmalwerte geprüft und im Ergebnis und im Benehmen mit der Stadt Füssen in die Denkmalliste des Freistaats Bayern teilweise wie folgt eingetragen.
|
Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme.
|
|
Ehem. mechanische Seilerwarenfabrik Füssen, später Hanfwerke Füssen- Immenstadt AG, mehrteilige Anlage in stadtbildprägender Lage auf dem Lechgries: Drei langgestreckte zwei-- und dreigeschossige und in Teilen erhaltene Stangenbauten aus Natursteinquadern bzw. mit Putzfassaden mit einfacher Fassadengliederung, Mitteltrakt im Kern 1862/64, ostseitig angefügter zweigeschossiger Verwaltungsbau mit Zeltdach, Gauben, Rundbogenfenstern und Gesimsband in Formen des Heimatschutzstils, 1916, Nordtrakt um 1900, Südtrakt in Formen des geometrischen Jugendstils, mit Uhrturm, um 1910; Verbindungsbrücken, genietete Stahlfachwerkkonstruktionen, teilweise modern verkleidet, um 1900/1910; Werkstättengebäude, langgestreckter zweigeschossiger Satteldachbau, um 1925; Kesselhaus Betonrasterbau, nach 1900. ... D-7-77-129-124
|
Die Beschreibung zum „Ehem. mechanische Seilerwarenfabrik Füssen, später Hanfwerke Füssen- Immenstadt AG“ dient der Kenntnisnahme.
|
|
Wassertriebanlage zur Kraftversorgung der ehem. Mühlen und der Fabrik auf dem Lechgries mit unterirdischem Wasserkanal durch den Lechfallfelsen, 1784-87 angelegt, hölzernen Fallenhäusern zur Regulierung der Wasserzufuhr und zur Kiesbeseitigung am Tunnelbeginn und am Tunnelende, 1864 erbaut, teilweise 1901 erweitert sowie mit Mühlen- und Fabrikkanal unterhalb des Tunnelendes. D-7-77- 129-216
|
Die Beschreibung zur „Wassertriebanlage zur Kraftversorgung der ehem. Mühlen und der Fabrik auf dem Lechgries“ dient der Kenntnisnahme.
|
|
Der Entwurf des „Städtebaulichen Masterplans Magnus Park Füssen“ wurde zuletzt anlässlich eines groß anberaumten Scoping-Termins am 05.04.2023 mit Vertreterinnen und Vertretern des Landesamtes vom Grundsatz her vorbesprochen. Im Rahmen des Termins wurde seitens der Denkmalpflege vorrangig eine Reduktion und Verschiebung des Parkhauses (sog. Mobilitätshub) sowie zumindest eine teilweise Wiederöffnung des ohne denkmalschutzrechtliche Erlaubnis verfüllten, denkmalgeschützten Mühlgrabens dringend angeregt.
|
Bei dem auf Initiative der Stadt Füssen und Eigentümers einberufenen Scoping-Termin am 05.04.2023 wurde vom Büro OPLA die Charakteristik des Masterplans erläutert. Der städtebauliche Masterplan sowie der daraus entwickelte Bebauungsplan haben gemeinsam das Hauptziel, die bestehende historische Bebauung zu sichern und als solche wieder erlebbar zu machen. Als Ergänzung zum Bestand soll zudem der „Südbau“ in seiner Zeilenstruktur bis auf die Höhe des Lechbaus verlängert werden, wodurch die neue Platzgestaltung beim Eingang des Magnus Parks städtebaulich hervorgehoben wird. Eine strenge Grünordnung betont zudem die Zeilenbebauung. Die notwendigen und öffentlichen Stellplätze sollten nach bisheriger Planung in einem zentralen Mobilitätshub untergebracht werden, sodass das historische Ensemble durch den ruhenden Verkehr nicht beeinträchtigt wird und ein weitestgehend autofreies Quartier mit hochwertiger Freianlagen entstehen kann.
Der angestrebte attraktive urbane Nutzungsmix (Gewerbe, Handwerk, Dienstleitungen, Gastronomie, Indoor-Freizeit Nutzungen, Bildung, ergänzendes Wohnen) selbst dann eine erhebliche Erhöhung des Stellplatzbedarfs im Magnus Park, wenn von der Stellplatzsatzung der Stadt Füssen abweichende Stellplatzzahlen festgesetzt werden.
Die Anzahl der notwendigen Stellplätze wären selbst um den Preis einer noch weitergehenden Flächenversieglung gegenüber dem Bestand nicht abbildbar. Eine Verteilung der notwendigen Stellplätze im gesamten Quartier stünde zudem im diametralen Widerspruch zu den oben genannten städtebaulichen Zielen einer Aufwertung und Attraktivierung der Freiraumgestaltung und Erlebbarkeit des Industriedenkmals.
Die Konsequenz aus den oben genannten städtebaulichen Zielen ist die Bündelung der Stellplätze in einem Mobilitätshub. Für diesen wurden unter Berücksichtigung der oben angeführten städtebaulichen, landschaftlichen und denkmalschutzfachlichen Leitziele verschiedene Standortvarianten untersucht.
Bei dieser Alternativenprüfung wurden folgende Kriterien beachtet:
- denkmalgeschützte Gebäude mit vorgegebenem Raster und beschränkter Statik
- Sicherung von bestehendem Gewerbe (Faserzentrum als Ankermieter des Magnus Parks)
- Einbindung in das historische Ensemble und Landschaft
- hohe Grundwasserstände und schwierige Bodenbeschaffenheit.
Eine Integration des Mobilitätshubs in die historischen Gebäude scheidet aus mehreren Gründen aus. Die historische Bausubstanz weist keine hinreichende Tragkraft auf. Eine statische Ertüchtigung lässt sich weder wirtschaftlich noch denkmalschutzrechtlich darstellen. Darüber hinaus lässt die baukonstruktive Rasterung keine effiziente Parkraumverteilung zu. Die erforderlichen Erschließungsanlagen würden grob verunstaltend wirken und dem Leitziel eines autofreien Quartiers widersprechen.
Konsequenz hieraus ist, dass nur der Neubau eines Mobilitätshubs diesen städtebaulichen Zielen Rechnung tragen kann. Für den Neubau wurden verschiedene Varianten geprüft.
Ergebnis dieser städtebaulichen Ziele und Variantenuntersuchung ist, dass eine Neuerrichtung eines Mobilitätshubs nur an der geplanten Stelle städtebaulich sinnvoll ist und den denkmalschutzfachlichen Ansprüchen des Industrieareals Rechnung trägt.
Das BLfD hat selbst im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens signalisiert, dass die Wiederöffnung des Mühlgrabens kein denkmalschutzfachliches Dogma ist und einer hochwertigen städtebaulichen Entwicklung des Quartiers nicht im Weg stehen soll. Vorrangiges Ziel der Bauleitplanung ist es, die derzeitige historische Bebauung wieder erlebbar zu machen. Weiterhin wolle man die südliche Zeile bis Höhe des Lechbaus verlängern, um die Platzgestaltung beim Eingang des Magnus Parks städtebaulich hervorzuheben. Eine strenge Grünordnung betone zudem die Zeilenbebauung. Die notwendigen und öffentlichen Stellplätze sollten nach bisheriger Planung in einem zentralen Mobilitätshub untergebracht werden, sodass das historische Ensemble durch den ruhenden Verkehr nicht beeinträchtigt wird. Von der Vertreterin und dem Vertreter des Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege wurde zudem betont, dass der Mühlbachgraben nicht im Vordergrund stehe, wenn die städtebauliche Zeilenstruktur als Mehrwert gewonnen werde.
Ergebnis der Vorabstimmung war, dass für die Verfüllung des Mühlgrabens kompensatorische Maßnahmen denkbar sind.
|
|
Der nunmehr vorliegende Vorentwurf des Bebauungsplans S 55 „Mühlgraben“ (Büro Opla, Fassung 26.09.23) sieht im Baufenster 5 wider erwarten weiterhin einen viel zu weit nach Norden ragenden Baukörper vor. Wie bereits am Scoping-Termin am 05.04.23 erläutert, bedarf es aufgrund der drohenden Dominanz unmittelbar gegenüber der Altstadt von Füssen weiterhin einer signifikanten Verlagerung nach Westen beziehungsweise einer Reduktion des Bauvolumens zumindest bis auf Höhe des momentan vorgesehenen Gebäudeknicks.
|
Die im Scoping-Termin angeregte Reduktion und Verlagerung des Mobilitätshubs in südwestliche Richtung wurde vom Grundstückseigentümer und dem Büro OPLA geprüft. Eine Verortung des Mobilitätshubs an der Stelle der südlichen Gewerbehalle scheidet aus. Das ehem. Faserzentrum ist Ende der 1980er Jahre aus Mitteln der Wirtschaftsförderung von Bund und Länder unter Einsatz des damaligen bayrischen Ministerpräsidenten gefördert worden und war Bestandteil einer Kooperation des Freistaats Bayern mit dem Land Baden-Württemberg. Das Faserzentrum sollte in Kooperation mit dem wissenschaftlichen Transferzentrum für nachwachsende Faserrohstoffe in Reutlingen Prozesse der Aufbereitung, der Spinnerei, des Webens, des Färbens und der Ausstattung untersuchen sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit praktischem Bezug für die industrielle Weiterverarbeitung der Flachsfaser im textilen und nichttextilen Bereich leisten (siehe etwa LT-Drs. Baden-Württemberg 10/2488, S. 7). Das Faserzentrum ist damit – wie der Magnus-Park insgesamt – ein Zeugnis bayrischer und baden-württembergischer Industriepolitik und des Niedergangs der deutschen Textilindustrie. Zugleich ist das ehem. Faserzentrum auch heute noch mit dem wichtigsten Ankermieter (Erhart GmbH, Werkzeug- und Gerätebau) des Magnus Park belegt. Eine nachhaltige und wirtschaftlich darstellbare Entwicklung des Quartiers kann nur mit Rücksicht auf die bestehenden Mieter gelingen. Ein Bestandschutz der bestehenden Mieter ist für den Stadtrat neben der Revitalisierung des Gesamtquartiers vorrangiges Planungsziel.
Eine Überbauung der Halle wurde vom Eigentümer geprüft, ist aber aus bautechnischen und statischen Gründen nicht wirtschaftlich darstellbar und wäre auch denkmalfachlich nicht adäquat. Die Anregung, den Mobilitätshub weitestgehend als Verlängerung an die südliche Gewerbehalle zu rücken, nähme der Gewerbehalle ihre zentrale Zufahrt sowie Aufstell- und Wendeflächen, die auch weiterhin jedenfalls für LKW von 7,5 bis jedenfalls 20 t gewährleistet bleiben müssen. Die vorgeschlagene Verortung würden zwar denkmalfachliche Belange noch weiter stärken, zugleich jedoch die Existenz bestandsgeschützter gewerblicher Nutzungen und einen Gewerbebetrieb mit über 50 Arbeitsplätzen, der aktuell Investitionen in Millionenhöhe tätigt, gefährden. Sie scheidet vor diesem Hintergrund aus.
Am derzeit geplanten Standort des Mobilitätshubs standen nördlich sowie nordöstlich der Filialkirche „Unserer Lieben Frau am Berg“ bereits um 1911 mehrere Gebäude. Die Nutzungen waren unter anderem Fabrikkrankenhaus, Mädchenheim, Werkbibliothek, Kindergarten (Stillstube, Kinderkrippe, Knaben- und Mädchenhort), Arbeiter-Wohngebäude mit 9 Einheiten und Mühlen. Südlich des ehemaligen Mühlbachs verlief zudem ein Weg, welcher ausschließlich den Arbeitern zur Verfügung stand. Aus den historischen Plänen über die bauliche Erweiterung im Wohngebäude ist zu erkennen, dass die Wohnhäuser eine Gesamthöhe von ca. 11 m hatten.
Die Bauleitplanung stellt sicher, dass der Baukörper nicht über die Fahrbahnkante der Tiroler Straße hinausragt. Die notwendigen Stellplätze können somit nicht in einem höheren, sondern nur in einem flächigeren Baukörper untergebracht werden. Andere Standorte auf dem Grundstück stehen zudem nicht ohne größere Verluste bzw. Eingriffe zur Verfügung, da diese entweder durch bestehende Gewerbebetriebe oder den vorhandenen, zu schützenden und zu stärkenden denkmalgeschützten Gebäuden belegt sind. Voraussichtlich wird für den jetzigen Stellplatzbestand bereits ca. 60 - 80 % des Bauvolumens bis zum momentan vorgesehenen Gebäudeknicks notwendig. Eine Revitalisierung der noch ungenutzten Flächen hat zudem zur Folge, dass weiterer Stellplatzbedarf notwendig wird. Auch wenn dieser Abweichend und überlagernd von der Stellplatzsatzung berechnet wird. Ist ein entsprechender Baukörper notwendig.
Die Stadt Füssen ist sich des Eingriffs des geplanten Mobilitätshubs in die denkmalfachliche Ausstrahlung der Einzelbaudenkmäler bewusst. Erst durch die Bauleitplanung und den darin angelegten Rückbau der Zwischenbauten werden freilich die denkmalfachlichen Qualitäten der historischen Zeilenstruktur herausgearbeitet und zu neuem Leben erweckt. Unterstützt wird diese Wirkung durch eine hochwertige Freianlagengestaltung. Der Mobilitätshub stellt aus der Sicht der Stadt Füssen den notwendigen Kompromiss zwischen den Anforderungen des Denkmalschutzes, der objektiven Notwendigkeit, die Stellplätze im Quartier unterzubringen und dem städtebaulichen Ziel einer nachhaltigen Transformation des Magnus-Parks unter Sicherung der vorhandenen Gewerbebetriebe und Arbeitsplätze dar. Im Ergebnis wird die denkmalfachliche Situation gegenüber dem Status quo deutlich aufgewertet.
Die Stadt Füssen stellt mit ihren Festsetzungen und ergänzenden vertraglichen Regelungen sicher, dass das Mobilitätshub entsprechend sensibel in das Areal integriert wird. Darüber hinaus verpflichtet die Stadt Füssen den Grundstückseigentümer im städtebaulichen Ausführungsvertrag, die Fassadengestaltung mit der Stadt und dem Denkmalschutz abzustimmen. Hierdurch wird sichergestellt, dass aus mehreren Blickachsen des technischen Bauwerks nicht oder nur zu Teilen in Erscheinung tritt. Die Stadt Füssen kann die Bedenken des BLfD im Ergebnis nachvollziehen, stellt diese aber im Rahmen der Abwägung hinter die verfolgten Planungsziele zurück.
|
|
Auch die am Scoping-Termin thematisierte (Teil-)öffnung des verfüllten Mühlgrabens zwischen dem Parkhaus und der Lecheinmündung (Grünordnerische Freifläche 2) findet sich im vorliegenden Vorentwurf wider erwarten nicht berücksichtigt. Bezeichnenderweise soll der Bebauungsplan S 55 nach eben diesem denkmalgeschützten Bauwerk benannt werden.
|
Wie bereits oben erläutert, wurde von der Vertreterin und dem Vertreter des Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege betont, dass der Mühlbachgraben nicht im Vordergrund stehe, wenn die städtebauliche Zeilenstruktur als Mehrwert gewonnen werde. Durch den geplanten Rückbau der Zwischenbauten sowie der strengen Grünordnung wird dieses städtebauliche Ziel erreicht. Des Weiteren wurde beim gemeinsamen Scoping-Termin von Seiten des Landesamtes erklärt, dass der Mühlbachgraben unter Umständen auch auf einer nur begrenzten Länge von zwei bis drei Meter oder am Anfangspunkt (z.B. die Lecheinbuchtung mit 2-3 Meter unter der Brücke) und am Endpunkt (Rückgebäude Kesselhaus) präsentiert werden könne.
Im Gesprächsverlauf hat man sich auf die zwei Standorte Anfang- und Endpunkt verständigt.
Im städtebaulichen Masterplan, welcher beim Scoping-Termin erläutert wurde und Grundlage des Bebauungsplans darstellt, werden die zwei Standorte zur historischen Würdigung „Lecheinbuchtung unter der Brücke“ und „Rückgebäude Kesselhaus“ dargestellt. An dieser Variante der historischen Würdigung hält die Stadt Füssen auch weiterhin fest. Um dieser Planung nochmals Nachdruck zu verleihen werden in der Planzeichnung die zwei Standorte durch Hinweise gekennzeichnet und in der Begründung genauer erläutert. Die konkrete Umsetzung unter Einbindung des BLfD wird in einem städtebaulichen Vertrag mit dem Entwickler vor Satzungsbeschluss vertraglich vereinbart.
|
|
Der dritte wesentliche Aspekt der Denkmalpflege betrifft die vorgesehene Erweiterung des denkmalgeschützten Südbaus (Baufenster 3.1 Südbau). Sie ist aus Sicht der Denkmalpflege maximal zweigeschossig mit Flachdach - nicht hingegen profilgleich mit dem Denkmal - möglich, um die prägende Stirnfassade des denkmalgeschützten Südbaus zu wahren.
|
Der Stellungnahme wird Rechnung getragen. Die Erweiterung des Anbaus wird auf die Höhe im Bestand (zwei Geschosse wie im Bestand vorhanden) mit Flachdach reduziert.
|
|
Das Landesamt regt dringend eine dementsprechende Abänderung des vorliegenden Vorentwurfs des Bebauungsplans S 55 „Mühlbachgraben“ (Büro Opla, Fassung 26.09.23) an, um die Bedenken der Denkmalpflege zu den genannten Themenfeldern auszuräumen.
|
|
|
Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de).
|
|
|
|
|
Der Bebauungsplanvorentwurf wird entsprechend der fachlichen Würdigung/ Abwägung redaktionell durch Hinweise zur historischen Würdigung des Mühlgrabens ergänzt. Der Bebauungsplanvorentwurf wird dahingehen geändert, dass die Erweiterung des Südbaus auf die Höhe im Bestand mit Flachdach begrenzt wird.
|
|
|
- Bayerisches Landesamt für Umwelt vom 04.12.2023
|
|
- Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Sehr geehrte Damen und Herren, mit E-Mail vom 13.11.2023 geben Sie dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der o.g. Planänderung.
|
|
|
Als Landesfachbehörde befassen wir uns v. a. mit umweltbezogenen Fachfragen bei Planungen und Projekten mit überregionaler und landesweiter Bedeutung, mit Grundsatzfragen von besonderem Gewicht sowie solchen Fachbelangen, die von örtlichen oder regionalen Fachstellen derzeit nicht abgedeckt werden (z. B. Rohstoffgeologie, Geotopschutz, Geogefahren).
|
|
|
Von den o.g. Belangen werden die Geogefahren berührt. Dazu geben wir folgende Stellungnahme ab:
Die Gefahrenhinweiskarte des Bayerischen Landesamts für Umwelt weist für Bereiche im Süd- und Südostteil des Planungsgebiets die Gefahr von Steinschlag/Blockschlag aus. Die Gefahrenhinweisbereiche sind das Ergebnis einer Modellierung im Übersichtsmaßstab 1:25.000. Von einer Neubebauung im sturzgefährdeten Bereich wird von uns grundsätzlich abgeraten. Für bestehende Bauten werden je nach konkreter Gefährdungslage, die nur vor Ort durch einen einschlägig erfahrenen Fachmann beurteilt werden kann, Schutzmaßnahmen angeraten. Sollten bereits Schutzmaßnahmen vorhanden sein, so müssen diese regelmäßig auf ihren Zustand und ihre ausreichende Dimensionierung geprüft und gewartet, ggf. ersetzt werden. Dies muss für die Lebensdauer des Gebäudes gewährleistet sein. Zudem ist jedes Schutzbauwerk nur für ein bestimmtes Bemessungsereignis ausgelegt, kommt es zu einem größeren Ereignis, wird das Schutzbauwerk mit hoher Wahrscheinlichkeit versagen. Schutzbauwerke können daher keine absolute Sicherheit bieten.
Es wird dringend empfohlen, im potenziellen Gefahrenbereich keine neuen Nutzungen mit erhöhter Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Personen zuzulassen.
Ausführlichere Informationen zur Gefahrenhinweiskarte finden Sie unter:
www.umweltatlas.bayern.de > Standortauskunft > Geogefahren
Bei weiteren Fragen zu Geogefahren wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Stefan Glaser (Tel. 0821/9071-1390, Referat 102).
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme sowie den darin enthaltenen Informationen aus der Gefahrenhinweiskarte.
Wie der Stellungnahme und der Gefahrenhinweiskarte zu entnehmen ist, wird im Süd- und Südostteil des Planungsgebiets Bereiche mit Steinschlag/Blockschlag (ohne und mit Wald) ausgewiesen.
Der überwiegend bereits bebaute Gebäudebestand befindet sich außerhalb dieses potenziellen Gefahrenbereichs. Lediglich eine Gewerbehalle im Süden ist im Bestand davon betroffen. Der neu geplante Mobilitätshub würde zudem teilweise im potenziellen Gefahrenbereich liegen.
Die Ausführungen zu Schutzmaßnahmen bei Bestandsgebäuden werden zur Kenntnis genommen und sind vom Grundstückseigentümer / Bauherrn zu beachten.
Der Empfehlung, keine neuen Nutzungen mit erhöhter Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Personen im potenziellen Gefahrenbereich zuzulassen, wird bereits dadurch Rechnung getragen, dass es sich bei dem geplanten Gebäude um einen Mobilitätshub für den ruhenden Verkehr handelt, in dem sich keine Personen dauerhaft, sondern bestimmungsgemäß nur vorübergehend aufhalten. Eine längere Aufenthaltsdauer von Personen ist nicht zu erwarten.
|
|
Zu den örtlich und regional zu vertretenden Belangen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und des technischen Umweltschutzes verweisen wir auf die Stellungnahmen des Landratsamtes Ostallgäu (Untere Naturschutzbehörde und Untere Immissionsschutzbehörde).
Die Belange der Wasserwirtschaft und des vorsorgenden Bodenschutzes werden vom Wasserwirtschaftsamt Kempten wahrgenommen. Diese Stellen beraten wir bei besonderem fachspezifischem Klärungsbedarf im Einzelfall.
|
Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme.
|
|
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplanvorentwurfs.
|
|
|
- BUND Naturschutz Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren vom 11.12.2023
|
|
- Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Anbei die Stellungnahme des BUND Naturschutz zum Bebauungsplan S 55 – Mühlbachgasse, Füssen.1.
Der BUND verlangt die Durchführung einer saP (spezielle artenschutzrechtliche Prüfung) im gesamten Planungsgebiet des Bebauungsplans S 55 Mühlbachgasse. Die Erarbeitung einer saP halten wir für erforderlich aufgrund der Situierung des Projektgeländes zwischen dem Fuß eines Berghanges und dem Uferbereich des Flusses Lech.
|
Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um eine Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB. Der planbedingte Eingriff ist bereits erfolgt und der Magnus Park wird bereits im Bestand gewerblich und handwerklich, zu Teilen auch intensiv, genutzt. Die „Situierung des Projektgeländes“ entspricht dem baulich nutzbaren Bestand. Der Bebauungsplan greift weder in den Uferbereich des Lechs noch in den Fuß des Berghangs weitergehend als im Bestand ein.
Die Zugriffsverbote des Artenschutzes werden zudem nicht durch den Bebauungsplan, sondern erst in seinem Vollzug durch konkrete Baumaßnahme berührt. Den aufgerufenen artenschutzrechtlichen Belangen kann durch entsprechende Nebenbestimmungen zu den Baugenehmigungen Rechnung getragen werden.
Um die Belange des Artenschutzes mit den ihm zukommenden Gewicht in die Abwägung einzustellen, wird dennoch eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung durchgeführt. Sollte diese Relevanzprüfung ergeben, dass eine saP erforderlich wird, wird diese vor Satzungsbeschluss durchgeführt. Die sich aus der saP eventuell ergebenden CEF-Maßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen und Vermeidungsmaßnahmen werden insbesondere im städtebaulichen Vertrag verbindlich vor Satzungsbeschluss geregelt.
Der Stellungnahme wird insoweit Rechnung getragen.
|
|
2. Der BUND fordert die Wiederherstellung des widerrechtlich verschütteten Mühlbachs in seiner ursprünglichen Wirkung.
|
Der Mühlbach wurde im Zuge der Errichtung der südlichen Gewerbehalle, endgültig stillgelegt. Somit ist bereits seit über 30 Jahren kein Fließgewässer mehr vorhanden. Lediglich im Falle eines Hochwassers, ist der stillgelegte Mühlgraben vor seiner Verfüllung geflutet worden. Seit dem letzten Hochwasser war der Mühlgraben nur noch eine Schmutzlache.
Über die letzten Jahre hinweg wurde der Mühlgraben zunehmend von Passanten auf der Tiroler Straße zugemüllt. Unerlaubt wurde von der Straße aus immer wieder Unrat hinunter in den Graben geworfen, was zur Folge hatte, dass sich Ratten und Mäuse ansiedelten. Diese waren bereits Gegenstand von Beschwerden der Nutzer und Mieter des Magnus Parks. Weiterhin sind hochwertige potenzielle Mieter (z. B. eine Dialysepraxis) aufgrund des Rattenbefall abgesprungen.
Aus Sicht des Denkmalschutzes kommt dem Mühlgraben durchaus eine denkmalfachliche Bedeutung zu. Das Landratsamt hat vor diesem Hintergrund eine Wiederöffnung des Mühlgrabens angeordnet. Der Vollzug dieser Rückbauanordnung ist im Einvernehmen mit dem LRA und dem BLfD seiner Zeit ausgesetzt worden, um eine ganzheitliche städtebauliche Neubewertung der Situation anhand eines Gesamtkonzeptes, welches auch konkret auf die denkmalfachlichen Aspekte eingeht, zu ermöglichen. Auf Grundlage dieses Konzeptes und einer entsprechend Stellungnahme des BLfD, wird seitens des LRA eine Neubeurteilung der Situation mit dem verfüllten Mühlbach und der angestrebten Planung erfolgen.
Der städtebauliche Masterplan sowie der daraus entwickelte Bebauungsplan haben gemeinsam das Hauptziel, die bestehende historische Bebauung zu sichern und als solche wieder erlebbar zu machen. Als Ergänzung zum Bestand soll zudem der „Südbau“ in seiner Zeilenstruktur bis auf die Höhe des Lechbaus verlängert werden, wodurch die neue Platzgestaltung beim Eingang des Magnus Parks städtebaulich hervorgehoben wird. Eine strenge Grünordnung betont zudem die Zeilenbebauung. Die notwendigen und öffentlichen Stellplätze sollten nach bisheriger Planung in einem zentralen Mobilitätshub untergebracht werden, sodass das historische Ensemble durch den ruhenden Verkehr nicht beeinträchtigt wird und ein weitestgehend autofreies Quartier mit hochwertiger Freianlagen entstehen kann.
Die Stadt Füssen erkennt das denkmalfachliche Bestreben, den Mühlgraben wieder zu öffnen, durchaus an, stellt diesen Belang in der Gesamtabwägung mit dem primären Ziel einer Revitalisierung der Industriebrache und Neugestaltung der Freiflächen (Entsiegelung, möglichst autofreies Quartier) jedoch zurück. Die Neuordnung des ruhenden Verkehrs und der Bau einer Parkgarage zur flächensparenden Bündelung der notwenigen Stellplätze setzten die vom Stadtrat beschlossenen Sanierungsziele konsequent um (s. vorbereitende Untersuchungen F64 Kap. 10.4 und 11.2).
Der angestrebte attraktive urbane Nutzungsmix (Gewerbe, Handwerk, Dienstleitungen, Gastronomie, Indoor-Freizeit Nutzungen, Bildung, ergänzendes Wohnen) benötig selbst dann eine erhebliche Erhöhung des Stellplatzbedarfs im Magnus Park, wenn von der Stellplatzsatzung der Stadt Füssen abweichende Stellplatzzahlen festgesetzt werden.
Die Anzahl der notwendigen Stellplätze wären selbst um den Preis einer noch weitergehenden Flächenversieglung gegenüber dem Bestand nicht abbildbar. Eine Verteilung der notwendigen Stellplätze im gesamten Quartier stünde zudem im diametralen Widerspruch zu den oben genannten städtebaulichen Zielen einer Aufwertung und Attraktivierung der Freiraumgestaltung und Erlebbarkeit des Industriedenkmals.
Die Konsequenz aus den oben genannten städtebaulichen Zielen ist die Bündelung der Stellplätze in einem Mobilitätshub. Für diesen wurden unter Berücksichtigung der oben angeführten städtebaulichen, landschaftlichen und denkmalschutzfachlichen Leitziele verschiedene Standortvarianten untersucht.
Bei dieser Alternativenprüfung wurden folgende Kriterien beachtet:
- denkmalgeschützte Gebäude mit vorgegebenem Raster und beschränkter Statik
- Sicherung von bestehendem Gewerbe (Faserzentrum als Ankermieter des Magnus Parks)
- Einbindung in das historische Ensemble und Landschaft
- hohe Grundwasserstände und schwierige Bodenbeschaffenheit.
Eine Integration des Mobilitätshubs in die historischen Gebäude scheidet aus mehreren Gründen aus. Die historische Bausubstanz weist keine hinreichende Tragkraft auf. Eine statische Ertüchtigung lässt sich weder wirtschaftlich noch denkmalschutzrechtlich darstellen. Darüber hinaus lässt die baukonstruktive Rasterung keine effiziente Parkraumverteilung zu. Die erforderlichen Erschließungsanlagen würden grob verunstaltend wirken und dem Leitziel eines autofreien Quartiers widersprechen.
Konsequenz hieraus ist, dass nur der Neubau eines Mobilitätshubs diesen städtebaulichen Zielen Rechnung tragen kann. Für den Neubau wurden verschiedene Varianten geprüft.
Eine Verortung an der Stelle der südlichen Gewerbehalle scheidet aus. Das ehem. Faserzentrum ist Ende der 1980er Jahre aus Mitteln der Wirtschaftsförderung von Bund und Länder unter Einsatz des damaligen bayrischen Ministerpräsidenten gefördert worden und war Bestandteil einer Kooperation des Freistaats Bayern mit dem Land Baden-Württemberg. Das Faserzentrum sollte in Kooperation mit dem wissenschaftlichen Transferzentrum für nachwachsende Faserrohstoffe in Reutlingen Prozesse der Aufbereitung, der Spinnerei, des Webens, des Färbens und der Ausstattung untersuchen sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit praktischem Bezug für die industrielle Weiterverarbeitung der Flachsfaser im textilen und nichttextilen Bereich leisten (siehe etwa LT-Drs. Baden-Württemberg 10/2488, S. 7). Das Faserzentrum ist damit – wie der Magnus-Park insgesamt – ein Zeugnis bayrischer und baden-württembergischer Industriepolitik und des Niedergangs der deutschen Textilindustrie. Zugleich ist das ehem. Faserzentrum auch heute noch mit dem wichtigsten Ankermieter (Erhart GmbH, Werkzeug- und Gerätebau) des Magnus Park belegt. Eine nachhaltige und wirtschaftlich darstellbare Entwicklung des Quartiers kann nur mit Rücksicht auf die bestehenden Mieter gelingen. Ein Bestandschutz der bestehenden Mieter ist für den Stadtrat neben der Revitalisierung des Gesamtquartiers vorrangiges Planungsziel.
Eine Überbauung der Halle wurde vom Eigentümer geprüft, ist aber aus bautechnischen und statischen Gründen nicht wirtschaftlich darstellbar und wäre auch denkmalfachlich nicht adäquat. Die Anregung, den Mobilitätshub weitestgehend als Verlängerung an die südliche Gewerbehalle zu rücken, nähme der Gewerbehalle ihre zentrale Zufahrt sowie Aufstell- und Wendeflächen, die auch weiterhin jedenfalls für LKW von 7,5 bis jedenfalls 20 t gewährleistet bleiben müssen. Die vorgeschlagene Verortung würden zwar denkmalfachliche Belange noch weiter stärken, zugleich jedoch die Existenz bestandsgeschützter gewerblicher Nutzungen und einen Gewerbebetrieb mit über 50 Arbeitsplätzen, der aktuell Investitionen in Millionenhöhe tätigt, gefährden. Sie scheidet vor diesem Hintergrund aus.
Ergebnis dieser städtebaulichen Ziele und Variantenuntersuchung ist, dass eine Neuerrichtung eines Mobilitätshubs nur an der geplanten Stelle städtebaulich sinnvoll ist und den denkmalschutzfachlichen Ansprüchen des Industrieareals Rechnung trägt.
Das BLfD hat selbst im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens signalisiert, dass die Wiederöffnung des Mühlgrabens kein denkmalschutzfachliches Dogma ist und einer hochwertigen städtebaulichen Entwicklung des Quartiers nicht im Weg stehen soll. Vorrangiges Ziel der Bauleitplanung sowie der Stadtsanierung ist es, die derzeitige historische Bebauung wieder erlebbar zu machen. Weiterhin wolle man die südliche Zeile bis Höhe des Lechbaus verlängern, um die Platzgestaltung beim Eingang des Magnus Parks städtebaulich hervorzuheben. Eine strenge Grünordnung betone zudem die Zeilenbebauung. Die notwendigen und öffentlichen Stellplätze sollten nach bisheriger Planung in einem zentralen Mobilitätshub untergebracht werden, sodass das historische Ensemble durch den ruhenden Verkehr nicht beeinträchtigt wird. Von der Vertreterin und dem Vertreter des Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege wurde zudem betont, dass der Mühlbachgraben nicht im Vordergrund stehe, wenn die städtebauliche Zeilenstruktur als Mehrwert gewonnen werde.
Ergebnis der Vorabstimmung war, dass für die Verfüllung des Mühlgrabens kompensatorische Maßnahmen denkbar sind.
|
|
3. Der BUND fordert die verbindliche Ausweisung von geeigneten Flächen für die im Baufortschritt notwendigen Material- und Maschinenablagerungen.
|
Das Gewerbe- und Industriegebiet ist aktuell weitestgehend durch bauliche Anlagen oder Erschließungsflächen versiegelt. Durch den Rückbau der Zwischenbauten und der festgesetzten Grünordnung werden die derzeitigen und neuen Freiflächen entsprechend aufgewertet. Die Stadt Füssen sieht daher keine Notwendigkeit einer Ausweisung von Lagerflächen während der Bauphase. Diese können auf den aktuell vorhandenen versiegelten Flächen erfolgen. Konkrete Lagerflächen können im Vollzug durch Auflagen in der Baugenehmigung geregelt werden.
|
|
4. Der BUND verlangt, den Naturraum des Uferbereichs am Lech in seiner Diversität wiederherzustellen und zu ertüchtigen.
|
Die Stadt Füssen weist darauf hin, dass der Naturraum des Uferbereichs am Lech nicht Gegenstand der Planung ist. Die bestehenden Gehölzstrukturen liegen hinter der Lechmauer (Hochwasserschutz) und werden durch die geplante Revitalisierung der Gebäude nicht beeinträchtigt.
|
|
5. Der BUND schlägt vor, Aspekte moderner ökologischer und naturverträglicher Bauplanung aufzugreifen, wie etwa die Schaffung von Nistplätzen für Vögel, von naturbelassenen Bereichen für Amphibien oder Igel, etc.
|
Der Bebauungsplan setzt bereits unter § 8 Grünordnung das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie die Herstellung von natürlicher Vegetationsflächen / extensiver Wiesenflächen fest. Zudem befindet sich im Nordwesten der Naturraum und Uferbereich des Lechs sowie im Süden der mit Gehölzen bewachsene Hang. Diese bieten bereits für Vögel und Amphibien einen attraktiven Lebensraum.
An den denkmalgeschützten Gebäuden besteht ein Zielkonflikt zwischen den Belangen des Denkmalschutzes und des Artenschutzes. Für nicht denkmalgeschützte Fassaden werden ergänzende naturschutzfachliche und artenschutzfachliche Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen insbesondere vertraglich geregelt.
Der Stellungnahme wird insoweit Rechnung getragen.
|
|
Der BUND behält sich vor, die Ergebnisse der saP abzuwarten und auf deren Basis eine endgültige Stellungnahme abzugeben.
|
Die Stadt Füssen verweist auf die fachliche Würdigung und Abwägung zu Punkt 1 der Stellungnahme.
|
|
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplanvorentwurfs. Es werden im städtebaulichen Vertrag Regelungen zur Durchführung einer saP und naturschutzfachlichen und artenschutzfachlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen getroffen.
|
|
|
- Kreisfischereiverein Füssen e.V. vom 11.12.2023
|
Stellungnahme
|
Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Analyse
|
|
|
Das ehemalige Hanfwerkeareal war geprägt von zwei durchgängigen Triebwasserkanälen mit fließendem Wasser und Anbindungen an den Lech und stellte ein wertvolles Rückzugsgebiet für Flora und Fauna dar - eingetragen als Baudenkmal „Wassertriebanlage D-7-77-129-216“. Dieses wurde widerrechtlich zerstört und stillgelegt.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme mit entsprechenden Anlagen. Die Ausführungen zur Analyse wie auch die Anlagen dienen der Kenntnisnahme.
Es wird klargestellt, dass der Denkmaleintrag aus denkmalfachlichen Gründen und nicht im Hinblick auf deren Bedeutung für Flora und Fauna erfolgt. Die Träger öffentlicher Belange werden im Übrigen gebeten, sich auf ihre Belange zu konzentrieren.
|
|
Der Kreisfischereiverein Füssen e.V. hatte in der Vergangenheit stets auf den notwendigen Erhalt dieser Wasserbauwerke in voller Durchgängigkeit hingewiesen. Siehe hierzu auch Anlagen Anschreiben an das LRA OAL aus 2016 (1) und 2017 (2) sowie an die Stadt Füssen aus 2021 (3a+3b). Ebenso liegt eine Rückbauanordnung für den Mühlbachkanal über die gesamte Länge des LRA OAL aus Dezember 2016 vor. Diese Anordnung ist verbunden mit einer gesetzlichen Vollzugsverpflichtung. Die Frist für einen Rückbau wurde auf Ende Juli 2017 gesetzt – dieser kam der Eigentümer nicht nach.
|
Der Mühlbach wurde im Zuge der Errichtung des ehem. Faserzentrums Ende der 1980er bis Anfang der 1990er Jahre (heute Erhart GmbH Werkzeug- und Gerätebau) bereits verfüllt und endgültig stillgelegt. Somit ist bereits seit über 30 Jahren kein Fließgewässer mehr vorhanden. Dass der Triebwasserkanal als Fließgewässer widerrechtlich zerstört und stillgelegt worden ist, ist objektiv unzutreffend. Der bereits seit über 30 Jahren stillgelegte Mühlgraben war vor seiner Verfüllung lediglich im Falle eines Hochwassers noch geflutet. Seit dem letzten Hochwasser war der Mühlgraben nur noch eine Schmutzlache.
Über die letzten Jahre hinweg wurde der Mühlgraben zunehmend von Passanten auf der Tiroler Straße zugemüllt. Unerlaubt wurde von der Straße aus immer wieder Unrat hinunter in den Graben geworfen, was zur Folge hatte, dass sich Ratten und Mäuse ansiedelten. Diese waren bereits Gegenstand von Beschwerden der Nutzer und Mieter des Magnus Parks. Weiterhin sind hochwertige potenzielle Mieter (z. B. eine Dialysepraxis) aufgrund des Rattenbefall abgesprungen.
Aus Sicht des Denkmalschutzes kommt dem Mühlgraben durchaus eine denkmalfachliche Bedeutung zu. Das Landratsamt hat vor diesem Hintergrund eine Wiederöffnung des Mühlgrabens angeordnet. Der Vollzug dieser Rückbauanordnung ist im Einvernehmen mit dem LRA und dem BLfD seiner Zeit ausgesetzt worden, um eine ganzheitliche städtebauliche Neubewertung der Situation anhand eines Gesamtkonzeptes, welches auch konkret auf die denkmalfachlichen Aspekte eingeht, zu ermöglichen. Auf Grundlage dieses Konzeptes und einer entsprechend Stellungnahme des BLfD, wird seitens des LRA eine Neubeurteilung der Situation mit dem verfüllten Mühlbach und der angestrebten Planung erfolgen.
|
|
Nicht annehmbar ist daher die geplante Überbauung des Mühlbachs mit einem Parkhaus und eine Reduzierung des Mühlbachs bis unter die Brücke am Lecheinlauf mit einer verbleibenden Länge von geschätzt nur 20 m als reine Einbuchtung mit stehendem Wasser. Bei der geplanten Stilllegung des Mühlbachs wird in keiner Weise die Verpflichtung erfüllt, verlorengegangene und ehemals freiliegende Retentionsräume auszubilden.
|
Die Revitalisierung der Brachfläche hat zur Folge, dass zusätzlicher Stellplatzbedarf anfällt. Aufgrund der unter Denkmalschutz stehenden historischen Bauzeilenstruktur, der denkmalschutzwürdigen Blickbeziehungen und der vorhandenen Gewerbebetriebe, gibt es keinen Alternativstandort für den benötigten Mobilitätshub.
Der städtebauliche Masterplan sowie der daraus entwickelte Bebauungsplan haben gemeinsam das Hauptziel, die bestehende historische Bebauung zu sichern und als solche wieder erlebbar zu machen. Als Ergänzung zum Bestand soll zudem der „Südbau“ in seiner Zeilenstruktur bis auf die Höhe des Lechbaus verlängert werden, wodurch die neue Platzgestaltung beim Eingang des Magnus Parks städtebaulich hervorgehoben wird. Eine strenge Grünordnung betont zudem die Zeilenbebauung. Die notwendigen und öffentlichen Stellplätze sollten nach bisheriger Planung in einem zentralen Mobilitätshub untergebracht werden, sodass das historische Ensemble durch den ruhenden Verkehr nicht beeinträchtigt wird und ein weitestgehend autofreies Quartier mit hochwertiger Freianlagen entstehen kann.
Der angestrebte attraktive urbane Nutzungsmix (Gewerbe, Handwerk, Dienstleitungen, Gastronomie, Indoor-Freizeit Nutzungen, Bildung, ergänzendes Wohnen) benötigt selbst dann eine erhebliche Erhöhung des Stellplatzbedarfs im Magnus Park, wenn von der Stellplatzsatzung der Stadt Füssen abweichende Stellplatzzahlen festgesetzt werden.
Die Anzahl der notwendigen Stellplätze wären selbst um den Preis einer noch weitergehenden Flächenversieglung gegenüber dem Bestand nicht abbildbar. Eine Verteilung der notwendigen Stellplätze im gesamten Quartier stünde zudem im diametralen Widerspruch zu den oben genannten städtebaulichen Zielen einer Aufwertung und Attraktivierung der Freiraumgestaltung und Erlebbarkeit des Industriedenkmals.
Die Konsequenz aus den oben genannten städtebaulichen Zielen ist die Bündelung der Stellplätze in einem Mobilitätshub. Für diesen wurden unter Berücksichtigung der oben angeführten städtebaulichen, landschaftlichen und denkmalschutzfachlichen Leitziele verschiedene Standortvarianten untersucht.
Bei dieser Alternativenprüfung wurden folgende Kriterien beachtet:
denkmalgeschützte Gebäude mit vorgegebenem Raster und beschränkter Statik
Sicherung von bestehendem Gewerbe (Faserzentrum als Ankermieter des Magnus Parks)
Einbindung in das historische Ensemble und Landschaft
hohe Grundwasserstände und schwierige Bodenbeschaffenheit.
Eine Integration des Mobilitätshubs in die historischen Gebäude scheidet aus mehreren Gründen aus. Die historische Bausubstanz weist keine hinreichende Tragkraft auf. Eine statische Ertüchtigung lässt sich weder wirtschaftlich noch denkmalschutzrechtlich darstellen. Darüber hinaus lässt die baukonstruktive Rasterung keine effiziente Parkraumverteilung zu. Die erforderlichen Erschließungsanlagen würden grob verunstaltend wirken und dem Leitziel eines autofreien Quartiers widersprechen.
Konsequenz hieraus ist, dass nur der Neubau eines Mobilitätshubs diesen städtebaulichen Zielen Rechnung tragen kann. Für den Neubau wurden verschiedene Varianten geprüft.
Eine Verortung an der Stelle der südlichen Gewerbehalle scheidet aus. Das ehem. Faserzentrum ist Ende der 1980er Jahre aus Mitteln der Wirtschaftsförderung von Bund und Länder unter Einsatz des damaligen bayrischen Ministerpräsidenten gefördert worden und war Bestandteil einer Kooperation des Freistaats Bayern mit dem Land Baden-Württemberg. Das Faserzentrum sollte in Kooperation mit dem wissenschaftlichen Transferzentrum für nachwachsende Faserrohstoffe in Reutlingen Prozesse der Aufbereitung, der Spinnerei, des Webens, des Färbens und der Ausstattung untersuchen sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit praktischem Bezug für die industrielle Weiterverarbeitung der Flachsfaser im textilen und nichttextilen Bereich leisten (siehe etwa LT-Drs. Baden-Württemberg 10/2488, S. 7). Das Faserzentrum ist damit – wie der Magnus-Park insgesamt – ein Zeugnis bayrischer und baden-württembergischer Industriepolitik und des Niedergangs der deutschen Textilindustrie. Zugleich ist das ehem. Faserzentrum auch heute noch mit dem wichtigsten Ankermieter (Erhart GmbH, Werkzeug- und Gerätebau) des Magnus Park belegt. Eine nachhaltige und wirtschaftlich darstellbare Entwicklung des Quartiers kann nur mit Rücksicht auf die bestehenden Mieter gelingen. Ein Bestandschutz der bestehenden Mieter ist für den Stadtrat neben der Revitalisierung des Gesamtquartiers vorrangiges Planungsziel.
Eine Überbauung der Halle wurde vom Eigentümer geprüft, ist aber aus bautechnischen und statischen Gründen nicht wirtschaftlich darstellbar und wäre auch denkmalfachlich nicht adäquat. Die Anregung, den Mobilitätshub weitestgehend als Verlängerung an die südliche Gewerbehalle zu rücken, nähme der Gewerbehalle ihre zentrale Zufahrt sowie Aufstell- und Wendeflächen, die auch weiterhin jedenfalls für LKW von 7,5 bis jedenfalls 20 t gewährleistet bleiben müssen. Die vorgeschlagene Verortung würden zwar denkmalfachliche Belange noch weiter stärken, zugleich jedoch die Existenz bestandsgeschützter gewerblicher Nutzungen und einen Gewerbebetrieb mit über 50 Arbeitsplätzen, der aktuell Investitionen in Millionenhöhe tätigt, gefährden. Sie scheidet vor diesem Hintergrund aus.
Ergebnis dieser städtebaulichen Ziele und Variantenuntersuchung ist, dass eine Neuerrichtung eines Mobilitätshubs nur an der geplanten Stelle städtebaulich sinnvoll ist und den denkmalschutzfachlichen Ansprüchen des Industrieareals Rechnung trägt.
Das BLfD hat selbst im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens signalisiert, dass die Wiederöffnung des Mühlgrabens kein denkmalschutzfachliches Dogma ist und einer hochwertigen städtebaulichen Entwicklung des Quartiers nicht im Weg stehen soll. Vorrangiges Ziel der Bauleitplanung sowie der Stadtsanierung ist es, die derzeitige historische Bebauung wieder erlebbar zu machen. Weiterhin wolle man die südliche Zeile bis Höhe des Lechbaus verlängern, um die Platzgestaltung beim Eingang des Magnus Parks städtebaulich hervorzuheben. Eine strenge Grünordnung betone zudem die Zeilenbebauung. Die notwendigen und öffentlichen Stellplätze sollten nach bisheriger Planung in einem zentralen Mobilitätshub untergebracht werden, sodass das historische Ensemble durch den ruhenden Verkehr nicht beeinträchtigt wird. Von der Vertreterin und dem Vertreter des Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege wurde zudem betont, dass der Mühlbachgraben nicht im Vordergrund stehe, wenn die städtebauliche Zeilenstruktur als Mehrwert gewonnen werde.
Der ehemalige Mühlbach wurde bereits vor nahezu 30 Jahren nach Eröffnung der neuen Wasserkraftanlage und mit Errichtung des ehem. Faserzentrums stillgelegt. Die Stellungnahme verkennt, dass auch mit einer Wiederöffnung des Mühlgrabens kein Fließgewässer entstehen würde. Der Mühlgraben wäre – wie in den Jahren vor seiner Verfüllung – kein Habitat von Fischen, sondern von Ratten und Ungeziefer.
Eine direkte Ost-West Verbindung (Fließgewässer) gab es in den vergangenen 30 Jahren nicht und wird es auch in Zukunft nicht mehr geben. Es bestand lediglich ein Unterwasserkanal, welcher auf Höhe der südlich bestehenden Gewerbehalle endete. Teilbereiche zwischen der Gewerbehalle und der östlichen Brücke wurden verfüllt.
Einen wirkungsgleichen Retentionsraumausgleich ist mit dem Wasserwirtschaftsamt dem Grunde nach abgestimmt und wird im städtebaulichen Vertrag geregelt.
|
|
Die Planung ergreift somit keine Maßnahmen, fließende Wasserflächen mit Anbindungen an den Lech wieder herzustellen bzw. auszugleichen. Diese müssen aber zwingend erfolgen, da sie einen elementaren Lebensraum für heimischen Salmoniden darstellen. Der Kreisfischereiverein Füssen e.V. ging fest davon aus, dass bei einer vorgesehenen Stilllegung der Triebwasserkanäle adäquate Ausgleichsmaßnahmen im Bebauungsplan enthalten sind. Dies ist nicht der Fall und kann somit in keiner Form akzeptiert werden.
|
Ziel der Bauleitplanung ist keine Schaffung fließender Wasserflächen in einem seit Jahrzehnten bestehenden Gewerbegebiet, das unmittelbar an den Lech als Gewässer 1. Ordnung angrenzt.
Wie bereits vorausgehend erläutert, ist bereits seit nahezu 30 Jahren im Mühlgraben keine fließende Wasserfläche mehr vorhanden. Die Stilllegung ist und war nie Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung. Ziel ist es, die denkmalgeschützte Industriebrache vor dem Verfall zu schützen und zu revitalisieren.
|
|
In der Vergangenheit erfolgten bereits widerrechtliche Baumfällungen entlang des Lechufers, die mit einem Bußgeld gegen den Eigentümer belegt wurden. In der vorliegenden Planung sollen nun weitere Baumgruppen entlang des Lechufers entfernt werden – Vergleich Bayernatlas und Planung – um Außenbewirtschaftungsflächen entlang des Lechufers zu schaffen. Eine Ausdehnung des Gastrobetriebs in das Uferbegleitgrün mit Auswirkungen auf das Lechbett wird abgelehnt. Im Gegenteil: Die Uferbereiche sind vor Beeinträchtigungen durch das geplante Areal zu schützen.
|
Die Stadt Füssen weist darauf hin, dass im Zuge der Bauleitplanung keine Baumgruppen entlang des Lechufers entfernt werden. Betrachtet man sich das aktuelle Luftbild aus dem BayernAltas und die vorliegende Planung ist eindeutig zu erkennen, dass die Fläche für die Außengastronomie sich südwestlich der bestehenden Feuerwehrsaugstelle befindet und nicht über die bestehende Lechmauer (Hochwasserschutz) hinausragt. Die bestehenden Gehölzstrukturen entlang des Lechs hinter der Lechmauer im Bereich der Uferböschung werden durch die Bauleitplanung nicht berührt. Ein Eingriff in den Uferbereich findet somit nicht statt.
|
|
Laut Flächenstatistik B-Plan ergeben sich folgende Werte: ca. 1.302 m² Wasserfläche = 2,1 %. Der ausgewiesene Anteil an Wasserflächen ist in keiner Form nachvollziehbar und entspricht nicht den ehemals vorliegenden, freien und oberflächennahen Wasserflächen des Hanfwerkeareals.
|
Der Bebauungsplan setzt planzeichnerisch im westlichen Teil des Geltungsbereiches, nördlich und westlich des Wasserkraftwerks, Wasserflächen fest. Diese sind in der Planzeichenlegende unter Nr. 5 Wasserflächen als Fließgewässer „Lech“ definiert. Zusätzlich wird in der Begründung unter Nr. 8.15 diese Fläche beschrieben. Tatsächlich hat sich in der Begründung ein Fehler in der Lagebeschreibung eingeschlichen. Die planzeichnerisch festgesetzte Fläche befindet sich nicht wie beschrieben im östlichen, sondern im westlichen Geltungsbereich. Dies wird redaktionell angepasst.
|
|
Wir sehen in der vorliegenden Planung deshalb einen klaren Widerspruch und Verstoß gegen die Schutzgüter Wasser, Boden + Fläche, Landschaft und Kultur. Die vorliegende Planung wird daher abgelehnt und muss insbesondere bezüglich Wasserflächen + Durchgängigkeit überarbeitet werden.
|
Der Magnus-Park stellt aktuell ein Gewerbegebiet dar. Die Stellungnahme verkennt grundlegend, dass es vorliegend um die Wiedernutzbarmachung und Revitalisierung einer weitgehend versiegelten, bestehenden Gewerbe- und Industriebrache geht. Ein Eingriff in die genannten Schutzgüter ist vor über 100 Jahren erfolgt. Der Mühlgraben als Triebwerkskanal Fließgewässer ist bereits vor über 30 Jahren mit der Errichtung des ehem. Faserzentrums – einem Förder- und Kooperationsprojekt von Bund, Freistaat Bayern und Land Baden-Württemberg – stillgelegt worden.
Gem. § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. […] dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können. Der Bebauungsplan trägt diesem Ziel vorbildlich Rechnung.
Die Planung trägt zu einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung bei, sichert und erhält die bestehenden und schafft neue attraktive Arbeitsplätze sowie Wohnraum. Sie unterstützt die Stadt der kurzen Wege. Ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden ist gewährleistet. Zudem wird durch die Revitalisierung der historische Industriecharakter erhalten und für zukünftige Generationen wieder erlebbar gemacht. Graue Energie wird genutzt, CO2 Emissionen reduziert. Die Flächen auf dem Areal werden unter anderem an Vereine, die Kulturinitiative Füssen e.V., Füssen Tourismus und die Stadt selbst, teilweise unentgeltlich überlassen oder vermietet. Dies leistet einen wesentlichen Beitrag für die kulturelle Entwicklung Füssens.
Ein Widerspruch zwischen Wasser, Boden und Fläche sowie Landschaft und Kultur ist nicht erkennbar. Die vorgenannten Belange überwiegen die geltend gemachten Belange des Kreisfischereivereins.
|
|
Forderungen
|
|
|
1) Schutz des Baudenkmals „Wassertriebanlage D-7-77-129-216“. Rückbau und Freilegung des Mühlbachs laut Forderung LRA OAL als als Rückzugsgebiet für Fische bei Hochwasser sowie als Laichgebiet und Jungfischhabitat. Sollte hierfür keine Lösung gefunden werden, müssen die oben beschriebenen, fließenden und oberflächennahen Wasserflächen in adäquater Form bezüglich Quantität und Qualität an anderen Stellen ausgeglichen werden. Hierbei sind die erforderlichen Behörden und Fachstellen im Vorfeld zu beteiligen.
|
Das Baudenkmal mit der Aktennummer D-7-77-129-216 wird in Abstimmung mit dem Bayrischen Landesamt für Denkmalpflege historisch aufgearbeitet und an entsprechender Stelle historisch gewürdigt. Im städtebaulichen Masterplan, welcher die Grundlage des Bebauungsplans darstellt, wurden hierzu zwei Standorte zur historischen Würdigung „Lecheinbuchtung unter der Brücke“ und „Rückgebäude Kesselhaus“ dargestellt. Auch die vorbereitenden Untersuchungen von F64 Architekten (Kap. 10.3, S. 59) definiert als freiraumplanerisches Ziel lediglich die Sichtbarmachung der Historischen Verläufe von Mühl- und Fabrikkanal unter Abwägung von geeigneten Gestaltungsmöglichkeiten. Der Bebauungsplan verortet die Erinnerungskultur an den Mühlkanal westlich des Kesselhauses. Im Städtebaulichen Vertrag wird abgesichert, dass der Mühlkanal an dieser Stelle erhalten bleibt und sensibel in den Landschafts- und Erlebnisraum (z. B. Biergarten) integriert wird. An dieser Variante der historischen Würdigung hält die Stadt weiterhin fest und plant diese umzusetzen.
Eine Öffnung des Mühlgrabens steht zudem im Konflikt mit dem Mobilitätshub-Standort. Ein alternativer Standort für den Mobilitätshub ist nicht ohne Eingriffe in die Baudenkmäler oder das bestehende und zu haltende Gewerbe möglich. Ohne das Mobilitätshub wird auch keine Revitalisierung der Industriebrache möglich sein.
Die Stellungnahme verkennt, dass auch im Falle einer Wiederöffnung des Mühlbachgrabens kein Fließgewässer, sondern ein trockener Graben, ohne besondere naturschutzfachliche Qualität entstünde. Der Mühlgraben ist seit über 30 Jahren kein Fließgewässer, kein Rückzugsgebiet und kein Laichgebiet für Fische.
|
|
2) Die bereits eingeschränkte Umlagerungsstrecke des Lechs entlang des Hanfwerkeareals ist in ihren Abmessungen zwingend zu erhalten bzw. nach Möglichkeit weiter auszubauen. Sie dient als Retentionsraum und stellt ein zu schützendes Laichgebiet für Kieslaicher dar.
|
Es existiert seit jedenfalls 30 Jahren keine Umlagerungsstrecke des Lechs auf dem Gelände des Magnus Park, die erhalten werden könnte. Der Verlauf des Lechs, sowie der nordwestliche Naturraum des Uferbereichs am Lech ist nicht Gegenstand der Planung. Die bestehende Böschung mit Gehölzstruktur liegen hinter der Lechmauer (Hochwasserschutz) und wird durch die geplante Revitalisierung des Grundstücks nicht beeinträchtigt. Die Stellungnahme geht von falschen Tatsachen aus.
Der Retentionsraum wird im Zuge der Bauleitplanung durch einem mit dem WWA abgestimmtes Konzept wiederhergestellt.
|
|
3) Die geplante Ufergestaltung und -Nutzung entlang des Lechs darf keine negativen Auswirkungen auf die Kiesbänke und Umlagerungsstrecke haben. Ebenso darf diese nicht zum Bevölkern und Mißbrauch dieser Bereiche einladen.
|
Die geplanten und festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen entlang des Lechs liegen vor der Lechmauer (Hochwasserschutz) und werden zukünftig einen Puffer und Übergang zwischen dem Urbanen Gebiet und dem Gewässer darstellen. Der außerhalb der Mauer liegende Naturraum des Uferbereichs ist nicht Gegenstand der Planung. Die bestehende Böschung mit Gehölzstruktur wird durch die geplante Revitalisierung des Grundstücks nicht beeinträchtigt.
Ein Missbrauch des Lechufers durch Dritte ist mit ordnungsrechtlichen Maßnahme zu ahnden; dieser ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Auf das verfassungsrechtlich geschützte Recht der Allgemeinheit auf freien Zugang zu Natur und Landschaft einschließlich der Flüsse (Art. 141 Abs. 3 BV) wird hingewiesen.
|
|
4) Nebenanlagen, Terrassen und Freischankflächen (von über 2.000 m²!) dürfen nicht direkt an den Lech gebaut werden, der natürliche Lechlauf ist zu schützen – nachfolgende Festsetzungen sind zu überarbeiten und dahingehend zu konkretisieren:
A Textliche Festsetzung
§ 3 Bauweise, Grenzabstände (2) Überbaubare Grundstücksfläche
3. Sonstige Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nur zulässig, wenn diese eine Grundfläche von 30 m² und eine Höhe von 3,0 m unterschreiten.
4. Terrassen, insb. für Aufenthalts- und Außenbewirtschaftungsflächen, gem. § 14 BauNVO sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen bis max. 2.255 m² zulässig.
|
Innerhalb der planzeichnerisch festgesetzten grünordnerischen Freifläche 2 (Entlang des Lechverlaufs) sind entsprechend der textlichen Festsetzungen die grünordnerischen Maßnahmen (extensive Wiesenflächen, Bäume und Sträucher) umzusetzen. Wie bereits vorausgehen mehrfach erwähnt, beschränken sich die Maßnahmen auf die Flächen innerhalb der Umgrenzungsmauer (Hochwasserschutz). Lediglich in einem Teilbereich nordöstlich des Lechbaus können bis zu dieser Mauer Nebenanlagen, Terrassen und Freischankflächen errichtet werden. Betrachtet man das Luftbild, ist hier bereits die Fläche vollends versiegelt / verdichtet. Weiter östlich hingegen, werden Stellplatzflächen direkt an der Mauer zurückgebaut und in dem zukünftigen Mobilitätshub untergebracht. Der Puffer zur Uferböschung und Lech wird an dieser wie auch im westlichen Teilbereich vergrößert.
Im Übrigen können die wasserwirtschaftlichen Belange im Rahmen der Einzelgenehmigungsverfahren (z.B. Genehmigungspflicht von Anlagen an Gewässern) berücksichtigt werden.
Die Stadt Füssen sieht daher keinen Anlass die textlichen Festzungen unter § 3 Abs. 2 Nr. 3 und 4 zu ändern.
|
|
5) Belastetes Wasser darf nicht in den Lech gelangen.
|
Die Stadt Füssen weist darauf hin, dass im Bayerischem Wassergesetz (BayWG) eine Einleitung in oberirdische Gewässer erlaubnisfrei möglich ist. Die "Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer (TRENOG)" sind entsprechend einzuhalten. Ein entsprechender Hinweis wird in die textlichen Hinweise und nachrichtlichen Übernahmen aufgenommen. Soweit die TRENOG nicht eingehalten werden, ist ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren durchzuführen.
|
|
6) Schnittgut darf nicht in die Uferzonen und in den Lech entsorgt werden.
|
Das Entsorgen von Schnittgut ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung.
|
|
7) Grundwasser, das mit dem Lech in Verbindung steht, darf nicht beeinträchtigt werden.
|
Nach derzeitigem Kenntnisstand wird in das Grundwasser nicht eingriffen. Andernfalls ist ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren erforderlich, in dem die wasserwirtschaftlichen Belange einzustellen wären.
|
|
8) Zugänge zum Lech für den Pächter des Fischereirechts – aktuell Kreisfischereiverein Füssen e.V. – für Bewirtschaftung, Besatz und Fischerei müssen gewährleistet und planerisch berücksichtigt sein.
|
Die Festsetzungen des Bebauungsplans treffen keine Regelungen, die den Zugang zum Lech ausschließen.
|
|
Erneute Anregung zur Überarbeitung der Planung – wie in 2021
|
|
|
Die einmalige Chance, das Thema „fließendes Wasser“ wieder erlebbar zu machen und den verlorenen Lechauen wieder ein Stück Natur zurückzugeben, muss bei den weiteren Planungen innerhalb des Areals verfolgt werden. Diese Wasserläufe lagen in der Vergangenheit vor und müssen wieder aktiviert werden. Als hervorragendes Beispiel hierzu kann das Fischerviertel in Ulm entlang der Donau genannt werden. Die dortigen Bäche werden von Flora und Fauna angenommen und schaffen für Bewohner und Besucher ein attraktives Umfeld und eine einladende Atmosphäre – siehe Anlage 3b.
|
Es wird erneut darauf hingewiesen, dass keine Lechauen, sondern eine Industriebrache überplant wird. Der Mühlbachgraben ist seit über 30 Jahren nicht wasserführend.
|
|
Anlage 1:
|
|
|
Nach unserem konstruktiven Gespräch mit allen Beteiligten zum Kiesabbau der ARGE im Forggensee möchten und müssen wir nun leider zwei aktuelle Themen anschneiden, bei denen wir zum wiederholten Male nicht beteiligt wurden.
Forggensee - Segelclub Osterreinen (OSC) - Wellenschutzdamm
Hierzu müssen wir kurz auf die Historie des Kiesabbaus in diesem Bereich zurückkommen, da dieser bis dato bereits in 3 Abschnitten erfolgte:
2007 für den Bau der Inseln am Badeplatz
2014 für den Bau des Wellenbrechers OSC
2016 für die Ertüchtigung des Wellenbrechers OSC
Bei sämtlichen Verfahren wurde der KFV e.V. als Pächter des Gewässers nicht beteiligt. Das Prekäre an dieser Situation: Der betroffene Bereich um das Cafe Maria stellt ein äußerst wertvolles Gebiet im Forggensee dar. Der Boden ist reich an Mikroorganismen und Fischnährtieren, was sich ab Sommer durch starkes Unterwasserpflanzenwachstum bemerkbar macht. Das Areal dient als Laichgebiet, Jungfischhabitat und Nahrungsgebiet für Wasservögel. Der Forggensee kämpft bekanntlich gegen eine ständige Verarmung der Gewässerstruktur, Gebiete wie in diesem Bereich sind elementar wichtig für die Reproduktion des Sees. Beim diesjährigen Abbau wurden zwar alle Mulden und Fischfallen mustergültig beseitigt, dennoch wurden aber wertvolle Bereich bauaufschlagt und unwiederbringlich zerstört – siehe Fotos laut Anhang. Wir dürfen deshalb anmerken, dass wir weitere Maßnahmen in diesem Bereich – z.B. für eine erneute Ertüchtigung des Wellendamms des OSC – verhindern werden und bitten hierfür um Verständnis.
|
Die Ausführungen aus Anlage 1 dienen der Kenntnisnahme. Teilabschnitte beziehen sich nicht auf das vorliegende Bauleitplanverfahren.
|
|
Lech – Hanfwerke – Verrohrung Mühlbach
Nach unserer Kenntnis besteht das LRA OAL auf einem Rückbau des Mühlbachs. Dieser Forderung schließen wir uns vehement an! Aktuell muss davon ausgegangen werden, dass diese Maßnahme eigenmächtig durch den Eigentümer der Hanfwerke durchgeführt wurde, ohne die erforderliche wasserrechtliche Genehmigung im Vorfeld. Diese wäre sicherlich auch nicht erteilt worden, da der 230 Jahre alte Mühlkanal als naturschutzfachliche Ausgleichsfläche eingetragen ist. Hier gilt es auch zu überprüfen, inwieweit die ursprünglich vorhandene Durchgängigkeit des Gewässers über den alten Stollen – sprich Wasserzulauf von oben – als Auflage für die Aufrechterhaltung des alten Triebwasserkanals vermerkt war. Dieser Zulauf wurde beim Bau des neuen Kraftwerks am Lechfall nämlich ersatzlos still- und der Mühlbach somit teilweise trockengelegt. Auch hier bitten wir – als Pächter des Gewässers – um Information zur Sachlage und zum Verfahrensstand. Der Mühlbach diente seit jeher als Rückzugsgebiet für Fische bei Hochwasser sowie als Laichgebiet und Jungfischhabitat. Ein Verlust dieser Strecke wirkt sich nachteilig auf die Fischbestände aus, wir als Pächter werden wiederum geschädigt. Wir behalten uns deshalb vorsorglich Schadenersatzforderungen vor und werden diese auch rechtlich verfolgen.
|
Der Mühlbachgraben ist vor über 30 Jahren als Triebwerkskanal und Fließgewässer im Rahmen der Errichtung des ehem. Faserzentrum stillgelegt worden und war vor seiner Verfüllung kein Fließgewässer, sondern ein trockengefallener Graben.
Die Rückbauanordnung ist ausschließlich aus denkmalfachlichen Gründen ergangen. Eine Wiederöffnung des Mühlgrabens würde kein Fließgewässer schaffen. Im Übrigen ist die Rückbauanordnung im Einvernehmen mit dem LRA seiner Zeit ausgesetzt worden ist, um die Situation anhand eines städtebaulichen Gesamtkonzeptes, welches auch konkret auf die denkmalfachlichen Aspekte eingeht, ganzheitlich neu beurteilen zu können. Erst auf Grundlage dieses Konzeptes und einer entsprechend Stellungnahme des BLfD, wird seitens des LRA eine Neubeurteilung der Situation mit dem verfüllten Mühlbach und der angestrebten Planung erfolgen.
|
|
Tätigkeiten und Ziele des KFV e.V.
Als Pächter der Gewässer sind wir zur Bewirtschaftung dieser verpflichtet und betreiben dies mit enormem finanziellen Aufwand (Pacht und Besatz) und leidenschaftlichem, ehrenamtliches Engagement. So wurden am Samstag, 23.04.2016 erneut 150 Zandernester im Forggensee gebaut – siehe Fotos. Dies betreiben wir nun schon seit einigen Jahren, um die Gewässerstruktur des Sees zu verbessern und Laichmöglichkeiten zu schaffen, die auf dem zunehmend verschlammten Seegrund nicht mehr anzutreffen sind. Dieser Einsatz wurde durch den Kiessabbau vor dem Cafe Maria nun um ein Vielfaches vernichtet.
Wir stellen daher die inständige Bitte, dass wir an sämtlichen, von uns gepachteten Gewässern im Vorfeld über geplante Maßnahmen und Eingriffe informiert werden. Gerne bemühen wir uns, hierbei praktikable Lösungen für alle Beteiligten zu finden. Aufgrund der Tatsache, dass wir stets vor Ort sind und die örtlichen
Gegebenheiten kennen, entspricht dies auch dem ausdrücklichen Wunsch der Fischereifachberatung und des Verpächters. Beide wollen und werden sich auf unsere Einschätzungen stützen.
Leider ist es bei den o.g. Vorfällen wieder einmal zu spät, Natur- und Lebensräume wurden zerstört und wir müssen dies erneut schlucken. Zukünftige Vorfälle werden wir deshalb konsequent verfolgen, auch durch Stellung von Schadensersatzansprüchen gegen die Verantwortlichen. Wir bauen deshalb auf eine Abstimmung im Vorfeld.
|
|
|
Anlage 2:
|
|
|
Sehr geehrte […],
in Teilen wiederholen wir hier einen Brief an Ihr Haus vom 02.05.2016 an die Abt. Wasserrecht – […] – der damals leider ohne jede Antwort blieb.
Nach unserer Kenntnis besteht das LRA OAL auf einen Rückbau des Mühlbachs. Dieser Forderung schließen wir uns vehement an! Hier gilt es auch zu überprüfen, inwieweit die ursprünglich vorhandene Durchgängigkeit des Gewässers über den alten Stollen – sprich Wasserzulauf von oben – als Auflage für die Aufrechterhaltung des alten Triebwasserkanals vermerkt war. Dieser Zulauf wurde beim Bau des neuen Kraftwerks am Lechfall durch die Kraftwerk Füssen GbR nämlich ersatzlos still- und der Mühlbach somit teilweise trockengelegt. Auch hier bitten wir – als Pächter des Gewässers – um Information zur Sachlage und zum damaligen Verfahren. Der Mühlbach diente seit jeher als Rückzugsgebiet für Fische bei Hochwasser sowie als Laichgebiet und Jungfischhabitat. Ein Verlust dieser Strecke wirkt sich nachteilig auf die Fischbestände aus, wir als Pächter werden geschädigt. Die geplanten Umbaumaßnahmen im Hanfwerke-Areal, die wir im Sinne der Stadt Füssen durchaus begrüßen, bilden eine einmalige Chance, das Thema „fließendes Wasser“ wieder erlebbar zu machen und den verlorenen Lechauen wieder ein Stück Natur zurückzugeben. Wasserläufe innerhalb des Areals, wie sie bereits vorlagen, müssen wieder aktiviert werden. Mit Verweis auf die Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinien – Verpflichtung zur Schaffung einer Durchgängigkeit von Gewässern – könnte im Zuge dieser Umbaumaßnahmen der alte Stollen wieder aktiviert und somit eine dringend notwendige Durchgängigkeit zwischen Schwalbenlech in der Stadt und dem Oberlech oberhalb des Lechfalls geschaffen werden. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen sind die Betreiber von Wasserkraftanlagen übrigens verpfichtet, Fördergelder hierfür könnten ebenfalls in Anspruch genommen werden.
|
Der Mühlbach wurde im Zuge der Errichtung des ehem. Faserzentrums – einem Förder- und Kooperationsprojekt von Bund, Freistaat Bayern und Land Baden-Württemberg – vor über 30 Jahren endgültig stillgelegt. Seitdem ist kein Fließgewässer mehr vorhanden. Lediglich im Falle eines Hochwassers, wurde der stillgelegte Mühlgraben geflutet. Seit dem letzten Hochwasser war der Mühlgraben nur noch eine Schmutzlache.
Über die letzten Jahre hinweg wurde der Mühlgraben zunehmend von Passanten auf der Tiroler Straße zugemüllt. Unerlaubt wurde von der Straße aus immer wieder Unrat hinunter in den Graben geworfen, was zur Folge hatte, dass sich Ratten und Mäuse ansiedelten. Diese waren bereits Gegenstand von Beschwerden der Nutzer und Mieter des Magnus Parks. Weiterhin sind hochwertige potenzielle Mieter (z. B. eine Dialysepraxis) aufgrund des Rattenbefall abgesprungen.
Aus Sicht des Denkmalschutzes kommt dem Mühlgraben durchaus eine denkmalfachliche Bedeutung zu. Das Landratsamt hat vor diesem Hintergrund eine Wiederöffnung des Mühlgrabens angeordnet. Der Vollzug dieser Rückbauanordnung ist im Einvernehmen mit dem LRA und dem BLfD seiner Zeit ausgesetzt worden, um eine ganzheitliche städtebauliche Neubewertung der Situation anhand eines Gesamtkonzeptes, welches auch konkret auf die denkmalfachlichen Aspekte eingeht, zu ermöglichen. Auf Grundlage dieses Konzeptes und einer entsprechend Stellungnahme des BLfD, wird seitens des LRA eine Neubeurteilung der Situation mit dem verfüllten Mühlbach und der angestrebten Planung erfolgen. Es wird zudem auf die auf die vorausgehenden Ausführungen verwiesen.
|
|
Anlage 3a:
|
|
|
Sehr geehrte […],
anbei erhalten Sie unsere Stellungnahme und Forderungen zum Verfahren:
1) Rückbau und Freilegung des Mühlbachs laut Forderung LRA OAL als als Rückzugsgebiet für Fische bei Hochwasser sowie als Laichgebiet und Jungfischhabitat.
2) Die bereits eingeschränkte Umlagerungsstrecke des Lechs entlang des Hanfwerkeareals ist in ihren Abmessungen zwingend zu erhalten bzw. nach Möglichkeit weiter auszubauen. Sie dient als Retentionsraum
und stellt ein zu schützendes Laichgebiet für Kieslaicher dar.
3) Die geplante Ufergestaltung und -Nutzung entlang des Lechs darf keine negativen Auswirkungen auf die Kiesbänke und Umlagerungsstrecke haben. Ebenso darf diese nicht zum Bevölkern und Mißbrauch dieser Bereiche einladen.
4) Die einmalige Chance, das Thema „fließendes Wasser“ wieder erlebbar zu machen und den verlorenen Lechauen wieder ein Stück Natur zurückzugeben, muss bei den weiteren Planungen innerhalb des Areals verfolgt werden. Diese Wasserläufe lagen in der Vergangenheit vor und sollten wieder aktiviert werden.
Als hervorragendes Beispiel kann hierzu das Fischerviertel in Ulm entlang der Donau genannt werden.
Die dortigen Bäche werden von Flora und Fauna angenommen und schaffen für Bewohner und Besucher ein attraktives Umfeld und eine einladende Atmosphäre – siehe Anlage Fotos.
|
Die Ausführungen aus Anlage 3a dienen der Kenntnisnahme. Die Forderungen wurden zu Teilen vorausgehend nochmals genannt und entsprechend gewürdigt.
|
|
Anlage 3b: Ulm – Fischerviertel entlang der Donau
|
Die Bilder aus Anlage 3b dienen der Kenntnisnahme. Den Bildern des Fischerviertels der Stadt Ulm werden Bilder des status quo im Magnus-Park als Gewerbe- und Industriebrache gegenübergestellt. Der Magnus-Park ist seit über 30 Jahren nahezu vollversiegelt und weist seitdem kein Fließgewässer mehr auf.
|
|
|
|
|
Beschlussvorschlag
|
|
|
|
Der Bebauungsplanvorentwurf wird entsprechend der fachlichen Würdigung/ Abwägung redaktionell ergänzt. In der Begründung wird die Verortung der festgesetzten Wasserfläche korrigiert und die Hinweise in der Satzung durch einen Baustein zur Niederschlagswassereinleitung in oberirdische Gewässer ergänzt.
|
|
|
|
|
|
|
- Kreisheimatpfleger – Baudenkmal – Landkreis Ostallgäu vom 14.12.2023
|
|
- Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Sonstige fachliche Information und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage.
Aus dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf sind nachstehende Besprechungspunkte vom 17.01.2023 nicht zu erkennen bzw. wurden nicht berücksichtigt.
|
|
|
Mobilitätshub: Reduzierung und Verlagerung in Richtung Westen. Verlässliche Höhenschnitte im Bereich Mobilitätshub/ Tiroler Straße.
|
Bei dem auf Initiative der Stadt Füssen und Eigentümers einberufenen Scoping-Termin am 05.04.2023 wurde vom Büro OPLA die Charakteristik des Masterplans erläutert. Der städtebauliche Masterplan sowie der daraus entwickelte Bebauungsplan haben gemeinsam das Hauptziel, die bestehende historische Bebauung zu sichern und als solche wieder erlebbar zu machen. Als Ergänzung zum Bestand soll zudem der „Südbau“ in seiner Zeilenstruktur bis auf die Höhe des Lechbaus verlängert werden, wodurch die neue Platzgestaltung beim Eingang des Magnus Parks städtebaulich hervorgehoben wird. Eine strenge Grünordnung betont zudem die Zeilenbebauung. Die notwendigen und öffentlichen Stellplätze sollten nach bisheriger Planung in einem zentralen Mobilitätshub untergebracht werden, sodass das historische Ensemble durch den ruhenden Verkehr nicht beeinträchtigt wird und ein weitestgehend autofreies Quartier mit hochwertiger Freianlagen entstehen kann.
Der angestrebte attraktive urbane Nutzungsmix (Gewerbe, Handwerk, Dienstleitungen, Gastronomie, Indoor-Freizeit Nutzungen, Bildung, ergänzendes Wohnen) benötigt selbst dann eine erhebliche Erhöhung des Stellplatzbedarfs im Magnus Park, wenn von der Stellplatzsatzung der Stadt Füssen abweichende Stellplatzzahlen festgesetzt werden.
Die Anzahl der notwendigen Stellplätze wären selbst um den Preis einer noch weitergehenden Flächenversieglung gegenüber dem Bestand nicht abbildbar. Eine Verteilung der notwendigen Stellplätze im gesamten Quartier stünde zudem im diametralen Widerspruch zu den oben genannten städtebaulichen Zielen einer Aufwertung und Attraktivierung der Freiraumgestaltung und Erlebbarkeit des Industriedenkmals.
Die Konsequenz aus den oben genannten städtebaulichen Zielen ist die Bündelung der Stellplätze in einem Mobilitätshub. Für diesen wurden unter Berücksichtigung der oben angeführten städtebaulichen, landschaftlichen und denkmalschutzfachlichen Leitziele verschiedene Standortvarianten untersucht.
Bei dieser Alternativenprüfung wurden folgende Kriterien beachtet:
- denkmalgeschützte Gebäude mit vorgegebenem Raster und beschränkter Statik
- Sicherung von bestehendem Gewerbe (Faserzentrum als Ankermieter des Magnus Parks)
- Einbindung in das historische Ensemble und Landschaft
- hohe Grundwasserstände und schwierige Bodenbeschaffenheit.
Eine Integration des Mobilitätshubs in die historischen Gebäude scheidet aus mehreren Gründen aus. Die historische Bausubstanz weist keine hinreichende Tragkraft auf. Eine statische Ertüchtigung lässt sich weder wirtschaftlich noch denkmalschutzrechtlich darstellen. Darüber hinaus lässt die baukonstruktive Rasterung keine effiziente Parkraumverteilung zu. Die erforderlichen Erschließungsanlagen würden grob verunstaltend wirken und dem Leitziel eines autofreien Quartiers widersprechen.
Konsequenz hieraus ist, dass nur der Neubau eines Mobilitätshubs diesen städtebaulichen Zielen Rechnung tragen kann. Für den Neubau wurden verschiedene Varianten geprüft.
Eine Verortung an der Stelle der südlichen Gewerbehalle scheidet aus. Das ehem. Faserzentrum ist Ende der 1980er Jahre aus Mitteln der Wirtschaftsförderung von Bund und Länder unter Einsatz des damaligen bayrischen Ministerpräsidenten gefördert worden und war Bestandteil einer Kooperation des Freistaats Bayern mit dem Land Baden-Württemberg. Das Faserzentrum sollte in Kooperation mit dem wissenschaftlichen Transferzentrum für nachwachsende Faserrohstoffe in Reutlingen Prozesse der Aufbereitung, der Spinnerei, des Webens, des Färbens und der Ausstattung untersuchen sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit praktischem Bezug für die industrielle Weiterverarbeitung der Flachsfaser im textilen und nichttextilen Bereich leisten (siehe etwa LT-Drs. Baden-Württemberg 10/2488, S. 7). Das Faserzentrum ist damit – wie der Magnus-Park insgesamt – ein Zeugnis bayrischer und baden-württembergischer Industriepolitik und des Niedergangs der deutschen Textilindustrie. Zugleich ist das ehem. Faserzentrum auch heute noch mit dem wichtigsten Ankermieter (Erhart GmbH, Werkzeug- und Gerätebau) des Magnus Park belegt. Eine nachhaltige und wirtschaftlich darstellbare Entwicklung des Quartiers kann nur mit Rücksicht auf die bestehenden Mieter gelingen. Ein Bestandschutz der bestehenden Mieter ist für den Stadtrat neben der Revitalisierung des Gesamtquartiers vorrangiges Planungsziel.
Eine Überbauung der Halle wurde vom Eigentümer geprüft, ist aber aus bautechnischen und statischen Gründen nicht wirtschaftlich darstellbar und wäre auch denkmalfachlich nicht adäquat. Die Anregung, den Mobilitätshub weitestgehend als Verlängerung an die südliche Gewerbehalle zu rücken, nähme der Gewerbehalle ihre zentrale Zufahrt sowie Aufstell- und Wendeflächen, die auch weiterhin jedenfalls für LKW von 7,5 bis jedenfalls 20 t gewährleistet bleiben müssen. Die vorgeschlagene Verortung würden zwar denkmalfachliche Belange noch weiter stärken, zugleich jedoch die Existenz bestandsgeschützter gewerblicher Nutzungen und einen Gewerbebetrieb mit über 50 Arbeitsplätzen, der aktuell Investitionen in Millionenhöhe tätigt, gefährden. Sie scheidet vor diesem Hintergrund aus.
Ergebnis dieser städtebaulichen Ziele und Variantenuntersuchung ist, dass eine Neuerrichtung eines Mobilitätshubs nur an der geplanten Stelle städtebaulich sinnvoll ist und den denkmalschutzfachlichen Ansprüchen des Industrieareals Rechnung trägt.
Das BLfD hat selbst im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens signalisiert, dass die Wiederöffnung des Mühlgrabens kein denkmalschutzfachliches Dogma ist und einer hochwertigen städtebaulichen Entwicklung des Quartiers nicht im Weg stehen soll. Vorrangiges Ziel der Bauleitplanung ist es, die derzeitige historische Bebauung wieder erlebbar zu machen. Weiterhin wolle man die südliche Zeile bis Höhe des Lechbaus verlängern, um die Platzgestaltung beim Eingang des Magnus Parks städtebaulich hervorzuheben. Eine strenge Grünordnung betone zudem die Zeilenbebauung. Die notwendigen und öffentlichen Stellplätze sollten nach bisheriger Planung in einem zentralen Mobilitätshub untergebracht werden, sodass das historische Ensemble durch den ruhenden Verkehr nicht beeinträchtigt wird. Von der Vertreterin und dem Vertreter des Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege wurde zudem betont, dass der Mühlbachgraben nicht im Vordergrund stehe, wenn die städtebauliche Zeilenstruktur als Mehrwert gewonnen werde.
Ergebnis der Vorabstimmung war, dass für die Verfüllung des Mühlgrabens kompensatorische Maßnahmen denkbar sind.
Im Rahmen der Erarbeitung der Verfahrensunterlagen wurde ein digitales Massenmodell auf der Grundlage des Reliefs (LOD2 Daten) erarbeitet. Dieses dient als Arbeitsinstrument zur Beurteilung der Auswirkung der Planung und ist deutlich aussagekräftiger als 2D Schnitte. Die Begründung wird mit entsprechenden Bildern ergänzt.
|
|
Südbauerweiterung: max. 2-geschossiger Anbau zur Wahrung der historischen Fassade im Hintergrund.
|
Der Stellungnahme wird Rechnung getragen. Die Erweiterung des Anbaus wird auf zwei Geschosse (wie im Bestand vorhanden) mit Flachdach reduziert.
|
|
Mühlbachgraben: Wiederherstellen des Mühlbachs im vorderen Bereich.
|
Wie bereits oben erläutert, wurde von der Vertreterin und dem Vertreter des Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege betont, dass der Mühlbachgraben nicht im Vordergrund stehe, wenn die städtebauliche Zeilenstruktur als Mehrwert gewonnen werde. Durch den geplanten Rückbau der Zwischenbauten sowie der strengen Grünordnung wird dieses städtebauliche Ziel erreicht. Des Weiteren wurde beim gemeinsamen Scoping-Termin von Seiten des Landesamtes erklärt, dass der Mühlbachgraben unter Umständen auch auf einer nur begrenzten Länge von zwei bis drei Meter oder am Anfangspunkt (z.B. die Lecheinbuchtung mit 2-3 Meter unter der Brücke) und am Endpunkt (Rückgebäude Kesselhaus) präsentiert werden könne.
Im Gesprächsverlauf hat man sich auf die zwei Standorte Anfang- und Endpunkt verständigt.
Im städtebaulichen Masterplan, welcher beim Scoping-Termin erläutert wurde und Grundlage des Bebauungsplans darstellt, werden die zwei Standorte zur historischen Würdigung „Lecheinbuchtung unter der Brücke“ und „Rückgebäude Kesselhaus“ dargestellt. An dieser Variante der historischen Würdigung hält die Stadt Füssen auch weiterhin fest. Um dieser Planung nochmals Nachdruck zu verleihen werden in der Planzeichnung die zwei Standorte durch Hinweise gekennzeichnet und in der Begründung genauer erläutert. Die konkrete Umsetzung unter Einbindung des BLfD wird in einem städtebaulichen Vertrag mit dem Entwickler vertraglich vereinbart.
Eine Öffnung des Mühlgrabens steht zudem im Konflikt mit dem Mobilitätshub-Standort. Wie bereits vorausgehen erläutert, ist ein alternativer Standort für den Mobilitätshub nicht ohne Eingriffe in die Baudenkmäler oder das bestehende und zu haltende Gewerbe möglich.
|
|
Siehe Skizze in der Anlage.
|
Die Anlage dient der Kenntnisnahme.
|
|
|
|
|
|
|
Der Bebauungsplanvorentwurf wird entsprechend der fachlichen Würdigung/ Abwägung redaktionell durch Hinweise zur historischen Würdigung des Mühlgrabens ergänzt. Zudem wird die Begründung um Bilder aus dem 3D Massenmodell redaktionell ergänzt. Der Bebauungsplanvorentwurf wird dahingehen geändert, dass die Erweiterung des Südbaus auf die Höhe im Bestand mit Flachdach begrenzt wird.
|
|
|
|
|
|
|
- Landesbund für Vogelschutz – Kreisgruppe Ostallgäu/Kaufbeuren
vom 30.11.2023
|
|
- Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Der LB V Ostallgäu, hier vertreten durch […], ortsansässig in Füssen, bittet die Stadt Füssen, vertreten durch Fa. OPLA, bei der Erstellung des Bebauungsplanes S55 um Beachtung folgender Details.
|
|
|
1. Der LBV OAL/KF fordert den Rückbau des aufgefüllten Mühlbaches. Die Freigabe der Auffüllung durch den Stadtrat Füssen widerspricht jeglicher Naturschutzregel, ist in keiner Weise nachhaltig und rechtlich absolut unverbindlich. Der LBV fordert deshalb zumindest, ähnlich den Regeln beim Straßenbau, die Schaffung eines Ausgleichsgewässers auf dem hier behandelten Gelände.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme und weist darauf hin, dass der Mühlgraben seit über 30 Jahren kein fließendes Gewässer mehr war. Der ehemalige Mühlbach wurde bereits vor nahezu 30 Jahren nach Eröffnung der neuen Wasserkraftanlage und der Errichtung des Faserzentrums stillgelegt. Eine direkte Ost-West Verbindung (Fließgewässer) wird somit durch die vorliegende Planung nicht behindert, da diese bereits stillgelegt vor Jahren stillgelegt wurde. Es bestand lediglich ein Unterwasserkanal, welcher auf Höhe der südlich bestehenden Gewerbehalle endete. Teilbereiche zwischen der Gewerbehalle und der östlichen Brücke wurden verfüllt. Die Stellungnahme verkennt, dass auch eine Wideröffnung des Mühlbachs nicht zu einem fließenden Gewässer führen kann, da die südliche Gewerbehalle des ehemaligen Faserzentrums (Erhart GmbH Werkzeug- und Gerätebau) als bestandsgeschützte Nutzung ein durchgängiges Fließgewässer ausschließt. Die Stilllegung ist und war nie Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung. Ziel ist es die denkmalgeschützte Industriebrache vor dem Verfall zu schützen und zu revitalisieren.
Planungsziel des Bebauungsplans ist eine Revitalisierung der Brachfläche und deutliche Aufwertung des Areals – auch in naturschutzfachlicher Hinsicht. Die Entwicklung des Magnus Parks zu einem nachhaltigen urbanen Quartier wird einen erheblichen zusätzlichen Stellplatzbedarf nach sich ziehen. Aufgrund der unter Denkmalschutz stehenden historischen Bauzeilenstruktur, der denkmalschutzwürdigen Blickbeziehungen und der vorhandenen Gewerbebetriebe, gibt es keinen Alternativstandort für den benötigten Mobilitätshub. Auch aus diesem Grund scheidet eine Wiederöffnung des Mühlbachs aus.
|
|
Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass in dem Gewässer für eine ausreichende Strömung (Wasserwechsel) gesorgt ist und eine freie Anbindung zum Lech vorhanden ist. Dies, damit wieder eine Nutzung der dort ehemals vorhandenen Vogelwelt gewährleistet ist. Lt. den mir noch vorliegenden Notizen meiner privaten Beobachtungen handelt es sich unter anderem um folgende Arten: Eisvogel jagend, Flußuferläufer brütend und jagend, Gebirgsstelze jagend, Wasseramsel jagend.
|
Die Stellungnahme ist zunächst inhaltlich nicht nachvollziehbar, da es den Mühlbach als Fließgewässer seit über 30 Jahren nicht mehr gibt. Aus der Stellungnahme geht leider nicht hervor, wann und wo genau die privaten Beobachtungen stattgefunden haben.
Die Stadt Füssen weist zudem darauf hin, dass der Naturraum des Uferbereichs am Lech nicht Gegenstand der Planung ist. Die bestehenden Gehölzstrukturen liegen hinter der Lechmauer (Hochwasserschutz) und werden durch die geplante Revitalisierung des Grundstücks nicht beeinträchtigt.
|
|
Die bereits eingeschränkte Umlagerungsstrecke des Lechs entlang des Hanfwerkeareals ist in ihren Abmessungen gem. beigefügten Schreiben des Kreisfischereivereins zwingend zu erhalten. Sie dient als Retentionsraum und stellt ein zu schützendes Laichgebiet dar.
|
Es existieren seit über 30 Jahren keine Umlagerungsstrecke des Lechs und kein Fließgewässer auf dem Gelände des Magnus Park.
Der Verlauf des Lechs, sowie der nordwestliche Naturraum des Uferbereichs am Lech ist nicht Gegenstand der Planung. Die bestehenden Böschung mit Gehölzstruktur liegen hinter der Lechmauer (Hochwasserschutz) und wird durch die geplante Revitalisierung des Grundstücks nicht beeinträchtigt.
|
|
2. Bei der evtl. Bebauung im Bereich der südlichen Stützmauer an der Tiroler Straße ist eine Höhenbegrenzung der geplanten Gebäude festzulegen, damit eine freie Sicht auf das Ensemble Kloster-Kirche-Hohes Schloß gewährleistet bleibt.
|
Das geplante Mobilitätshub entlang der Tiroler Straße im Südosten Plangebietes soll nicht signifikant über die bestehende Tiroler Straße hinausragen, sodass die Blickbeziehungen zu den Baudenkmälern nicht beeinträchtigt werden. Dieser Umstand ist durch eine Höhenfestsetzung in der Satzung bereits gesichert.
|
|
3. Im Rahmen von Punkt 2 empfiehlt der LB V eine Eruierung der Meinung von Füssens Bürgern bzgl. Abbruch des Kamins der ehemaligen Hanfwerke Füssen. Dieser Kamin verschandelt das Stadtbild Füssens. Speziell bei Anfahrt zur Stadt über die sog. Kaminkurve. Der Kamin steht als Industriedenkmal unter Denkmalschutz, was aber bei hunderten dieser Bauwerke in Deutschland doch etwas verwunderlich erscheint. Außerdem wäre zu klären, ob es sich hier um den Originalkamin handelt. Die momentane Nutzung als Funkmast kann mit Sicherheit keine Begründung „Denkmal" sein. Wegen der Kürze der Terminstellung zur Stellungnahme steht eine Antwort der Behörde Denkmalschutz noch aus.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die Anregung. Der Kamin ist Bestandteil des Denkmalgeschützten Kesselhauses und ist eine prägende Reminiszenz an die Industriegeschichte des Magnus Park. Die Stadt Füssen sieht daher keinen Anlass zu einer Eruierung der Meinung von Füssens Bürger und Bürgerinnen bzgl. eines Rückbaus des Kamins.
Die Träger öffentlicher Belange werden im Übrigen gebeten, sich auf Ihre Belange zu konzentrieren.
|
|
Anlage: Schreiben „Beteiligung im Verfahren nach § 4.2 BauGB zur Vorbereitende Untersuchungen ehemaliges Hanfwerkeareal“
anbei erhalten Sie unsere Stellungnahme und Forderungen zum Verfahre
|
|
|
1) Rückbau und Freilegung des Mühlbachs laut Forderung LRA OAL als als Rückzugsgebiet für Fische bei Hochwasser sowie als Laichgebiet und Jungfischhabitat.
|
Der Mühlgraben ist seit über 30 Jahren kein Fließgewässer, kein Laichgebiet und kein Jungfischhabitat. Eine Öffnung des Mühlgrabens steht zudem im Konflikt mit dem Mobilitätshub-Standort und den damit verfolgten städtebaulichen und Sanierungszielen der Stadt Füssen. Ein alternativer Standort für den Mobilitätshub ist nicht ohne Eingriffe in die Baudenkmäler oder das bestehende und zu haltende Gewerbe möglich. Ohne das Mobilitätshub wird auch keine Revitalisierung der Industriebrache möglich sein.
|
|
2) Die bereits eingeschränkte Umlagerungsstrecke des Lech entlang des Hanfwerkeareal ist in ihrer Abmessungen zwingend zu erhalten bzw. nach Möglichkeit weiter auszubauen. Sie dient als Retentionsraum und stellt ein zu schützendes Laichgebiet für Kieslaicher dar.
|
Es existiert seit jedenfalls 30 Jahren keine Umlagerungsstrecke des Lechs auf dem Gelände des Magnus Park.
Der Verlauf des Lechs, sowie der nordwestliche Naturraum des Uferbereichs am Lech ist nicht Gegenstand der Planung. Die bestehenden Böschung mit Gehölzstruktur liegen hinter der Lechmauer (Hochwasserschutz) und wird durch die geplante Revitalisierung des Grundstücks nicht beeinträchtigt.
|
|
3) Die geplante Ufergestaltung und -Nutzung entlang des Lechs darf keine negativen Auswirkungen auf die Kiesbänke und Umlagerungsstrecke haben. Ebenso darf diese ich zu Bevölkern und Mißbrauch dieser Bereiche einladen.
|
Die geplanten und festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen entlang des Lechs liegen vor der Lechmauer (Hochwasserschutz) und werden zukünftig einen Puffer und Übergang zwischen dem Urbanen Gebiet und dem Gewässer darstellen. Der außerhalb der Mauer liegende Naturraum des Uferbereichs ist nicht Gegenstand der Planung. Die bestehende Böschung mit Gehölzstruktur wird durch die geplante Revitalisierung des Grundstücks nicht beeinträchtigt.
Ein Missbrauch des Lechufers durch Dritte ist mit ordnungsrechtlichen Maßnahme zu ahnden; dieser ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Auf das verfassungsrechtlich geschützte Recht der Allgemeinheit auf freien Zugang zu Natur und Landschaft einschließlich der Flüsse (Art. 141 Abs. 3 BV) wird hingewiesen.
|
|
4) Die einmalige Chance, das Thema „fließendes Wasser“ wieder erlebbar zu machen und den verlorenen Lechauen wieder ein Stück Natur zurückzugeben, muss bei den weiteren Planungen innerhalb des Areals verfolgt werden. Diese Wasserläufe lagen in der Vergangenheit vor und sollten wieder aktiviert werden.
Als hervorragendes Beispiel kann hierzu das Fischerviertel in Ulm entlang der Donau genannt werden.
Die dortigen Bäche werden von Flora und Fauna angenommen und schaffen für Bewohner und Besucher ein attraktives Umfeld und eine einladende Atmosphäre – siehe Anlage Fotos.
|
Es wird erneut darauf hingewiesen, dass keine Lechauen, sondern eine Industriebrache überplant wird. Der Mühlgraben ist seit über 30 Jahren nicht mehr wasserführend gewesen.
|
|
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplanvorentwurfs..
|
|
|
- Landratsamt Ostallgäu vom 15.12.2023
- LRA Ostallgäu – Bauplanungsrecht / Städtebau
|
|
- Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können (z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen).
Siehe „Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen“
|
|
|
Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage.
|
|
|
SG 40 – Bauplanungsrecht I Städtebau:
Das Planungsareal wird im Westen und Norden durch den Wildfluss Lech und im Süden durch den Steilhang des Hutlersberg räumlich und topografisch scharf abgegrenzt. Die einzige Erschließungsmöglichkeit befindet sich an der nach Osten spitz zulaufenden Grundstücksecke, welche aufgrund der nachfolgend exemplarisch dargelegten, zahlreichen Einschränkungen eine städtebaulich schwierige und hoch relevante Engstelle darstellt.
Das ehem. Hanfwerkeareal wird sowohl südöstlich als auch nordöstlich vom Ensemble, „Altstadt Füssen“ umschlossen, was die vielfachen und wichtigen wechselseitigen Sichtbeziehungen unterstreicht.
Mit dem Hohen Schloss, dem ehem. Benediktiner Kloster St. Mang, einem Baudenkmal von nationaler Bedeutung, und dem südlichen Abschluss des Ensembles „Altstadt Füssen“, am Fuße des Hutlersberg, nach Westen durch die Filialkirche „unserer Lieben Frau am Berg“ samt Kreuzweg auf den Kalvarienberg begrenzt, dürfte es sich hier um eine der relevantesten Sichtbeziehungen für die Altstadt von Füssen handeln!
Insbesondere die stark bewegte Topografie mit Blickbeziehungen auch von höher gelegenen Standorten wie z.B. Baumgarten, Hohes Schloss, Kloster St. Mang, Lechhalde, Hutlers- und Kalvarienberg erfordert eine sehr differenzierte und fachlich fundierte Betrachtung und Bearbeitung der wichtigen wechselseitigen Beziehungen.
Zudem stellt das Areal der ehern. Hanfwerke Füssen AG mit der zugehörigen, nördlich der historischen Altstadt gelegenen, Arbeiterwohnsiedlung einen wichtigen und anschaulich erhaltenen Baustein in der Stadtentwicklung von Füssen dar, der sowohl in wirtschaftlicher als auch sozialer Hinsicht richtungsweisend war und ist.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die Stellungnahme. Die Ausführungen zur Lage, Topografie, dem Denkmalschutz, Erschließung und Bestand dienen der Kenntnisnahme.
|
|
Die Engstelle, in ausgesprochen sensibler und exponierter Lage, muss damit eine Vielzahl an Funktionen erfüllen und auch mit dem Thema der sackgassenartigen Erschließung des mit ca. 5,6 ha doch beachtlich großen Areals umgehen. Ziel der Planung muss damit, unter Berücksichtigung der nachfolgend exemplarisch aufgezeigten Rahmenbedingungen, die qualitative Sicherung der städtebaulich hochwertigen Situation sein.
|
Die Stadt Füssen teilt die Einschätzungen zu den bauleitplanerischen Herausforderungen. Allerdings ist ersichtlich keine städtebauliche hochwertige Situation vorhanden, sondern eine nahezu vollversiegelte Gewerbe- und Indutriebrache. Ziel der Bauleitplanung ist die Schaffung einer städtebaulich hochwertigen Situation.
|
|
Orts- und Landschaftsbild:
Der südliche Teil des Ensembles Altstadt Füssen ist bzw. war mit seiner einzeiligen Hangbebauung am Fuß des Hutlersbergs sowohl topografisch als auch durch die vorhandenen Grünstrukturen organisch in den Landschaftsraum eingebettet.
Mit der nicht genehmigten Veränderung der Zufahrtssituation im Jahr 2016 wurden u.a. die nördlich der Straße vorhandenen Gehölzstrukturen ebenso wie die in Teilbereichen vorhandenen Anböschungen ersatzlos, zugunsten der neuen Erschließungsstraße samt Parkflächen, von der Zufahrt bis auf die Höhe des Mittelbaus nach Westen, entfernt. Damit wurde die mehrere Meter hohe, nach Westen ansteigende, Stützwandkonstruktion der Tiroler Straße freigelegt und der südliche Abschluss des Ensembles mit seinen zahlreichen Einzeldenkmälern optisch aus dem Landschaftskontext herausgerissen. Gerade in der Fernwirkung, von der gegenüberliegenden Lechseite und der Lechbrücke wurde die organische Einbindung durch den grünen Hangfuß gleichsam abgeschnitten und durch den technoiden Sockel eines Verkehrsbauwerks ersetzt.
Trotz der zahlreichen Vorabstimmungen in denen dieser Punkt mehrfach thematisiert wurde befasst sich die vorliegende Planung weiterhin nicht mit dem bekannten Problem und zeigt auch keinerlei Lösungsansätze auf.
|
Die Verlegung der ehemaligen Zufahrt ist notwendig geworden, da die alte Zufahrtsbrücke zum Gewerbe- und Industrieareal nicht mehr tragfähig für den motorisierten Individualverkehr, insbesondere der LKW war. Die aktuell über 100 Mieter und Nutzer des Magnus-Parks drohten ihre einzige wegemäßige Erschließung zu verlieren. Klargestellt wird, dass auch vor Anlage der neuen Zufahrt keine komplette Anböschung an der Stützwand vorhanden war, da zwischen Stützwand und dem ehemaligen Gehölzbestand ein Fußweg für die Arbeiter bestand (s. nachfolgendes Bild). Wie auch das Staatliche Bauamt im Rahmen eines Scoping Termins gefordert hat, muss die Rückverankerungen der Stützwand für regelmäßige Revisionen uneingeschränkt zugänglich sein.
Die geplante Bebauung mit einem Mobilitätshub stellt einerseits die Zugänglichkeit der Rückverankerungen sicher (im städtebaulichen Vertrag abgesichert) und kann andererseits die Einbindung in das Landschaftsbild verbessern (z. B. begrünte Fassade).
Bsp.: Parkhaus TONIPark in Augsburg und einer Grünfassade, Jakob Rope Systems
Bestehender Weg bevor die neue Zufahrt erstellt wurde:
Die der Stellungnahme vorausgegangene Beschreibung der Blickbeziehungen, insbesondere von und zur Filialkirche "unserer Lieben Frau am Berg" war bis dato aufgrund der Gehölze gar nicht möglich (s. nachfolgendes Bild, GoogleStreetview, Privataufnahme).
|
|
Ganz im Gegenteil sieht der vorliegende Entwurf nach wie vor ein sehr groß dimensioniertes Parkhaus bis unmittelbar zur Engstelle vor. Damit wird der bestehende Missstand verschärft, die ohnehin schon stark beengte Zufahrtssituation noch weiter eingeengt und somit die optische Anbindung ebenso wie die Fernwirkung von der gegenüberliegenden Lechseite weiter massiv verschlechtert.
Im Nachgang zur letzten Abstimmungsbesprechung vor Ort am 05.04.2023 wurde Seitens des LRA hierzu folgende Anmerkung zu Protokoll gegeben;
" .. . Zum Parkhaus habe ich angeregt, dass als mögliche, städtebaulich verträglichere, Standorte z.B. das Faserzentrum bzw. eine Position in Verlängerung der nördlich des Faserzentrums gelegenen Gebäudeachse in Frage kommen könnte.
Hintergrund ist, dass die extrem beengte und topografisch schwierige Zufahrtssituation zum Gesamtareal hier das Thema des grünen Hangfußes zum Hutlers- und Kalvarienberg als ortsbildprägende Geländeformation mitberücksichtigen muss. Dies insbesondere wegen des gegenüberliegenden Einzeldenkmals von nationaler Bedeutung "ehem. Klosteranlage St. Mang" und der stadträumlich sehr präsenten, wechselseitigen Sichtbeziehungen von den beiden Lechuferseiten und der Brücke.
Entsprechend habe ich aus städtebaulichen Aspekten darauf gedrängt den Hangfußbereich soweit als möglich von einer weiteren Bebauung frei zu halten und den städtebaulichen Missstand, der mit der jüngsten Freilegung der Stützwandkonstruktion entlang der Tiroler Straße und der Entfernung der ursprünglich vorhandenen Eingrünung entstanden ist, bei den weiteren Planungen wieder zu bereinigen! Hieraus leitet sich auch mein Hinweis zur Verschiebung des Parkhauses so weit als möglich nach Südwesten, weg von der problematischen Engstelle, ab. … "
|
Bei dem auf Initiative der Stadt Füssen und Eigentümers einberufenen Scoping-Termin am 05.04.2023 wurde vom Büro OPLA die Charakteristik des Masterplans erläutert. Der städtebauliche Masterplan sowie der daraus entwickelte Bebauungsplan haben gemeinsam das Hauptziel, die bestehende historische Bebauung zu sichern und als solche wieder erlebbar zu machen. Als Ergänzung zum Bestand soll zudem der „Südbau“ in seiner Zeilenstruktur bis auf die Höhe des Lechbaus verlängert werden, wodurch die neue Platzgestaltung beim Eingang des Magnus Parks städtebaulich hervorgehoben wird. Eine strenge Grünordnung betont zudem die Zeilenbebauung. Die notwendigen und öffentlichen Stellplätze sollten nach bisheriger Planung in einem zentralen Mobilitätshub untergebracht werden, sodass das historische Ensemble durch den ruhenden Verkehr nicht beeinträchtigt wird und ein weitestgehend autofreies Quartier mit hochwertiger Freianlagen entstehen kann.
Der angestrebte attraktive urbane Nutzungsmix (Gewerbe, Handwerk, Dienstleitungen, Gastronomie, Indoor-Freizeit Nutzungen, Bildung, ergänzendes Wohnen) benötigt selbst dann eine erhebliche Erhöhung des Stellplatzbedarfs im Magnus Park, wenn von der Stellplatzsatzung der Stadt Füssen abweichende Stellplatzzahlen festgesetzt werden.
Die Anzahl der notwendigen Stellplätze wären selbst um den Preis einer noch weitergehenden Flächenversieglung gegenüber dem Bestand nicht abbildbar. Eine Verteilung der notwendigen Stellplätze im gesamten Quartier stünde zudem im diametralen Widerspruch zu den oben genannten städtebaulichen Zielen einer Aufwertung und Attraktivierung der Freiraumgestaltung und Erlebbarkeit des Industriedenkmals.
Die Konsequenz aus den oben genannten städtebaulichen Zielen ist die Bündelung der Stellplätze in einem Mobilitätshub. Für diesen wurden unter Berücksichtigung der oben angeführten städtebaulichen, landschaftlichen und denkmalschutzfachlichen Leitziele verschiedene Standortvarianten untersucht.
Bei dieser Alternativenprüfung wurden folgende Kriterien beachtet:
- denkmalgeschützte Gebäude mit vorgegebenem Raster und beschränkter Statik
- Sicherung von bestehendem Gewerbe (Faserzentrum als Ankermieter des Magnus Parks)
- Einbindung in das historische Ensemble und Landschaft
- hohe Grundwasserstände und schwierige Bodenbeschaffenheit.
Eine Integration des Mobilitätshubs in die historischen Gebäude scheidet aus mehreren Gründen aus. Die historische Bausubstanz weist keine hinreichende Tragkraft auf. Eine statische Ertüchtigung lässt sich weder wirtschaftlich noch denkmalschutzrechtlich darstellen. Darüber hinaus lässt die baukonstruktive Rasterung keine effiziente Parkraumverteilung zu. Die erforderlichen Erschließungsanlagen würden grob verunstaltend wirken und dem Leitziel eines autofreien Quartiers widersprechen.
Konsequenz hieraus ist, dass nur der Neubau eines Mobilitätshubs diesen städtebaulichen Zielen Rechnung tragen kann. Für den Neubau wurden verschiedene Varianten geprüft.
Die Stellungnahme fordert in der Sache einen Rückbau des bestandsgeschützten Gewerbebetriebs Erhart, der aktuell über 50 Arbeitsplätze, der aktuell Investitionen in Millionenhöhe tätigt, verfügt und einer der Ankermieter des Magnus Parks ist. Eine Überplanung des Standortes muss aus Sicht der Stadt Füssen auch die Belange der Wirtschaft und Sicherung und des Erhalts von Arbeitsplätzten Rechnung tragen.
Eine Verortung an der Stelle der südlichen Gewerbehalle scheidet aus. Das ehem. Faserzentrum ist Ende der 1980er Jahre aus Mitteln der Wirtschaftsförderung von Bund und Länder unter Einsatz des damaligen bayrischen Ministerpräsidenten gefördert worden und war Bestandteil einer Kooperation des Freistaats Bayern mit dem Land Baden-Württemberg. Das Faserzentrum sollte in Kooperation mit dem wissenschaftlichen Transferzentrum für nachwachsende Faserrohstoffe in Reutlingen Prozesse der Aufbereitung, der Spinnerei, des Webens, des Färbens und der Ausstattung untersuchen sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit praktischem Bezug für die industrielle Weiterverarbeitung der Flachsfaser im textilen und nichttextilen Bereich leisten (siehe etwa LT-Drs. Baden-Württemberg 10/2488, S. 7). Das Faserzentrum ist damit – wie der Magnus-Park insgesamt – ein Zeugnis bayrischer und baden-württembergischer Industriepolitik und des Niedergangs der deutschen Textilindustrie. Zugleich ist das ehem. Faserzentrum auch heute noch mit dem wichtigsten Ankermieter (Erhart GmbH, Werkzeug- und Gerätebau) des Magnus Park belegt. Eine nachhaltige und wirtschaftlich darstellbare Entwicklung des Quartiers kann nur mit Rücksicht auf die bestehenden Mieter gelingen. Ein Bestandschutz der bestehenden Mieter ist für den Stadtrat neben der Revitalisierung des Gesamtquartiers vorrangiges Planungsziel.
Eine Überbauung der Halle wurde vom Eigentümer geprüft, ist aber aus bautechnischen und statischen Gründen nicht wirtschaftlich darstellbar und wäre auch denkmalfachlich nicht adäquat. Die Anregung, den Mobilitätshub weitestgehend als Verlängerung an die südliche Gewerbehalle zu rücken, nähme der Gewerbehalle ihre zentrale Zufahrt sowie Aufstell- und Wendeflächen, die auch weiterhin jedenfalls für LKW von 7,5 bis jedenfalls 20 t gewährleistet bleiben müssen. Die vorgeschlagene Verortung würden zwar denkmalfachliche Belange noch weiter stärken, zugleich jedoch die Existenz bestandsgeschützter gewerblicher Nutzungen und einen Gewerbebetrieb mit über 50 Arbeitsplätzen, der aktuell Investitionen in Millionenhöhe tätigt, gefährden. Sie scheidet vor diesem Hintergrund aus.
Ergebnis dieser städtebaulichen Ziele und Variantenuntersuchung ist, dass eine Neuerrichtung eines Mobilitätshubs nur an der geplanten Stelle städtebaulich sinnvoll ist und den denkmalschutzfachlichen Ansprüchen des Industrieareals Rechnung trägt.
Das BLfD hat selbst im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens signalisiert, dass die Wiederöffnung des Mühlgrabens kein denkmalschutzfachliches Dogma ist und einer hochwertigen städtebaulichen Entwicklung des Quartiers nicht im Weg stehen soll. Vorrangiges Ziel der Bauleitplanung ist es, die derzeitige historische Bebauung wieder erlebbar zu machen. Weiterhin wolle man die südliche Zeile bis Höhe des Lechbaus verlängern, um die Platzgestaltung beim Eingang des Magnus Parks städtebaulich hervorzuheben. Eine strenge Grünordnung betone zudem die Zeilenbebauung. Die notwendigen und öffentlichen Stellplätze sollten nach bisheriger Planung in einem zentralen Mobilitätshub untergebracht werden, sodass das historische Ensemble durch den ruhenden Verkehr nicht beeinträchtigt wird. Von der Vertreterin und dem Vertreter des Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege wurde zudem betont, dass der Mühlbachgraben nicht im Vordergrund stehe, wenn die städtebauliche Zeilenstruktur als Mehrwert gewonnen werde.
Ergebnis der Vorabstimmung war, dass für die Verfüllung des Mühlgrabens kompensatorische Maßnahmen denkbar sind.
|
|
Eine planerische Bearbeitung der im Frühjahr aufgeworfenen Probleme ist augenscheinlich noch nicht erfolgt. Eine weitgehende Freistellung der Engstelle von unnötigen Funktionen und insbesondere von weiteren baulichen Einengungen wird sowohl in Hinblick auf eine adäquate und attraktive Anbindung des Magnus Park an die Stadt als auch unter städtebaulichen Gesichtspunkten weiterhin als zwingend erforderlich erachtet!
Es ist zwingend eine qualifizierte Freiflächenplanung im Rahmen der Bauleitplanung erforderlich. Eine Verlagerung auf das Einzelgenehmigungsverfahren ist hier nicht zielführend, da es einer umfassenden Gesamtbetrachtung bedarf.
Hier ist auf eine denkmalverträgliche Rückführung der Missstände zu achten und nicht auf eine Verfestigung derselben!
|
Wie die Stellungnahme selbst feststellt, hat die vorliegende Bauleitplanung eine Vielzahl städtebaulicher Probleme zu bewältigen, welche zueinander in einem Zielkonflikt stehen. Die Stadt hat sich im Rahmen Ihrer kommunalen Planungshoheit eingehende Gedanken zum städtebaulichen Konzept gemacht. Die Verortung des Mobilitätshubs ist an der einzig umsetzbaren Stelle geplant (s. o.).
Die Bauleitplanung trägt den Sanierungszielen der Stadt Füssen Rechnung. Nach den vorbereitenden Untersuchungen der F64 Architekten vom 28.04.2020 wird als städtebauliches Ziel für Verkehr und Erschließung in Kapitel 10.4 die „Entwicklung eines Konzeptes, das den ruhenden Verkehr innerhalb der räumlichen Gegebenheiten des Planungsgebiets sinnvoll ordnet“ und als Maßnahme in Kapitel 11.2 konkret der „Bau einer Parkgarage zur flächensparenden Anordnung der erforderlichen Stellplätze gefordert.“ Diese Sanierungsziele setzt der Bebauungsplan um.
Der Bebauungsplan mit seiner Freiflächenkonzeption verfolgt stringent das Konzept, die historische Zeilenbebauung als Ensemble prägendes Merkmal des historischen Industriealreals herauszuarbeiten und erlebbar zu machen. Der pauschalierte Vorwurf der unqualifizierten Freiflächenplanung spiegelt die subjektive Auffassung des Verfassers der Stellungnahme wieder. Die Stadt teilt diese Auffassung nicht.
Die Stadt sieht durch den vorliegenden Bebauungsplan eine qualifizierte Sicherung und vor allem Stärkung des historischen Charakters und gleichzeitig eine qualitativ hochwertige Freiflächengestaltung. Die überlieferte Gewerbe- und Industriebrache soll durch einen Rückbau von Zwischenbauten in ihrer historischen Zeilenstruktur wieder erlebbar gemacht werden; die geplante Entsiegelung wird die vorhandenen Grünflächen nahezu verdoppeln (+ 47 %).
|
|
Erschließung, Verkehr, Wegebeziehungen:
Neben einer attraktiven Sichtbeziehung von der Altstadt in das Hanfwerkeareal sowie der verkehrstechnischen Anbindung ist auch eine attraktive fußläufige Anbindung zwingend mit in die Überlegungen aufzunehmen.
Hierbei erscheint die Betrachtung des natürlichen Landschaftsraums mit Lech, Ufergehölz sowie einer möglichst natürlich in Erscheinung tretenden, begrünten Hangfußausbildung von besonderer Bedeutung.
In der weiteren Planung ist somit der Platzbedarf für eine attraktive fußläufige Erschließung inkl. der erforderlichen, zugehörigen Grundordnungsmaßnahmen mit darzustellen.
|
Die Erschließung des Grundstücks ist durch den neuen Erschließungskörper im Westen gesichert. Die ursprüngliche Planung, den alten Brückenübergang für den Fußgängerverkehr zu erhalten, wurde auf Wunsch des Landratsamtes und ein möglicher öffentlicher Lecherlebnisweg aufgrund fehlender finanzieller Mittel von Seiten der Stadt Füssen verworfen.
Die interne Erschließung sieht einerseits Anlieferungen der einzelnen Gewerbebetriebe mit dem Auto / Transporter / LKW vor, will das Quartier im Übrigen jedoch weitestgehend vom motorisierten Individualverkehr freihalten und die fußläufige Wegeverbindungen durch den Rückbau der Zwischenbauten und des Konzepts eines im Übrigen autofreien Quartiers stärken und ausbauen.
Die Planung sieht im Ergebnis aus der Sicht der Stadt Füssen eine nicht nur ausreichende, sondern deutlich gestärkte, attraktive fußläufige Erschließung vor.
|
|
Die in der Besprechung vom 05.04.2023 vereinbarte Reduktion bzw. grundsätzliche städtebaulich verträgliche Umstrukturierung der Parkierung ist nicht erfolgt. Aus der angegebenen Stellplatzermittlung, je 260 m2 sanierter BGF ein Stellplatz ist weder der rechnerisch ermittelte Bedarf dargelegt noch die Anzahl der erforderlichen Parkplätze ausgewiesen. Ebenso fehlt die Angabe wie die Parkhausgröße aus dem sich ergebenden Stellplatzbedarf ermittelt wurde und welche dezentralen Parkmöglichkeiten hier mitberücksichtigt wurden.
Die vorgesehene Regelung berücksichtigt nicht, den von der konkreten Nutzung abhängenden stark differenzierenden Stellplatzbedarf. Ein produzierender Gewerbebetrieb mit wenigen Beschäftigten hat bei gleicher Grundfläche einen ganz anderen Stellplatzbedarf, wie z.B. eine Gaststätte mit umfangreicher Außengastronomie.
Im Übrigen fehlt für diese Regelung im Bebauungsplan eine Rechtsgrundlage und ein sachgerechter Vollzug im Baugenehmigungsverfahren wäre nicht möglich. Im Baugenehmigungsverfahren wird bei Baumaßnahmen und Nutzungsänderungen nur der zusätzliche Stellplatzbedarf betrachtet. Eine Differenzierung, ob die den Stellplatzbedarf auslösende Maßnahme in einem sanierten, unsanierten, neugebauten oder auf einer Freifläche stattfindet, ist hier ohne Belang.
|
Beim genannten Scoping-Termin wurde keine Vereinbarung zur Reduktion des Mobilitätshubs getroffen. Es wurde vereinbart, die Situation nochmals städtebaulich zu prüfen und den Mobilitätshub nach Möglichkeit entsprechend zu reduzieren bzw. weiter nach Südwesten zu verlagern. Die angeregte Reduktion und Verlagerung des Mobilitätshubs in südwestliche Richtung wurde vom Stadtplanungsbüro OPLA nochmals geprüft. Wie bereits vorausgehend erläutert, ist dies aus Gründen des Denkmalschutzes, Blickbeziehungen und des zu sicherndes Gewerbes, insbesondere der bestandsgeschützten Nutzung im ehem. Faserzentrum, nicht möglich.
Die Zahl der notwendigen Stellplätze wurde anhand der zu erwartenden Nutzungen im Urbanen Gebiet und der Stellplatzsatzung der Stadt Füssen überschlägig ermittelt und läge ohne Berücksichtigung der geplanten Indoor-Nutzung allein bei ca. 380 Stellplätzen. Mit der Indoor Nutzung wird die Zahl der notwendigen Stellplätze um mehrere 100 ansteigen. Im Mobilitätshub nachgewiesen würden im best case ca. 360 Stellplätze untergebracht werden. Der Bebauungsplan schöpft mit seiner abweichenden Festsetzung zu den notwendigen Stellplätzen die Reduzierungsmöglichkeiten bereits vollständig aus. Der Einwand der Stellungnahme ist nicht nachvollziehbar.
Die Festsetzungsgrundlage für die Anzahl der notwendigen Stellplätze bietet Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB. Zutreffend ist, dass bei Nutzungsänderungen nur der zusätzliche Stellplatzbedarf nachzuweisen ist. Die Stellungnahme verkennt jedoch, dass zahlreiche bestehende Freiflächen-Stellplätze im Zuge der geplanten Neuordnung des Quartiers entfallen und zu ersetzen sein werden. Die Stadt Füssen kann im Übrigen bei der Festsetzung der Anzahl notwendiger Stellplätze bereits vorsorglich berücksichtigt werden, dass es zu Nutzungsänderungen baulicher Anlagen kommen kann und den damit einhergehenden Mehrbedarf an Stellplätzen schon im Vorhinein festlegen.
Des Weiteren steht die neue Zufahrt durch den verschwenkten Radweg in Abhängigkeit mit dem Mobilitätshub, da der zu versetzende Radweg zu Teilen über dem Mobilitätshub verlaufen muss.
|
|
Denkmalschutz:
Mit Bescheid vom 27.12.2016, Gz. 40-659/16 wird die Wiederöffnung des ohne denkmalrechtlich Erlaubnis verfüllten ehem. Triebkanals angeordnet. Auf die Aspekte wie der Triebkanal wieder anschaulich hergestellt werden kann, vgl. zahlreiche Vorbesprechungen, wird nicht eingegangen. Dieser Punkt ist noch fachlich und inhaltlich nachzuarbeiten. Vgl. hierzu Ergänzung zum Protokoll der Besprechung vom 05.04.2023;
" ... Von meiner Seite wurde nicht geäußert, dass über eine Überbauung des denkmalgeschützten Mühlgrabens gesprochen werden kann.
Korrekt ist, dass ich mitgeteilt habe, dass der Vollzug der Rückbauanordnung, im Einvernehmen mit […], seiner Zeit ausgesetzt wurde um die Situation anhand eines zeitnah zu erstellenden städtebaulichen Gesamtkonzeptes, das auch konkret auf die denkmalfachlichen Aspekte eingeht, ganzheitlich zu beurteilen. Erst auf Grundlage dieses Entwicklungskonzeptes und einer entsprechend geänderten Stellungnahme des BLfD kann dann seitens des LRA eine Neubeurteilung der Situation mit dem verfüllten Mühlbach und der angestrebten Planung erfolgen. ... "
Ohne die Abarbeitung und Klärung der vielfach vorbesprochenen Punkte erscheint die vorliegende Planung derzeit in Frage gestellt.
|
Beim gemeinsamen Scoping-Termin (05.04.2023) von der Vertreterin und dem Vertreter des Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege betont, dass der Mühlbachgraben nicht im Vordergrund stehe, wenn die städtebauliche Zeilenstruktur als Mehrwert gewonnen werde. Durch den geplanten Rückbau der Zwischenbauten sowie der strengen Grünordnung wird dieses städtebauliche Ziel eindeutig erreicht. Des Weiteren wurde beim gemeinsamen Scoping-Termin von Seiten des Landesamtes erklärt, dass der Mühlbachgraben unter Umständen auch auf einer nur begrenzten Länge von zwei bis drei Meter oder am Anfangspunkt (z.B. die Lecheinbuchtung mit 2-3 Meter unter der Brücke) und am Endpunkt (Rückgebäude Kesselhaus) präsentiert werden könne.
Im Gesprächsverlauf hat man sich auf die zwei Standorte Anfang- und Endpunkt verständigt.
Im städtebaulichen Masterplan, welcher beim Scoping-Termin erläutert wurde und Grundlage des Bebauungsplans darstellt, wurden die zwei Standorte zur historischen Würdigung „Lecheinbuchtung unter der Brücke“ und „Rückgebäude Kesselhaus“ dargestellt. An dieser Variante der historischen Würdigung hält der Grundstückseigentümer auch weiterhin fest. Um dieser Planung nochmals Nachdruck zu verleihen werden in der Planzeichnung die zwei Standorte durch Hinweise gekennzeichnet und in der Begründung genauer erläutert.
Eine Öffnung des Mühlgrabens steht zudem im Konflikt mit dem Mobilitätshub-Standort. Wie bereits vorausgehen erläutert, ist ein alternativer Standort für den Mobilitätshub nicht ohne Eingriffe in die Baudenkmäler oder das bestehende und zu haltende Gewerbe möglich.
Der Mühlgraben ist seit Anfang der 90er Jahre mit dem sogenannten Faserzentrum überbaut und im vorderen Bereich bereits seit 2016 verfüllt und als temporäre Erschließung genutzt, da die Bestandsbrücke nicht länger insbesondere für LKW tragfähig war. Die Stadt Füssen erkennt das denkmalfachliche Bestreben, den Mühlgraben wieder zu öffnen, durchaus an, stellt diesen Belang in der Gesamtabwägung mit dem primären Ziel einer Revitalisierung der Industriebrache und Neugestaltung der Freiflächen (Entsiegelung, möglichst autofreies Quartier) jedoch zurück. Die Neuordnung des ruhenden Verkehrs und der Bau einer Parkgarage zur flächensparenden Bündelung der notwenigen Stellplätze setzten die vom Stadtrat beschlossenen Sanierungsziele konsequent um (s. vorbereitende Untersuchungen F64 Kap. 10.4 und 11.2).
Aus Sicht der Stadt Füssen ist die Wiederherstellung des Status Quo ante, also einer Industriebrache mit einem wiedergeöffneten, trockengelegten Graben, die städtebaulich schlechteste Lösung. Die Stadt ist froh, dass ein privater Grundstückseigentümer – zumal in der aktuellen immobilienwirtschaftlichen Situation – bereit ist, mit erheblichen Kapitaleinsatz den heutigen Magnus-Park als städtebaulichen Missstand im Einklang mit den städtebaulichen und Sanierungszielen der Stadt Füssen zu entwickeln.
Es wird ebenso deutlich darauf hingewiesen, dass das bestandsgeschützte ehem. Faserzentrum – seinerseits ein Zeugnis bayerischer Industriegeschichte – einer Wiederherstellung des Mühlgrabens als durchgängiges Fließgewässer, entgegensteht.
Die Stellungnahme erweckt den unzutreffenden Eindruck, dass der Mühlbach als wasserführende Triebkanal wiederhergestellt werden könnte. Dieser wurde im Zuge der Errichtung des ehem. Faserzentrums – einem Förder- und Kooperationsprojekt von Bund, Freistaat Bayern und Land Baden-Württemberg – vor über 30 Jahren endgültig stillgelegt. Seitdem ist kein Fließgewässer mehr vorhanden. Lediglich im Falle eines Hochwassers, wurde der stillgelegte Mühlgraben geflutet. Seit dem letzten Hochwasser war der Mühlgraben nur noch eine Schmutzlache.
Das Faserzentrum ist Ende der 1980er Jahre aus Mitteln der Wirtschaftsförderung von Bund und Länder unter Einsatz des damaligen bayrischen Ministerpräsidenten gefördert worden und war Bestandteil einer Kooperation des Freistaats Bayern mit dem Land Baden-Württemberg. Das Faserzentrum sollte in Kooperation mit dem wissenschaftlichen Transferzentrum für nachwachsende Faserrohstoffe in Reutlingen Prozesse der Aufbereitung, der Spinnerei, des Webens, des Färbens und der Ausstattung untersuchen sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit praktischem Bezug für die industrielle Weiterverarbeitung der Flachsfaser im textilen und nichttextilen Bereich leisten (siehe etwa LT-Drs. Baden-Württemberg 10/2488, S. 7). Das Faserzentrum ist damit – wie der Magnus-Park insgesamt – ein Zeugnis bayrischer und baden-württembergischer Industriepolitik und des Niedergangs der deutschen Textilindustrie. Zugleich ist das ehem. Faserzentrum auch heute noch mit dem wichtigsten Ankermieter (Erhart GmbH, Werkzeug- und Gerätebau) des Magnus Park belegt. Eine nachhaltige und wirtschaftlich darstellbare Entwicklung des Quartiers kann nur mit Rücksicht auf die bestehenden Mieter gelingen. Ein Bestandschutz der bestehenden Mieter ist für den Stadtrat neben der Revitalisierung des Gesamtquartiers vorrangiges Planungsziel.
Eine Überbauung der Halle wurde vom Eigentümer geprüft, ist aber aus bautechnischen und statischen Gründen nicht wirtschaftlich darstellbar und wäre auch denkmalfachlich nicht adäquat. Die Anregung, den Mobilitätshub weitestgehend als Verlängerung an die südliche Gewerbehalle zu rücken, nähme der Gewerbehalle ihre zentrale Zufahrt sowie Aufstell- und Wendeflächen, die auch weiterhin jedenfalls für LKW von 7,5 bis jedenfalls 20 t gewährleistet bleiben müssen. Die vorgeschlagene Verortung würden zwar denkmalfachliche Belange noch weiter stärken, zugleich jedoch die Existenz bestandsgeschützter gewerblicher Nutzungen und einen Gewerbebetrieb mit über 50 Arbeitsplätzen, der aktuell Investitionen in Millionenhöhe tätigt, gefährden. Sie scheidet vor diesem Hintergrund aus.
|
|
Zur Beurteilung noch zu ergänzende Unterlagen:
Abschließend bleibt festzuhalten, dass der vorliegende Planungsentwurf wesentliche Punkte der Vorabstimmung nicht bearbeitet bzw. geklärt hat und auch die zur Verfügung gestellten Unterlagen keine fachlich inhaltliche Beurteilung ermöglichen.
Neben der Bearbeitung und Klärung der aufgeführten Punkte sind zumindest Geländeschnitte im Bereich der Zufahrt, des östlichen sowie westlichen Endes des geplanten Parkhauses erforderlich. In den Schnitten ist der Ansatz des Steilhangs zum Hutlerberg, inkl. schematischer Darstellung der Ensemblegebäude, die Tirolerstraße inkl. Stützwand, Gehweg und Absturzsicherung, die neuen Zufahrt, das Parkhaus sowie das Planungsareal bis zum Lech darzustellen.
Für die Feinabstimmung der Zufahrtssituation sowie aller weiteren Maßnahmen erscheint ein Geländeeinsatzmodell zur Überprüfung der städtebaulichen Überlegungen und Planungen als sehr geeignet und grundsätzlich erforderlich. Schnitte und 3D Darstellungen lassen eine sichere Beurteilung der schwierigen Zugangssituation nicht bzw. nur sehr bedingt zu. Gerade auch für die Einbindung der Öffentlichkeit in ein solch wichtiges Projekt ist ein Modell, dass der Öffentlichkeit im Rahmen der Beteiligung präsentiert wird, von Bedeutung.
|
Der vorliegende Planungsentwurf wurde auf der Grundlage der stattgefundenen Abstimmungen der Fachbehörden, Workshops und Bürgerbeteiligungen sowie auf der Grundlage der nachfolgend angeführten, vertieften Planungen erarbeitet.
Der Bereich der Zufahrt wurde mehrfach mit dem Staatlichen Bauamt abgestimmt. Hierfür wurde eine Vorplanung bis zur LPh 2 ausgearbeitet, um nachweisen und mit dem Staatlichen Bauamt abstimmen zu können, dass der neue Einmündungsbereich den Richtlinien des Straßenbaus entspricht.
Darüber hinaus wurde ein digitales Massenmodell mit Umgebung erarbeitet um die Kubatur des einzigen Neubaus (Mobilitätshub) neben der Zeilenerweiterung Süd beurteilen zu können. Dieses Massenmodell lässt das geplante Mobilitätshub in seiner Kubatur sehr viel besser beurteilen, als dies die vom Landratsamt eingeforderten Geländeschnitte täten.
Insbesondere auch für den Bereich der Zufahrtssituation wurde mit Schemaschnitten die Problematik der Höhenlagen überprüft.
|
|
Einzelne Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung
Bei Festsetzung eines Urbanen Gebiets im Rahmen eines Angebotsbebauungsplans für ein begrenztes Areal in Hand eines Projektträgers, sollte auf jeden Fall eine Feinsteuerung nach Art. 6a Abs. 4 BauNVO erfolgen und sich das angestrebte Mischungsverhältnis der Hauptnutzungen entsprechend niederschlagen. Sofern der Masterplan hier bereits eine entsprechende Differenzierung enthält, sollte diese im Bebauungsplan berücksichtigt werden.
Eine Regelung zu den einzelnen Nutzungsarten in einem städtebaulichen Vertrag im Rahmen eines Angebotsbebauungsplans ist nicht ausreichend. Dieser ist für Baugenehmigungsverfahren nicht bindend. Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit ergibt sich bei einem Angebotsbebauungsplan ausschließlich aus dessen Festsetzungen.
Regelungen auf vertraglicher Basis, die auch für das Baugenehmigungsverfahren bindend sind, können nur über einen Durchführungsvertrag als Teil eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans getroffen werden.
Beherbergungsbetriebe (z.B. Hotel) werden ausgeschlossen. Ein Ausschluss einer allgemein zulässigen Nutzung über § 1 Abs. 5 BauNVO stellt einen Grundzug der Planung dar, so dass eine spätere Zulassung im Einzelfall nicht über eine Befreiung im Rahmen von § 31 Abs. 2 BauGB möglich ist, vgl. BVerwG v. 01.11.1999 - 4 B 3/99 Nr. 4.
Ferienwohnung sind im geplanten Urbanen Gebiet zulässig, da diese in der Regel als sonstige Gewerbebetriebe gelten, vgl. § 13 a Satz 1 BauNVO.
|
Die Stadt Füssen weist darauf hin, dass immer noch die Stadt die Planungshoheit über die Bauleitplanung hat (Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG) und in eigener Verantwortung, unabhängig vom Projektträger, aber auch den Trägern öffentliche Belange die Baurechtssatzung des Bebauungsplanes festlegt.
Nachdem derzeit ein Nutzungscluster vorhanden ist und auch weiter angestrebt wird, das dem Gebietscharakter des urbanen Gebietes (MU) entspricht, gibt es für die Stadt keine weitere Veranlassung einer Feinsteuerung. Eine Nutzungsmischung muss in einem Urbanen Gebiet – anders als in einem Mischgebiet – nicht zwingend gesichert werden (§ 6a Abs. 1 Satz 2 BauNVO).
Es ist derzeit nicht beabsichtigt, im städtebaulichen Vertrag die Zulässigkeiten des MU noch weiter zu präzisieren und zu gliedern, hierfür liegt weder ein städtebaulicher Grund noch eine kommunale Erforderlichkeit vor.
Die Stadt Füssen hat im Vorfeld der Aufstellung des Bebauungsplanes die Vor- und Nachteile eines Angebotsbebauungsplanes im Vergleich zu einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan intensiv diskutiert und abgewogen.
Nachdem es sich bei dem Planvorhaben nicht um einen klassischen „Grüne-Wiese-Bebauungsplan“ handelt, bei dem im Wesentlichen neues Baurecht geschaffen wird, sondern mit Ausnahme des Mobilitätshubs eine Gewerbe- und Industriebrache als Bestand überplant und unter sensiblem Umgang mit den vorhandenen Bestandsnutzern revitalisiert werden soll, erscheint ein vorhabenbezogener Bebauungsplan nicht zielführend. Der Angebotsbebauung sieht hinreichende Festsetzungen vor, um in diesem Zusammenhang die denkmalschutzwürdigen Zeilen zu sichern und zur erhalten
Der Bebauungsplanentwurf sieht bislang einen Ausschluss des Beherbergungsgewerbes vor. Der Stadtrat der Stadt Füssen mit seinem Beschluss zur Billigung des Vorentwurfs in Aussicht gestellt, dass in Ausnahme von diesem Grundsatz Hotelnutzungen die eine bislang nicht besetzte Nische und Lücke im bestehenden Angebot der Stadt Füssen besetzten könnten (z. B. Familienhotel in Verbindung mit Indoor-Freizeitnutzungen oder Sporthotel für Leistungssportler) vorstellbar wären. Insbesondere Indoor-Freizeiteinrichtungen wären für die Stadt Füssen und ihren Nachbarkommunen eine große Bereicherung. Der Eigentümer ist aufgefordert, hierzu konkrete Konzepte vorzulegen. Diese werden mit der Füssen Tourismus untersucht und abgestimmt.
Die Stadt Füssen dankt im Übrigen für die Anregung zu den Ferienwohnungen, und wird diese bauplanungsrechtlich ausschließen
|
|
Maß der baulichen Nutzung:
Die geplante Regelung zur Höhe des Parkhauses ist unzureichend. Oberer Bezugspunkt für die Höhe des Parkhauses soll die Oberkante der Fahrbahn der Bundesstraße B 17 sein. Die Lage des oberen Bezugspunkts auf der Bundesstraße B 17 wird aber nicht angegeben. Ist oberer Bezugspunkt für die Höhe des Parkhauses die nördliche Außenwand oder die südliche Außenwand? Die Bundesstraße B 17 steigt im Bereich des Baufensters um ca. 4,5 m. Die Gebäudehöhe des Parkhauses sollte entweder wie bei den übrigen Gebäuden über eine Gesamthöhe mit definiertem unterem Bezugspunkt (z.B. OK FB EG üNN) oder eine für das Gesamtgebäude geltende Höhe üNN geregelt werden. Auf die denkmalrechtlichen und städtebaulichen Belange bzgl. der möglichen Positionierung und Dimensionierung eines Parkhauses wird nochmals hingewiesen.
|
Die Sinnhaftigkeit der Festsetzung zur Höhe des Mobilitätshubs ist aus Sicht der Stadt gegeben. Die Oberkante Dachhaut des Mobilitätshubs soll nicht die Oberkante der Fahrbahn der B 17 überschreiten, diese Festsetzung wird noch rechtsbestimmt und rechtsklar umformuliert
|
|
Überbaubare Grundstücksflächen:
Die Regelung im letzten Satz von § 3 Abs. 2 Nr. 1 der textlichen Festsetzungen ist unklar. Auf der Nordseite des Baufelds B 2.1 schließt sich das Baufeld 2.4 an. Es gibt also für das Baufeld 2.1 keine nördlichen Baulinie. Im Übrigen ist auch der Mittelbau ein Baudenkmal, so dass ein Rückbau von Außenwänden grundsätzlich ausscheidet.
|
Wenn man sich die Planzeichnung genauer anschaut, hat das Baufeld 2.1 (gesamter Mittelbau von Westen bis zum im Osten liegenden Baufeld 2.4) eine nördliche Baulinie, welche im Bereich des Laborgebäudes (BF 7) unterbrochen wird. Von dieser Baulinie darf aufgrund des Gebäudeversatzes um bis zu 2,0 m abgewichen werden. Ziel ist hierbei, insbesondere im Bereich des mittleren Zwischenbaus Flexibilität einzuräumen. Zum derzeitigen Stand kann nicht abschließend geklärt werden, wo nach dem Rückbau der Zwischenbauten der exakte Wandverlauf liegen wird und wie damit der Gebäudeverlauf fortgeführt wird. Die Stadt möchte zudem darauf hinweisen, dass der Mittelbau nicht im Gesamten unter Denkmalschutz steht. Bei dem westlichen Gebäudeteil (im nachfolgenden Bild mit roter Dachfläche erkennbar) steht lediglich die Fassade unter Denkmalschutz, während der östliche Gebäudeteil (im Bild rosa markiert) ein Gesamtdenkmal darstellt.
 Die Regelung im letzten Satz von § 3 Abs. 2 Nr. 1 der textlichen Festsetzungen soll eben diese Flexibilität zulassen.
|
|
Gestaltungsregelungen:
Trotz der Tatsache, dass im Geltungsbereich bedeutende Baudenkmäler vorhanden sind und sich entsprechende Baudenkmäler im unmittelbare Umfeld befinden (siehe oben) enthält der Bebauungsplan wenig konkrete Regelung zur Baugestaltung. Zwar ist für Maßnahmen an Baudenkmäler eine denkmalrechtliche Erlaubnis erforderlich und wegen der unmittelbaren Denkmalnähe in der Regel auch für die nicht unter Denkmalschutz stehenden Gebäude, dennoch sollte der Bebauungsplan Regelungen enthalten, die die denkmalfachlichen Anforderungen berücksichtigen.
Die Regelung zur Fassadengestaltung sowie zu den Dacheindeckungen ist diesbezüglich zu wenig aussagekräftig. Es handelt sich um Regelungen, die in jedem beliebigen Neubaugebiet üblich sind.
Hier sind auf die denkmalfachlichen Belange abgestimmte Festsetzungen zur Fassadengestaltung, den Materialien und Farben der Dacheindeckung sowie der Anordnung von Dachaufbauten inkl. Solarenergieanlagen zu treffen.
|
Die Stadt Füssen sieht keinen Grund darin konkretere Festsetzungen zur Dachfarbe, Materialität, Fassadengestaltung oder der Anordnung von Dachaufbauten inkl. Solarenergieanlagen zu treffen. Grund dafür ist die ohnehin, wie in der Stellungnahme beschrieben, notwendige denkmalrechtliche Erlaubnis (Art. 6 DSchG). Die Stadt wie auch der Grundstückseigentümer erachten es als zielführender, die einzelnen Bausteine (Gebäudeteile) bei konkreten Maßnahmen in enger Abstimmung mit dem BLfD zu planen. Hinzukommt, dass aktuell nicht absehbar ist, was nach dem Rückbau der Zwischenbauten zum Vorschein kommen wird. Bei der Dachfarbe ist bereits jetzt ein Mix aus braunen, rotbraunen und grauem Farbspektrum vorhanden.
Bzgl. der Dachaufbauten insb. der Solarenergieanlagen wird keine Festsetzung getroffen, da sich der Stand der Technik über die nächsten Jahre hinweg durchaus ändern kann. Auch insoweit wird im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren eine Abstimmung mit dem BLfD vorzunehmen sein.
Selbst das BLfD hat vor diesem Hintergrund keine weitergehenden Festsetzungen eingefordert.
|
|
Auch die Regelung zur den Werbeanlagen unter § 11 Abs. 3 Nr. 2 der textlichen Festsetzungen lässt keine Berücksichtigung von denkmalfachlichen Belangen erkennen.
In den Regelungen zur Baugestaltung und zu den Werbeanlagen sollte in Hinblick auf die Verfahrensfreiheit (vgl. Art. 57 Abs 1 Nr. 11 Buchstabe e, Art. 57 Abs. 1 Nr. 12 Buchstabe c und Art. 57 Abs. 2 Nr. 6 BayBO) auf die denkmalrechtliche Erlaubnispflicht hingewiesen werden.
|
Wie in der Satzung unter § 11 Abs. 3 Nr. 1 zu erkennen ist, sind Werbeanlagen an denkmalgeschützten Anlagen nicht zulässig. Soweit die Stellungnahme ausführt, dass denkmalfachliche Belange nicht berücksichtigt würden, ist dies schlichtweg falsch.
Ein Hinweis auf gesetzliche Regelungen, die auch ohne Hinweis gelten und von der Baugenehmigungsbehörde zu beachten sind, bietet aus Sicht der Stadt keinen Mehrwert.
|
|
Es werden neben Flachdächern auch geneigte Dächer in Form von Sattel-, Walm- und Zeltdächer zugelassen. Auf die Festsetzung von zulässigen Dachneigungen wird mit dem Hinweis verzichtet, dass sich diese aus der Wandhöhe und Gesamthöhe ergibt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass z.B. beim Baufeld 4 die Festsetzung einer Wandhöhe fehlt und es sich bei den festgesetzten Wandhöhen um Maximalhöhen handelt. Wird also ein Gebäude ersetzt und die zulässige Wandhöhe nicht ausgenutzt, können sich vom Bestand erheblich abweichende Dachneigungen ergeben. Die vorhandenen Dachneigungen sind aufzunehmen und entsprechende Regelungen zu treffen.
|
Die Stellungnahme verkennt, dass im denkmalgeschützten Bestand die genannten Dachformen mit stark unterschiedlichen Dachneigungen vorhanden sind. Der Stellungnahme wird insoweit Rechnung getragen, als für die drei historischen Zeilenbauten eine max. Dachneigung (abgeleitet aus dem Bestand) festgesetzt wird.
|
|
In den textlichen Festsetzungen ist lediglich die maximal zulässige Fläche für Terrassen, insbesondere auch Außenbewirtschaftungsflächen getroffen. Regelung zur Gestaltung dieser Bereiche enthält der Bebauungsplan nicht. Gerade für die in der Planzeichnung als Außengastronomiefläche A 1 bezeichnete Fläche nördlich des Lechbaus sind konkrete Regelung erforderlich. Diese Außenbewirtschaftungsfläche befindet sich an exponierte Lage mit direktem Sichtbezug vom und zum Kloster St. Mang etc.
In diesem Bereich ist die ehemals vorhandene Eingrünung wieder herzustellen und für die Außengastronomiefläche sind Gestaltungsregelungen (z.B. Bodenbelag, keine festen Überdachungen, keine Nebengebäude zur Bewirtung etc.) zu treffen, die den denkmalfachlichen Belangen Rechnung tragen.
|
Die Stellungnahme unterstellt einen konkreten Vorhabenbezug, den es vorliegend nicht gibt. Die Stadt stellt bewusst einen Angebotsbebauungsplan auf (siehe schon oben).
Die immer wieder angeführten Sichtbeziehungen sind im Frühjahr, Sommer und Frühherbst nicht uneingeschränkt, wie behauptet, vorhanden. Die großen Gehölzstrukturen entlang beider Lechseiten grenzen diese enorm ein. Durch die wieder geforderte Eingrünung, ostwestlich des Lechbaus, würde eine Sichtbeziehung weiter eingeschränkt werden.
Der jetzige Zustand der Außenbereichsflächen der Gewerbe- und Industriebrache mit ihrer weitgehenden Flächenversiegelung, ist nicht einladend und wird durch die geplante Revitalisierung, Flächenentsiegelung und Freianlagengestaltung in jeglicher Hinsicht verbessert. Die Stadt Füssen sieht es daher nicht als notwendig an, auf Ebene des Bebauungsplans die Außenbewirtschaftungsfläche durch Gestaltungsfestsetzungen zu regulieren. Dies kann auch noch auf Ebene des Baugenehmigungsverfahrens im Rahmen der Abstimmung mit dem BLfD erfolgen.
|
|
Regelung zum Abstandsflächenrecht:
Nach § 3 Abs. 3 sollen die Abstandsflächenvorschriften des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO keine Anwendung finden. Bestimmt werden sollen die Abstandsflächen durch die festgesetzten Baulinien, Baugrenzen sowie die Regelungen zu den Wand- und Gebäudehöhen. Auf Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO wird verwiesen. Werden Regelungen getroffen, die zu einer Unterschreitung der gesetzlichen Regelabstandsflächen führen, bedarf es hier im Bebauungsplan einer dezidierten Auseinandersetzung mit der Thematik Brandschutz, Belichtung, Besonnung, Teilhabe am sozialen Umfeld. Eine sachgerechte Abarbeitung setzt auch voraus, dass die zulässige Art der baulichen Nutzung berücksichtigt wird. So stellt ein gewerblicher Lagerraum andere Anforderung, als ein Aufenthaltsraum einer Wohnung.
|
Bei der vorliegenden Bauleitplanung handelt es sich primär um die Revitalisierung der historischen Industriebrache. Ziel ist es, die Zwischenbauten zurückzubauen, um die historischen Zeilenbauten wieder erlebbar zu machen. Die Schutzzwecke der Abstandsflächenvorschriften, namentlich eine hinreichende Belichtung, Belüftung, Besonnung und Sozialstand, werden sämtlich durch den geplanten Rückbau der Zwischenbauten gegenüber dem Status quo verbessert. Die Stadt Füssen weist erneut darauf hin, dass es sich im Wesentlichen um eine bestandgeschützte, in Teilen sogar um eine denkmalgeschützte Bebauung handelt.
Der Bestand wird lediglich an zwei Stellen geringfügig erweitert. Eine der Erweiterungen befindet sich östlich des Südbaus, diese wird zweigeschossig vom BLfD mitgetragen. Der Abstand zum nördlichen Gebäude beträgt ca. 25 m. Zur südlichen Bestandshalle ca. 7,0 m.
Bei einer max. zulässigen Gesamthöhe des Neubaus (östlicher Teilbereich des BF 3.4) von 9,5 m und einer max. Gesamthöhe des nördlichen Mittelbaus (BF 2.1) von 21 m, ergeben sich keine Überscheidungen bei den Abstandsflächen zwischen Süd und Mittelbau. Ebenso gibt es zur südlichen Bestandshalle keine Abstandsflächenüberscheidungen.
Der zweite Neubau, das Mobilitätshub, wird in Teilbereichen direkt an die Stützwand der Tiroler Straße gebaut und ist in seiner Höhenentwicklung begrenzt auf die OK Fahrbahn (Fuß- und Radweg) der Tiroler Straße. Eine Beeinträchtigung (Verschattung) der südlichen Wohngebäude ist nicht gegeben. Nördlich des Mobilitätshubs befinden sich Erschließungs- und Freiflächen. Es kommt auch hier zu keinen Abstandsflächenüberscheidungen.
|
|
Begründung zum Bebauungsplan
In der Begründung sind die Ziele und Zwecke des Bebauungsplans, sowie seine Auswirkungen darzulegen. Mit der Begründungspflicht soll sichergestellt werden, dass die städtebauliche Rechtfertigung und Erforderlichkeit sowie die Grundlagen der Abwägung in ihren zentralen Punkten dargestellt werden.
In der Fortschreibung der Begründung im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wird auf die oben genannten Ausführungen verwiesen und es sind folgende Punkte zu berücksichtigen bzw. ist die Auseinandersetzung mit folgenden Fragestellungen angezeigt:
- Welche grünordnerische Maßnahmen wurden getroffen um eine Stärkung der städtebaulichen und denkmalfachlichen Qualität zu erhalten? Bisher ist das aus dem Vorentwurf der Begründung und dem Vorentwurf der Planung nicht ersichtlich. Es muss eine dezidierte Abarbeitung der augenscheinlichen Problemfelder, Zufahrt, Straßenführung, Landschaftsraum, Sichtbeziehungen und Topografie erfolgen.
- Es ist darzulegen wie durch den Bebauungsplan und seine Umsetzung das Ensemble und das Kloster St. Mang, der Landschaftsraum Lech und der Kalvarienberg gestärkt werden. Hierzu findet sich im Vorentwurf noch keine konkrete Aussage. Im Gegenteil ist eine weitere und weitreichende Verunstaltung der vorgefundenen Strukturen durch das Parkhaus zu befürchten.
- Insbesondere bei den gestalterischen Festsetzungen ist darauf einzugehen, wie hier die denkmalfachlichen Anforderungen berücksichtigt wurden.
- Es ist darzulegen, welche Bauabschnitte in welchem zeitlichen Rahmen (Inhalt Masterplan?) vorgesehen sind.
|
Der Stadt Füssen ist bekannt, dass die Begründung die Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes darlegt.
Die Begründung wird in Teilen ergänzt und fortgeschrieben. Die Stadt weist erneut darauf hin, dass der Bebauungsplan – vom Mobilitätshub abgesehen – eine Gewerbe- und Industriebrache im baulichen Bestand überplant. Insbesondere weist die Stadt darauf hin, dass durch den festgesetzten Rückbau der Zwischen- und Anbauten der Zeilenbauten sowohl eine immense städtebauliche und denkmalschutzfachliche Qualität erzielt wird.
Die Stellungnahme verschließt die Augen vor dem aktuellen Zustand der Industriebrache, die durch den Bebauungsplan und der anspruchsvollen Freianlagengestaltung sowie das Herausstellen der Zeilenbebauung der Industriedenkmäler und das Konzept eines möglichst weitgehend Kfz-freien Quartiers erheblich verbessert werden wird.
Den Belangen der Denkmalpflege wird durch das Herausarbeiten der historischen Zeilenbebauung nebst unterstützenden Festsetzungen zur Grünordnung und durch diverse Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung angemessen Rechnung getragen. Auch das BLfD fordert keine weitergehenden gestalterischen Festsetzungen. Die Belange des Denkmalschutzes werden im Rahmen der konkreten Bauanträge abgestimmt.
Es wird kein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt, der konkrete Durchführungsfristen fordert. Im Gegenteil soll der Angebotsbebauungsplan eine behutsame Transformation unter Rücksichtnahme auf die über 100 vorhandenen Mieter des Magnus Parks ermöglicht werden.
|
|
Art des Bebauungsplans:
Für das Projekt, das in der Hand eines Projektträger liegt, würde sich ein vorhabenbezogener Bebauungsplan nach § 12 BauGB anbieten. Sollten einzelne (Teil-)Vorhaben des Projekts noch keinen solchen Verfahrensstand erreicht haben, das hierzu schon umfassende Vorhabenspläne erstellt werden können, wäre es möglich im Rahmen von § 12 Abs. 3a BauGB wie beim derzeit vorgesehenen Angebotsbebauungsplan ein Urbanes Gebiet festzusetzen. Der Projekt / Vorhabenträger müsste sich im Durchführungsvertrag zur Realisierung der darin beschriebenen Vorhaben verpflichten. Dies hätte den Vorteil, dass die Stadt für einzelne Teilbereiche bestimmte Nutzungen zuweisen könnte und z. B. auch Regelungen zum Parkhaus, sowie der Bau- und Freiraumgestaltung getroffen werden könnten. Die Realisierungszeiträume könnten festgelegt und der Bebauungsplan bei Nichtrealisierung ohne die Gefahr eines Planungsschadens aufgehoben werden, vgl. § 12 Abs. 6 Satz 1 BauGB.
Der Durchführungsvertrag hätte diesbezüglich auch Regelungscharakter im Baugenehmigungsverfahren. Zulässig wären demnach Vorhaben, die den Vorgaben des Bebauungsplans entsprechen und zusätzlich der im Durchführungsvertrag vereinbarten Regelungen.
Sollte sich im Rahmen der Realisierung zeigen, dass einzelne Vorhaben nicht wie geplant realisiert werden sollen oder können, bedarf es, sofern die Bestimmung des Bebauungsplans eingehalten werden, keiner Bebauungsplanänderung, sondern lediglich einer Änderung der Realisierungsverpflichtung im Durchführungsvertrag. Dies würde für die Stadt Rechtssicherheit (die Stadt bekommt das, was im Durchführungsvertrag steht) schaffen und dennoch eine Flexibilität zur Projektanpassung ermöglichen.
|
Die Stadt Füssen hat sich zur Wahl der Verfahrensart eingehend Gedanken gemacht und bewusst für einen Angebotsbebauungsplan entschieden. Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan mit einem starren Plankonzept (Vorhaben- und Erschließungsplan) und denknotwendig harten Durchführungsfristen könnte dem bauleitplanerischen Ziel einer behutsamen Transformation des Magnus-Park unter Rücksicht auf die über 100 im Bestand vorhandenen Nutzer und Mieter der Bestandsgebäude nicht angemessen Rechnung tragen.
Darüber hinaus und abgesehen von dem anscheinen kritisch bewerteten Mobilitätshub geht es in dem Bebauungsplan um Rückbau und im Wesentlichen darum, die Nutzungsbrache im Bestand nach Sanierung zu revitalisieren.
Hier ist der Stadt Füssen mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht gedient, im Gegenteil, nachdem der Eigentümer erst Nutzer aus dem Nutzungsspektrum, das erläutert wurde, finden und die Belegung im Bestand verteilen muss, wäre ein vorhabenbezogener Bebauungsplan, der insbesondere die Nutzungen feinteilig steuert, gänzlich das falsche Instrument, mit dem Ergebnis, dass die Stadt permanenten Änderungsbedarf hat und Bauleitplanungen für Satzungsänderungen durchführen müsste.
Die Stadt dankt für die kritische Anmerkung, behält sich aber vor, ihre Planungshoheit als Kern der kommunalen Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 GG), auch zur Wahl der Verfahrensart, selbst auszuüben.
|
|
|
|
Der Bebauungsplanvorentwurf wird entsprechend der fachlichen Würdigung/ Abwägung redaktionell um die Standorte der historischen Würdigung ergänzt. Die Begründung wird zudem fortgeschrieben und die Höhenfestsetzung des Mobilitätshubs wird rechtsredaktionell überarbeitet. Der Bebauungsplanvorentwurf wird dahingehen geändert, dass eine max. Dachneigung bei den historischen Zeilenbauten festgesetzt wird und Ferienwohnungen ausgeschlossen werden.
|
|
|
- LRA Ostallgäu - Untere Wasserrechtsbehörde
|
|
- Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage.
|
|
|
Das überplante Gebiet befindet sich teilweise innerhalb eines festgesetzten Überschwemmungsbereichs des Lech. Im östlichen Bereich des Geländes ist ein "Mobilitätshub" genanntes Parkhaus geplant. Genau an dieser Stelle wird das Ü-Gebiet tangiert.
Laut Verordnung des Landratsamtes Ostallgäu über das Überschwemmungsgebiet am Lech vom 11.01.2021 ist gemäß § 78 Abs. 1, Wasserhaushaltsgesetz WHG die Ausweisung neuer Baugebiete und die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen in festgesetzten Überschwemmungsgebieten untersagt!
Das Landratsamt Ostallgäu kann jedoch unter den Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 und Abs. 5 WHG Ausnahmen zulassen.
In der Begründung wird auf die Thematik insofern eingegangen, als dass beschrieben wird, wie der, mit der Bebauung einhergehende Retentionsraumverlust kompensiert werden soll. Berechnungen dazu fehlen. Aussagen zu einer hochwasserangepassten Bauweise werden nicht getroffen.
Die Untere Wasserrechtsbehörde kann vom repressiven Bauleitplanungsverbot des § 78 Abs. 1 Satz 1 WHG eine Ausnahmegenehmigung erteilen, wenn
- keine anderen Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung bestehen oder geschaffen werden können,
- das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar an ein bestehendes Baugebiet angrenzt,
- eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche Sachschäden nicht zu erwarten sind,
- der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstandes nicht nachteilig beeinflusst werden,
- die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und der Verlust von verlorengehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird,
- der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird,
- keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger zu erwarten sind,
- die Belange der Hochwasservorsorge beachtet sind und
- die Bauvorhaben so errichtet werden, dass bei dem Bemessungshochwasser nach § 76 Absatz 2 Satz 1, das der Festsetzung des Überschwemmungsgebietes zugrunde liegt, keine baulichen Schäden zu erwarten sind. Bei der Prüfung der Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 3 bis 8 sind auch die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksichtigen.
Die Berechnung zum Retentionsausgleich mit der ein Nachweis erbracht wird, dass der Verlust von verlorengehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird sowie Erläuterungen zu fehlenden Alternativstandorten und eventuelle Auswirkungen auf dritte, wie auch Angaben zu einer hochwasserangepassten Bauweise wurden bislang nach unserem Kenntnisstand nicht ausreichend durchgeführt/formuliert.
Die angesprochenen Aspekte sind in die Planung einzuarbeiten und mit dem Wasserwirtschaftsamt KE abzustimmen, welches als amtlicher Sachverständiger tätig wird und ein fachliches Gutachten mit wasserwirtschaftlichen Vorgaben und Empfehlungen erstellt.
Für Einzelbauvorhaben wird ein wasserrechtliches Verfahren nach § 78 Abs. 5 WHG durchzuführen sein.
|
Die Stadt Füssen dankt für den Hinweis. Die Stellungnahme verkennt allerdings, dass § 78 Abs. 1 WHG nur für die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich ein Verbot ausspricht. Vorliegend wird ein Innenbereich überplant. Für diesen Fall besteht nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung kein Planverbot (BVerwG, Urt. v. 03.06.2014, 4 CN 6/12; BayVGH, Beschl. v. 09.01.2019, 8 ZB 18.2119, BeckRS Rn. 10). Auf die Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 und Abs. 5 WHG kommt es damit nicht an.
Bei Überplanung im Innenbereich sind die Belange des Hochwasserschutzes aber selbstredend im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB). Dies ist erfolgt.
Der Retentionsraumausgleich wurde durch ein Fachplanungsbüro geprüft und mit dem WWA Kempten abgestimmt worden. Das WWA Kempten hat mit E-Mail vom 05.02.2024 nochmals bestätigt, dass der geplante Retentionsraumausgleich unterhalb des ehem. Faserzentrums aus wasserrechtlicher Sicht als genehmigungsfähig angesehen wird. Die Stadt Füssen macht sich diese Einschätzung zu eigen.
Die Herstellung des Retentionsraumausgleichs kann im städtebaulichen Vertrag vor Satzungsbeschluss sichergestellt werden. Die Belange des Hochwasserschutzes sind damit angemessen berücksichtigt.
|
|
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplanvorentwurfs.
|
|
|
- LRA Ostallgäu - Untere Naturschutzbehörde
|
|
- Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können (z. B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen).
|
Einleitend weist die Stadt Füssen auf ihre bauleitplanerischen Ziele hin:
Der städtebauliche Masterplan sowie der daraus entwickelte Bebauungsplan haben gemeinsam das Hauptziel, die bestehende historische Bebauung zu sichern und als solche wieder erlebbar zu machen. Als Ergänzung zum Bestand soll zudem der „Südbau“ in seiner Zeilenstruktur bis auf die Höhe des Lechbaus verlängert werden, wodurch die neue Platzgestaltung beim Eingang des Magnus Parks städtebaulich hervorgehoben wird. Eine strenge Grünordnung betont zudem die Zeilenbebauung. Die notwendigen und öffentlichen Stellplätze sollten nach bisheriger Planung in einem zentralen Mobilitätshub untergebracht werden, sodass das historische Ensemble durch den ruhenden Verkehr nicht beeinträchtigt wird und ein weitestgehend autofreies Quartier mit hochwertiger Freianlagen entstehen kann.
Nachfolgende städtebauliche Ziele und Maßnahmen sind für die Revitalisierung der historischen Industriebrache notwendig, geplant und konzeptionell festgehalten:
In den neugewonnen Nord- und Süd-Passagen wird durch Rückbau und Entsiegelung eine strenge Grünordnung in der Freiflächengestaltung die Zeilenbebauung aufgegriffen und betont. Die geplanten Grünflächen sollen einen Urbanen Charakter erhalten. Dafür sind die grünordnerischen Freiflächen mit einem Rasen anzusäen und mit Gehölzen in einem alleenartigen Charakter zu bepflanzen.
Das Plangebiet liegt zwischen Lech im Norden und dem Hutlersberg im Süden. Das zukünftige urbane Gebiet soll sich in dieses atemberaubende Naturgefüge nicht nur städtebaulich, sondern auch landschaftlich einfügen. Während im Inneren des Quartiers, den Nord- und Süd-Passagen sowie dem neuen Eingangsbereich eine strenge Freiflächengestaltung geplant ist, ist in den Randbereichen des Quartiers eine aufgelockerte Grünordnung als Übergang zum natürlich bewachsenem Berghang und dem Uferbereich des Lechs geplant. Im Süden des Grundstücks besteht bereits eine Böschung zur Stützwand der Tiroler Straße, welche durch unterschiedliche Gehölze intensiv eingegrünt ist. Entlang des Lechlaufs hingegen sind bis zur Lechmauer (Hochwasserschutz) auf dem Grundstück derzeit keine hochwertigen Grünstrukturen vorhanden. Hier sind künftig neue grünordnerischen Freiflächen geplant, welche als extensive Wiesenflächen anzulegen und mit Gehölzen und Sträuchern in Gruppen zu bepflanzen sind.
Durch diese Maßnahmen werden ein natürlicher Übergang und Puffer vom zukünftigen urbanen Gebiet zum bestehenden Lechufer geschaffen.
Die Flächenauswertung zeigt zudem deutlich auf, in welchem Ausmaß die Freiflächengestaltung das Quartier ökologisch, nachhaltig und landschaftlich aufwerten wird. Der derzeitige Bestand an Grünflächen beläuft sich auf ca. 13.889 m² und entspricht ca. 24 % der Gesamtfläche. Durch die Neuplanung werden Grünflächen von ca. 20.412 m² geschaffen, das entspricht fast einer Verdoppelung zum Bestand (ca. +47%). Die neue Planung wird eine Grünfläche von ca. 20.412 m², ca. 35 % der Gesamtfläche aufweisen. Die geplante Flächenentsiegelung ermöglicht eine hochwertige Freianlagengestaltung, die nicht nur naturschutzfachlich und artenschutzrechtlich eine deutliche Aufwertung des status quo darstellt, sondern auch städtebaulich und denkmalfachlich eine dem Ensemble angemessene Landschaftsästhetik schafft.
|
|
Satzung
8 Grünordnung
Ziff. 2: Für die Ansaat von blütenreichen Wiesen ist autochthones Saatgut aus dem Herkunftsgebiet 17 Alpenvorland zu verwenden. Bei der extensiven Bewirtschaftung ist weder Düngung noch chemischer Pflanzenschutz zulässig.
9 Artenschutzrechtliche Maßnahmen
Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen ist eine artenschutzrechtliche Vorprüfung mit Darstellung von CEF Maßnahmen durchzuführen. Diese ist Bestandteil der Bauleitplanung und ist nachzureichen. Für den Abriss der Gebäude ist eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung der Regierung von Schwaben notwendig.
|
Für die Neuherstellung von blütenreichen Wiesen wird das angeregte Saatgut mit festgesetzt. Der Stellungnahme ist damit Rechnung getragen.
Aufgrund der Anregung erfolgt eine artenschutzrechtliche Vorprüfung. Sollte sich aus dieser Relevanzprüfung das Erfordernis einer saP ergeben, wird diese vor Satzungsbeschluss durchgeführt. Sollten hieraus CEF-Maßnahmen oder andere Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden, werden diese in einem städtebaulichen Vertrag vor Satzungsbeschluss verbindlich geregelt. Ob eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung für den geplanten Rückbau der Zwischenbauten erforderlich wird, ist derzeit offen und zu prüfen. Der Rückbau der Gebäude und das damit verbundene Erfordernis einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung betreffen den Vollzug des Bebauungsplans.
Ungeachtet dessen erlaubt sich die Stadt Füssen darauf hinzuweisen, dass es sich beim Magnus Park um eine Industriebrache handelt, die zu Teilen wieder mit Nutzungen belegt werden konnte, und im Freiflächenbereich zu einem hohen Anteil versiegelt ist.
Das Gewerbe- und Industriegebiet ist aktuell weitestgehend durch bauliche Anlagen oder Erschließungsflächen versiegelt. Durch den Rückbau der Zwischenbauten und die festgesetzte Grünordnung werden die Freiflächen erheblich ökologisch und landschaftsästhetisch entsprechend aufgewertet. Durch die geplanten Maßnahmen werden im Vergleich zum Bestand voraussichtlich ca. 6.523 m² mehr an Grünflächen geschaffen. Die Entsiegelung führt nahezu zu einer Verdoppelung der Freiflächen (+ 47 %).
Der Naturraum des Uferbereichs am Lech ist nicht Gegenstand der Planung. Die bestehenden Gehölzstrukturen liegen hinter der Lechmauer (Hochwasserschutz) und werden durch die geplante Revitalisierung der Gebäude nicht beeinträchtigt. Der Bebauungsplan tangiert den Uferbereich des Lechs nicht.
Der Bebauungsplan setzt unter § 8 Grünordnung das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie die Herstellung von natürlicher Vegetationsflächen / extensiver Wiesenflächen fest. Unter § 9 werden artenschutzrechtliche Maßnahmen für ein mögliches Fledermausvorkommen festsetzt. Im Nordwesten liegen der Naturraum und Uferbereich des Lechs sowie im Süden der mit Gehölzen bewachsene Hang. In beide wird nicht eingegriffen. Sie bieten für Vögel und Amphibien einen attraktiven Lebensraum.
Soweit sich aus der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung und einer ggf. ergänzend erforderlichen saP die Notzwendigkeit ergänzender artenschutzrechtlicher Maßnahmen ergibt, werden diese insbesondere vertraglich sichergestellt.
|
|
Begründung
6.1 Schutzgebiete:
Bei dem widerrechtlich verfüllten Kanal handelt es sich um einen erheblichen Eingriff gem. § 14 Abs 2 BNatSchG. Zumal es einen Lebensraum für Makrozoobenthos, Insekten und temporär auch für Fische darstellt. Nach § 39 Abs. 1 Ziff. 3 BNatSchG ist es verboten, Lebensstätten zu zerstören. Deshalb ist das Gewässer wiederherzustellen und zu öffnen. Die Planung ist entsprechend abzuändern und anzupassen.
|
Der Mühlbach wurde im Zuge der Errichtung des ehem. Faserzentrums – einem Förder- und Kooperationsprojekt von Bund, Freistaat Bayern und Land-Baden Württemberg – vor über 30 Jahren endgültig stillgelegt. Seitdem ist kein Fließgewässer mehr vorhanden. Lediglich im Falle eines Hochwassers, wurde der stillgelegte Mühlgraben geflutet. Seit dem letzten Hochwasser war der Mühlgraben nur noch eine Schmutzlache. Somit ist bereits seit über 30 Jahren kein Fließgewässer und damit kein Lebensraum für Makrozoobenthos, Insekten und temporär auch für Fische mehr vorhanden.
Ein entsprechender Retentionsraumausgleich ist bereits erarbeitet und im Grundsatz mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt.
Über die letzten Jahre hinweg wurde der Mühlgraben zunehmend von Passanten auf der Tiroler Straße zugemüllt. Unerlaubt wurde von der Straße aus immer wieder Unrat hinunter in den Graben geworfen, was zur Folge hatte, dass sich Ratten und Mäuse ansiedelten. Diese waren bereits Gegenstand von Beschwerden der Nutzer und Mieter des Magnus Parks. Weiterhin sind hochwertige potenzielle Mieter (z. B. eine Dialysepraxis) aufgrund des Rattenbefall abgesprungen.
Die Einwendung verkennt, dass auch mit einer Wiederöffnung des Mühlgrabens nicht der Zustand von vor über 30 Jahren mit einem durchgängigen Fließgewässer wiederhergestellt würde. Dem steht die bestandsgeschützte Nutzung des ehem. Faserzentrums entgegen.
|
|
7.3 Grünordnungskonzept:
Aufgrund der unmittelbar umgebenden hochwertigen Natur - südlich des Vorhabensgebietes das FFH- und SPA- Gebiet, nördlich der Lech, ist die Einbindung des Gewerbekomplexes besonders bedeutend. Diese ist mit der symmetrischen Pflanzung von Alleen keinesfalls genüge getan. Daher ist die Überarbeitung des Grünkonzeptes in eine qualifizierte Freiflächen Planung dringend erforderlich.
|
Aufgrund der Bundesstraße B17 und des erheblichen Höhenunterschiedes ist eine deutliche Zäsurwirkung vom Plangebiet zu den südlich angrenzenden FFH- und SPA- Gebiet gegeben. Die Stellungnahme verkennt, dass hier keine erstmalige Überplanung der Außenbereichsflächen erfolgt, sondern eine weitgehend versiegelte Gewerbe- und Industriebrache unter besonderer Berücksichtigung des Denkmalschutzes revitalisiert wird. Den Bebauungsplan liegt eine qualifizierte Grünordnung zugrunde, die auf der Ebene der Baugenehmigung mit einer Freiflächenplanung fortzuschreiben sein wird.
|
|
Plan
Aufgrund der herausfordernden Topographie ist eine Visualisierung notwendig. Insbesondere das Parkhaus erscheint überdimensioniert; zumal das Gelände gut mit ÖPNV angebunden sein soll, stellt sich hier die Frage nach der wirklich notwendigen Stellplatzanzahl. Hierfür ist ein Nachweis zu erbringen.
|
Zentrales Ziel der Bauleitplanung ist die Revitalisierung der heutigen Industriebrache. Der angestrebte attraktive urbane Nutzungsmix (Gewerbe, Handwerk, Dienstleitungen, Gastronomie, Indoor-Freizeit Nutzungen, Bildung, ergänzendes Wohnen) benötigt selbst dann eine erhebliche Erhöhung des Stellplatzbedarfs im Magnus Park, wenn von der Stellplatzsatzung der Stadt Füssen abweichende Stellplatzzahlen festgesetzt werden.
Die Zahl der notwendigen Stellplätze wurde anhand der zu erwartenden Nutzungen im Urbanen Gebiet und der Stellplatzsatzung der Stadt Füssen überschlägig ermittelt und läge ohne Berücksichtigung der geplanten Indoor-Nutzung allein bei ca. 380 Stellplätzen. Mit der Indoor Nutzung wird die Zahl der notwenigen Stellplätze um mehrere 100 ansteigen. Im Mobilitätshub würden im best case ca. 360 Stellplätze untergebracht werden. Die Zahl der notwendigen Stellplätze soll durch die Festsetzung des Bebauungsplan im Vergleich zur Stellplatzsatzung der Stadt Füssen deutlich reduziert werden. Der Einwand der Stellungnahme ist nicht nachvollziehbar.
Die Anzahl der notwendigen Stellplätze wären selbst ohne Mobilitätshub auch um den Preis einer noch weitergehenden Flächenversieglung gegenüber dem Bestand nicht abbildbar. Eine Verteilung der notwendigen Stellplätze im gesamten Quartier stünde zudem im diametralen Widerspruch zu den oben genannten städtebaulichen Zielen einer Aufwertung und Attraktivierung der Freiraumgestaltung, eine möglichst weitgehend Kfz-freien Quartiers und einer Erlebbarkeit des Industriedenkmals.
Die Konsequenz aus den oben genannten städtebaulichen Zielen ist die Bündelung der Stellplätze in einem Mobilitätshub. Für diesen wurden unter Berücksichtigung der oben angeführten städtebaulichen, landschaftlichen und denkmalschutzfachlichen Leitziele verschiedene Standortvarianten untersucht.
Bei dieser Alternativenprüfung wurden folgende Kriterien beachtet:
- denkmalgeschützte Gebäude mit vorgegebenem Raster und beschränkter Statik
- Sicherung von bestehendem Gewerbe (Faserzentrum als Ankermieter des Magnus Parks)
- Einbindung in das historische Ensemble und Landschaft
- hohe Grundwasserstände und schwierige Bodenbeschaffenheit.
Eine Integration des Mobilitätshubs in die historischen Gebäude scheidet aus mehreren Gründen aus. Die historische Bausubstanz weist keine hinreichende Tragkraft auf. Eine statische Ertüchtigung lässt sich weder wirtschaftlich noch denkmalschutzrechtlich darstellen. Darüber hinaus lässt die baukonstruktive Rasterung keine effiziente Parkraumverteilung zu. Die erforderlichen Erschließungsanlagen würden grob verunstaltend wirken und dem Leitziel eines autofreien Quartiers widersprechen.
Konsequenz hieraus ist, dass nur der Neubau eines Mobilitätshubs diesen städtebaulichen Zielen Rechnung tragen kann. Für den Neubau wurden verschiedene Varianten geprüft.
Eine Verortung an der Stelle der südlichen Gewerbehalle scheidet aus. Das ehem. Faserzentrum ist Ende der 1980er Jahre aus Mitteln der Wirtschaftsförderung von Bund und Länder unter Einsatz des damaligen bayrischen Ministerpräsidenten gefördert worden und war Bestandteil einer Kooperation des Freistaats Bayern mit dem Land Baden-Württemberg. Das Faserzentrum sollte in Kooperation mit dem wissenschaftlichen Transferzentrum für nachwachsende Faserrohstoffe in Reutlingen Prozesse der Aufbereitung, der Spinnerei, des Webens, des Färbens und der Ausstattung untersuchen sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit praktischem Bezug für die industrielle Weiterverarbeitung der Flachsfaser im textilen und nichttextilen Bereich leisten (siehe etwa LT-Drs. Baden-Württemberg 10/2488, S. 7). Das Faserzentrum ist damit – wie der Magnus-Park insgesamt – ein Zeugnis bayrischer und baden-württembergischer Industriepolitik und des Niedergangs der deutschen Textilindustrie. Zugleich ist das ehem. Faserzentrum auch heute noch mit dem wichtigsten Ankermieter (Erhart GmbH, Werkzeug- und Gerätebau) des Magnus Park belegt. Eine nachhaltige und wirtschaftlich darstellbare Entwicklung des Quartiers kann nur mit Rücksicht auf die bestehenden Mieter gelingen. Ein Bestandschutz der bestehenden Mieter ist für den Stadtrat neben der Revitalisierung des Gesamtquartiers vorrangiges Planungsziel.
Eine Überbauung der Halle wurde vom Eigentümer geprüft, ist aber aus bautechnischen und statischen Gründen nicht wirtschaftlich darstellbar und wäre auch denkmalfachlich nicht adäquat. Die Anregung, den Mobilitätshub weitestgehend als Verlängerung an die südliche Gewerbehalle zu rücken, nähme der Gewerbehalle ihre zentrale Zufahrt sowie Aufstell- und Wendeflächen, die auch weiterhin jedenfalls für LKW von 7,5 bis jedenfalls 20 t gewährleistet bleiben müssen. Die vorgeschlagene Verortung würden zwar denkmalfachliche Belange noch weiter stärken, zugleich jedoch die Existenz bestandsgeschützter gewerblicher Nutzungen und einen Gewerbebetrieb mit über 50 Arbeitsplätzen, der aktuell Investitionen in Millionenhöhe tätigt, gefährden. Sie scheidet vor diesem Hintergrund aus.
Am derzeit geplanten Standort des Mobilitätshubs standen nördlich sowie nordöstlich der Filialkirche „Unserer Lieben Frau am Berg“ bereits um 1911 mehrere Gebäude. Die Nutzungen waren unter anderem Fabrikkrankenhaus, Mädchenheim, Werkbibliothek, Kindergarten (Stillstube, Kinderkrippe, Knaben- und Mädchenhort), Arbeiter-Wohngebäude mit 9 Einheiten und Mühlen. Südlich des ehemaligen Mühlbachs verlief zudem ein Weg, welcher ausschließlich den Arbeitern zur Verfügung stand. Aus den historischen Plänen über die bauliche Erweiterung im Wohngebäude ist zu erkennen, dass die Wohnhäuser eine Gesamthöhe von ca. 11 m hatten.
Abb.: Historischer Plan von 1911, Mech. Seilerwarenfabrick an der Tirolerstraße (rechts) und ehemaliger Weg zu den Wohnhäusern der Mech. Seilerwarenfabrick an der Tirolerstraße
Abb.: Historische Abbildung der Mech. Seilerwarenfabrick an der Tirolerstraße mit mehrgeschossiger Bebauung südl. der Filialkirche
Eine Bebauung an diesem Standort ist somit durchaus historisch überliefert und lediglich über die Jahre in Vergessenheit geraten. Der Höhenunterschied auf Höhe der Filialkirche zum Grundstück liegt bei ± 7 m. Die ehemaligen Wohnhäuser waren somit höher als die Tiroler Straße. Die Festsetzungen des Bebauungsplans stellen sicher, dass der geplante Mobilitätshub die Oberkante Fahrbahndecke der Tiroler Straße nicht übersteigen wird. Der Baukörper wird zudem in Teilbereichen an die bestehende Stützwand gebaut. Durch eine entsprechende Fassadengestaltung (z. B. Grünfassaden) kann das Parkhaus entsprechend in das historische Ensemble und Landschaftsbild integriert werden.
Abb.: Beispiel Parkhaus TONIPark in Augsburg (links) und Beispiel einer Grünfassade, Jakob Rope Systems (rechts)
Voraussichtlich wird für den aktuellen Stellplatzbedarf bereits ca. 60 - 80 % des Bauvolumens bis zum momentan vorgesehenen Gebäudeknicks notwendig. Der zusätzliche Stellplatzbedarf wird durch die geplante Revitalisierung des Quartiers erforderlich (s. o.). Auch unter Berücksichtigung einer etwaigen Doppelbelegung von Stellplätzen wird ein entsprechender Baukörper notwendig. Der Bebauungsplan schöpft die Möglichkeiten zur Reduzierung der Anzahl notwendiger Stellplätze bereits aus.
Die Stadt Füssen stellt mit ihren Festsetzungen und ergänzenden vertraglichen Regelungen sicher, dass das Mobilitätshub entsprechend sensibel in das Areal integriert wird.
|
|
|
|
Der Bebauungsplanvorentwurf wird entsprechend der fachlichen Würdigung/ Abwägung geändert. Für blütenreiche Wiesen wird autochthones Saatgut festgesetzt.
|
|
|
- LRA Ostallgäu - Untere Immissionsschutzbehörde
|
|
- Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage, insbesondere Informationen im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.
Zu dem Entwurf Ld.F.v. 26.09.2023 wird folgendes mitgeteilt:
|
|
|
Verkehrslärm:
Die im Urbanen Gebiet zulässige Wohnbebauung ist dem Verkehrslärm der südlich an das Plangebiet angrenzenden Bundesstraße B17 ausgesetzt. Gemäß der Begründung zum Bebauungsplan (siehe Ziffer 8.13) wurde ein durch den Verkehrslärm verursachter Beurteilungspegel von 47 dB(A) für die im nördlichen Plangebiet vorgesehene Wohnbebauung überschlägig ermittelt. Die Rechenvorschrift fehlt in den Angaben zur Begründung und kann daher nicht nachvollzogen werden.
|
Die Stadt hat eine ergänzende schalltechnische Untersuchung der BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH erstellen lassen.
|
|
Der zu Grunde gelegte Abstand von 170 m zwischen Bundesstraße und geplanter Wohnbebauung geht aus der Planzeichnung nicht hervor. Dass sich die Wohnnutzung ausschließlich auf den nördlichen Bereich des Plangebietes beschränken soll, ist nicht erkennbar. Sofern Wohnnutzungen in den südlicheren Baufenstern zulässig sind, sind deutlich geringere Abstände zur Straße möglich, welche sich in der Berechnung des Beurteilungspegels wiederfinden müssen. Es ist daher zu erwarten, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" überschritten werden.
|
Die Berechnung der Verkehrslärmimmissionen ergab, dass mit Beurteilungspegeln von tagsüber bis zu etwa 65 dB(A) nachts bis zu etwa 55 dB(A) zu rechnen ist. Im Bereich ab etwa 100 m von der B17 betragen die Beurteilungspegel tagsüber weniger als 60 dB(A) und nachts weniger als 50 dB(A). Somit werden in weiten Teilen des Bebauungsplangebietes die Orientierungswerten des Beiblattes 1 zur DIN 18005 eingehalten. Die in der 16. BImSchV vorgegebenen Immissionsgrenzwerte werden fast im ganzen Bebauungsplangebiet eingehalten.
|
|
Für die Bereiche, in denen die Orientierungswerte überschritten werden, sollten daher konkrete Schallschutzmaßnahmen gefordert werden (z.B. Aborientierung der zum Lüften notwendige Ruheraumfenster oder schallgedämmte Lüftungseinrichtungen bei Beurteilungspegel > 45 dB(A) zur Nachtzeit). Der räumliche Geltungsbereich der Festsetzungen sollte im Plan gekennzeichnet werden (Darstellung der Grenzisophonen).
|
Im Bebauungsplan werden aufbauend auf diese schalltechnische Untersuchung Festsetzungen zum baulichen Schallschutz von schutzbedürftigen Nutzungen im Sinne der DIN 4109 und zur Grundrissorientierung von Schlaf- und Kinderzimmer ergänzt.
Im Bereich bei der Bundesstraße B17 sind Schlaf- und Kinderzimmer in der Regel ohne weiteren Nachweis nicht zulässig.
|
|
Mobilitätshub:
Aus den Planungen geht hervor, dass sich der Parkverkehr des gesamten Plangebietes weitestgehend im geplanten Mobilitätshub konzentrieren soll. Die Parkflächen rücken zudem durch die Planung an die Immissionsorte südlich des Bebauungsplanes heran. Die Anzahl der Parkplätze richtet sich nach der Bruttogeschossfläche und kann von der UIB aktuell nicht abgeschätzt werden.
Die Schallemissionen des Parkverkehrs sollen daher im Zuge der Planung näher betrachtet werden. Ferner wäre in diesem Zusammenhang zu klären, ob es sich um eine öffentliche Parkanlage oder um private Parkplätze handelt (Anwendungsbereich 16. BlmSchV oder TA Lärm).
|
Es liegt noch keine detaillierte Planung zum Mobilitätshub vor. Durch ein in Richtung der bestehenden Immissionsorte südlich der B17 geschlossene Fassade oder durch andere geeignete Lärmschutzmaßnahmen kann von einer Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwert der TA Lärm ausgegangen werden.
Daher ist es sachgerecht, die weitere Bewertung der Lärmsituation im Bereich des Mobilitätshubs im Genehmigungsverfahren durchzuführen.
|
|
Gewerbelärm:
Das Areal wird größtenteils bereits gewerblich genutzt. Die Gewerbenutzungen dürfen im Rahmen ihrer bisherigen Genehmigungen betrieben werden. Die neu hinzukommende Wohnnutzung stellt somit eine heranrückende Wohnbebauung dar, die ggf. zu Einschränkungen, vor allem für lärmintensive Betriebe führen kann. Darüber hinaus soll diese den Schutzstatus eines urbanen Gebiets erhalten, wodurch geringere Immissionsrichtwerte im Vergleich zu einem Gewerbe- oder Industriegebiet, vor allem zur Nachtzeit gelten.
Die Begründung zum Bebauungsplan weist darauf hin, dass im Zuge einer Baugenehmigung oder Nutzungsänderung die Anforderungen an den Lärmschutz nach TA Lärm nachzuweisen sind und eventuelle durch diese Planung hervorgerufene Lärmkonflikte im Rahmen der Planung nicht näher untersucht werden sollen. Die Begründung bezieht sich jedoch auf die Auswirkungen des Gewerbelärms auf die Wohnnutzung außerhalb des Plangebietes. Der Lärmkonflikt durch die an die bestehenden Gewerbebetriebe heranrückende Wohnbebauung ist nicht Gegenstand der Begründung.
|
Aufgrund der vorliegenden Genehmigungsbescheide der einzelnen gewerblichen Nutzungen und der vorliegenden tatsächlichen Nutzungen im Plangebiet, im Bereich des Grundstückes mit der Fl.Nr. 350 sind keine unmittelbaren Lärmkonflikte zu erwarten. Eine detaillierte Betrachtung der Zulässigkeit von verschiedenen Nutzungen ist gegebenenfalls in der Genehmigungsplanung durchzuführen.
Im Bereich des Grundstückes mit der Fl.Nr. 3176 befindet sich ein Wasserkraftwerk. In dem vorliegenden Genehmigungsbescheid sind keine zulässigen Immissionsrichtwertanteile festgelegt. Es wurde in einem Rechenmodell die Immissionssituation nachgebildet. Dabei wurde ein Bereich festgelegt, in dem der in der TA Lärm vorgegebene Immissionsrichtwert nachts um 6 dB(A) unterschritten wird. In diesem Bereich wurden schutzbedürftige Nutzungen mit einem erhöhten Schutzanspruch nachts ausgeschlossen.
Tagsüber ergibt sich aufgrund der Lage der festgesetzten Baufelder keine Einschränkung der zulässigen Emissionen des Wasserkraftwerkes.
|
|
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Lärmkonflikte durch die Planung selbst zu lösen sind und nicht auf nachgelagerte Verfahren verlagert werden sollen (Gebot der planerischen Konfliktbewältigung).
Im Rahmen der Bauleitplanung ist daher zu untersuchen, ob die bestehenden und genehmigten Nutzungen (lärmintensives Handwerk, Kraftwerksbetrieb) einer zukünftigen Wohnnutzung entgegenstehen.
|
Dem Gebot der planerischen Konfliktbewältigung wird damit Rechnung getragen.
|
|
|
|
Der Bebauungsplanvorentwurf wird entsprechend der fachlichen Würdigung/ Abwägung um textliche wie auch planzeichnerische Festsetzungen zum Immissionsschutz ergänzt und geändert.
|
|
|
- LRA Ostallgäu - Untere Bodenschutzbehörde
|
|
- Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage
|
|
|
Altlasten:
Der vorliegende Bebauungsplan für das Gebiet "Mühlbachgasse" wurde in Bezug auf Altlasten und Altablagerungen überprüft.
Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der industriellen Vornutzung des beplanten Geländes (ehemalige Hanfwerke) und den ggf. vorhandenen Kontaminationen von Gebäuden und Untergrund der Verdacht einer schädlichen Bodenverunreinigung besteht.
Sämtliche notwendige Erdarbeiten sind durch einen nach § 18 BBodSchG zugelassenen Sachverständigen zu begleiten und entsprechend zu dokumentieren. Dem Landratsamt Ostallgäu sind die Untersuchungsergebnisse bzw. die gutachterliche Stellungnahme vorzulegen.
|
Die Anregung wird unter Hinweise und Nachrichtliche Übernahmen mit in die textlichen Festsetzungen aufgenommen.
Der Eigentümer hat schon im Rahmen der bereits erfolgten Teilsanierung des Magnus Parks erhebliche Anstrengungen unternommen, die angetroffenen schädlichen Bodenveränderungen zu sanieren. Entsprechende Sanierungsmaßnahmen werden bei der anstehenden weiteren Entwicklungen des Magnus-Parks durchzuführen sein.
|
|
Schutzgut Boden:
Die Versiegelung des Bodens ist gering zu halten.
Sämtlicher Boden und Aushub, der bei Bauarbeiten anfällt, ist entsprechend der abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen. Hierüber sind Nachweise zu führen und dem Landratsamt auf Verlangen vorzulegen.
|
Die Planung führt zu einer erheblichen Entsiegelung. Der Anteil der Freiflächen wird nahezu verdoppelt werden (+ 47 %). Der Stellungnahme wird damit Rechnung getragen.
Die Anregung wird unter Hinweise und Nachrichtliche Übernahmen mit in die textlichen Festsetzungen aufgenommen.
|
|
|
|
Der Bebauungsplanvorentwurf wird entsprechend der fachlichen Würdigung/ Abwägung redaktionell um Hinweise ergänzt.
|
|
|
- Regierung von Schwaben vom 13.12.2023
|
|
- Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Ziele der Raumordnung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen, sowie Grundsätze der Raumordnung als Vorgabe für die nachfolgende Abwägungsentscheidung:
|
Die Stadt Füssen weist einleitend darauf hin, dass der städtebauliche Masterplan sowie der daraus entwickelte Bebauungsplan gemeinsam das Hauptziel haben, die bestehende historische Bebauung zu sichern und als solche wieder erlebbar zu machen. Als Ergänzung zum Bestand soll zudem der „Südbau“ in seiner Zeilenstruktur bis auf die Höhe des Lechbaus verlängert werden, wodurch die neue Platzgestaltung beim Eingang des Magnus Parks städtebaulich hervorgehoben wird. Eine strenge Grünordnung betont zudem die Zeilenbebauung. Die notwendigen und öffentlichen Stellplätze sollten nach bisheriger Planung in einem zentralen Mobilitätshub untergebracht werden, sodass das historische Ensemble durch den ruhenden Verkehr nicht beeinträchtigt wird und ein weitestgehend autofreies Quartier mit hochwertiger Freianlagen entstehen kann.
|
|
Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)
5.3 Einzelhandelsgroßprojekte
7.2.5 Abs. 4 (G) Hochwasserschutz und Hochwasserrisikomanagement, hier: Risiken aus Starkniederschlägen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen besonders berücksichtigen
Regionalplan der Region Allgäu (RP 16)
B I 3.4.3 (Z) Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser, Muren, Erosionen und Lawinen fortführen
|
Die Ziele und Grundsätze des LEP und des Regionalplans der Region Allgäu (RP 16) werden in der Planbegründung wiedergegeben und in der Bauleitplanung berücksichtigt.
|
|
Stellungnahme aus Sicht der Landesplanung:
|
|
|
Laut den Planungsunterlagen beabsichtigt die Stadt Füssen mit dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf auf dem ehemaligen Hanfwerke-Gelände ein Urbanes Gebiet festzusetzen. Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Füssen ist das Plangebiet derzeit als gewerbliche Baufläche dargestellt. Gemäß Planungsunterlagen kann der Flächennutzungsplan im Wege der Berichtigung angepasst werden.
|
Die Stellungnahme wird Kenntnis genommen.
|
|
Den Planungsunterlagen zufolge können im Plangebiet infolge von Starkregenereignissen Überflutungen auftreten. Darüber hinaus ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs laut Planungsunterlagen teilweise von einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet betroffen. Deshalb weisen wir auf den LEP-Grundsatz 7.2.5 Abs. 4 hin, wonach bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die Risiken aus Starkniederschlägen besonders berücksichtigt werden sollen. Hierzu soll insbesondere auf die Freihaltung von Abflussleitbahnen und Senken hingewirkt werden. Außerdem sollen gemäß RP 16-Ziel B I 3.4.3 im alpinen Teil der Region die Maßnahmen zum Schutz u.a. vor Hochwasser fortgeführt werden. In diesem Zusammenhang kommt in den Siedlungsgebieten im Rahmen der Bauleitplanung der vorbeugenden Freihaltung der Gefährdungsräume besondere Bedeutung zu (vgl. Begründung zu RP 16 B I 3.4.3 (Z)). Ob sich hieraus besondere Anforderungen an die Planung ergeben, wird vom zuständigen Wasserwirtschaftsamt zu beurteilen sein.
|
Für die Überplanung des Innenbereichs besteht nach dem WHG kein Planungsverbot. Hier sind die Belange des Hochwasserschutzes im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Der Retentionsraumausgleich ist von einem Fachplaner ausgearbeitet und mit dem WWA Kempten abgestimmt worden. Das WWA Kempten hat den geplanten Retentionsraumausgleich mit E-Mail vom 05.02.2024 wasserrechtlich als genehmigungsfähig angesehen. Die Belange des Hochwasserschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB) werden damit angemessen berücksichtigt.
Gleichwohl erlaubt sich die Stadt Füssen darauf hinzuweisen, dass es sich beim Magnus Park um eine Industriebrache handelt, deren bestandsgeschützte Bebauung bereits zu Teilen wieder mit Nutzungen belegt werden konnte. Die Planung wird dazu führen, dass die im Bestand überwiegend versiegelten Flächen erheblich entsiegelt werden. Durch den Rückbau der Zwischenbauten und die festgesetzte Grünordnung werden die Freiflächen erheblich ökologisch und landschaftsästhetisch entsprechend aufgewertet. Durch die geplanten Maßnahmen werden im Vergleich zum Bestand voraussichtlich ca. 6.523 m² mehr an Grünflächen geschaffen. Dies entspricht einer Entsiegelung von ca. 47 %. Damit wird der Abfluss bei Starkregenniederschlägen erheblich verbessert.
Der Uferbereich des Lechs ist durch den Bebauungsplan nicht betroffen.
Das Gewerbe- und Industriegebiet ist aktuell weitestgehend durch bauliche Anlagen oder Erschließungsflächen versiegelt.
|
|
Ergänzend geben wir folgenden Hinweis:
Wir sind seitens der obersten Landesplanungsbehörde angehalten, bei Gewerbe- und Mischgebietsausweisungen darauf hinzuweisen, dass "durch geeignete Festsetzungen die Entstehung unzulässiger Einzelhandelsagglomerationen auszuschließen ist" (vgl. Begründung zu LEP 5.3.1 (Z)). Dies gilt analog für Urbane Gebiete.
|
Die Stadt Füssen wird die Entstehung von Einzelhandelsagglomerationen im urbanen Gebiet ausschließen. Die Festsetzungen des Bebauungsplans werden entsprechend ergänzt.
|
|
Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem oben genannten Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. mit Rechtsgrundlage/n:
|
|
|
Das Regierungssachgebiet Städtebau gibt folgenden Hinweis: Das Areal des gegenständlichen Bebauungsplans liegt in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet der Stadt Füssen, dessen Sanierungsziele in den Vorbereitenden Untersuchungen 'Ehemaliges Hanfwerkeareal' festgelegt und in einem umfassenden Arbeitsprozess mit dem Eigentümer und den Fachbehörden erarbeitet wurden. Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB sind von der Gemeinde beschlossene städtebauliche Konzepte in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Die Begründung zum Bebauungsplan, in der bislang Aussagen hierzu fehlen, ist daher entsprechend zu ergänzen. Insbesondere ist zu erläutern, wie die Aussagen der VU, also die städtebaulichen Ziele und Maßnahmen in der Bauleitplanung umgesetzt werden.
|
Die zentralen Ergebnisse der angeführten VU werden in die Begründung mit aufgenommen.
Die zentralen Ziele der VU wurden sowohl im Masterplan als auch im Bebauungsplan berücksichtigt und umgesetzt.
|
|
Die Bauleitplanung wurde in das Rauminformationssystem der Regierung von Schwaben eingetragen. Wir bitten Sie, der höheren Landesplanungsbehörde zuverlässig alle Bauleitpläne sowie Innen- und Außenbereichssatzungen nach §§ 34 und 35 BauGB zu übermitteln, nachdem diese Rechtskraft erlangt haben, bzw. die Regierung zu informieren, sofern Planungen nicht weiterverfolgt werden. Für diese Zuleitung in elektronischer Form haben wir das Funktionspostfach flaechenerfassung@reg-schw.bayern.de eingerichtet.
|
|
|
|
|
Der Bebauungsplanvorentwurf wird entsprechend der fachlichen Würdigung/ Abwägung redaktionell dahingehen ergänzt, dass weitere Ziele aus dem LEP, dem RP und der vorbereitenden Untersuchung ergänzt werden. Zudem wird Einzelhandelsagglomerationen ausgeschlossen.
|
|
|
- Regionaler Planungsverband – Allgäu vom 15.12.2023
|
|
- Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
laut Umweltatlas des Bayerischen Landesamtes für Umwelt befinden sich am südöstlichen Rand des Plangebietes Gefahrenbereiche für Steinschlag/Blockschlag. Darüber hinaus ist teilweise ein festgesetztes Überschwemmungsgebiet berührt.
Deshalb weisen wir auf das Ziel des Regionalplans der Region Allgäu (RP 16) B I 3.4.3 hin. Gemäß diesem Regionalplanziel sollen im alpinen Teil der Region die Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser, Muren, Erosionen und Lawinen fortgeführt werden. In diesem Zusammenhang kommt in den Siedlungsgebieten im Rahmen der Bauleitplanung der vorbeugenden Freihaltung der Gefährdungsräume besondere Bedeutung zu (siehe Begründung zu RP 16 B I 3.4.3 (Z)).
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme sowie den darin enthaltenen Informationen aus der Gefahrenhinweiskarte.
Wie der Stellungnahme und der Gefahrenhinweiskarte zu entnehmen ist, wird im Süd- und Südostteil des Planungsgebiets Bereiche mit Steinschlag/Blockschlag (ohne und mit Wald) ausgewiesen. Der überwiegend bereits bebaute Gebäudebestand befindet sich außerhalb dieses potenziellen Gefahrenbereichs. Lediglich das ehem. Faserzentrum als bestandsgeschützte Gewerbehalle im Süden ist im Bestand davon betroffen.
Der Bebauungsplan sieht im Übrigen im potentiellen Gefahrenbereich nur den Neubau des Mobilitätshubs dar. Dieses Gebäude soll bestimmungsgemäß dem ruhenden Verkehr dienen. In ihm werden sich keine Personen dauerhaft, sondern nur vorübergehend aufhalten. Eine längere Aufenthaltsdauer von Personen ist nicht zu erwarten. Dem Ziel des Regionalplans RP 16 in B I 3.4.3 ist damit Rechnung getragen. Es kann dahinstehen, ob es sich hierbei um ein echtes Ziel der Raumordnung als abschließend abgewogene, verbindliche Vorgabe zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums (§ 3 Abs 1 Nr. 2 ROG) und nicht nur um einen Grundsatz der Raumordnung als Vorgabe für nachfolgende Abwägungsentscheidungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG) handelt. Für letzteres spricht die offene Formulierung in B I.3.4.3, wonach die (nicht näher bestimmten) Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser, Muhren, Erosionen und Lawinen fortgeführt werden sollen. Auch die Begründung, wonach in den Siedlungsgebieten im Rahmen der Bauleitplanung der vorbeugenden Freihaltung der Gefährdungsräume besondere Bedeutung zukommt, spricht gegen ein abwägungsfestes, abschließend abgewogenes Ziel der Raumordnung.
Im Hinblick auf das Überschwemmungsgebiet besteht für die Überplanung des Innenbereichs nach dem WHG kein Planungsverbot. Hier sind die Belange des Hochwasserschutzes im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Der Retentionsraumausgleich ist von einem Fachplaner ausgearbeitet und mit dem WWA Kempten abgestimmt worden. Das WWA Kempten hat den geplanten Retentionsraumausgleich mit E-Mail vom 05.02.2024 wasserrechtlich als genehmigungsfähig angesehen. Die Belange des Hochwasserschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB) werden damit angemessen berücksichtigt.
Darüber hinaus weist die Stadt Füssen darauf hin, dass der Bebauungsplan den Uferbereich des Lechs nicht beinhaltet.
|
|
Darüber hinaus können den Planungsunterlagen zufolge im Plangebiet infolge von Starkregenereignissen Überflutungen auftreten. Deshalb weisen wir auf den Grundsatz 7.2.5 Abs. 4 des Landesentwicklungsprogramms Bayern hin, wonach bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die Risiken aus Starkniederschlägen besonders berücksichtigt werden sollen. Hierzu soll insbesondere auf die Freihaltung von Abflussleitbahnen und Senken hingewirkt werden.
|
Die Stadt Füssen erlaubt sich darauf hinzuweisen, dass es sich beim Magnus Park um eine Industriebrache handelt, deren bestandsgeschützte Bebauung bereits zu Teilen wieder mit Nutzungen belegt werden konnte. Die Planung wird dazu führen, dass die im Bestand überwiegend versiegelten Flächen erheblich entsiegelt werden. Durch den Rückbau der Zwischenbauten und die festgesetzte Grünordnung werden die Freiflächen erheblich ökologisch und landschaftsästhetisch entsprechend aufgewertet. Durch die geplanten Maßnahmen werden im Vergleich zum Bestand voraussichtlich ca. 6.523 m² mehr an Grünflächen geschaffen. Dies entspricht einer Entsiegelung von ca. 47 %. Damit wird der Abfluss bei Starkregenniederschlägen erheblich verbessert.
|
|
Des Weiteren bitten wir die Stadt Füssen, in Bezug auf die geplante Bebauungsplanänderung geeignete Maßnahmen zu treffen, um Regionalplan der Region Allgäu B V 2.3 (Z) ausreichend Rechnung zu tragen. Gemäß diesem Regionalplanziel soll darauf hingewirkt werden, dass die Region von der Errichtung überwiegend eigengenutzter Freizeitwohngelegenheiten (Zweitwohnungen) freigehalten wird.
|
Die Stadt Füssen schließt in dem Bebauungsplan Ferienwohnungen i.S.d. § 13a BauNVO, die nach ihrer Lage, Größe, Ausstattung, Erschließung und Versorgung für den Erholungsaufenthalt geeignet und dazu bestimmt sind, überwiegend und auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur Erholung zu dienen, aus. Ein Ausschluss von gewerblich vermieteten Ferienwohnungen als Unterart einer gewerblichen Nutzung ist nach § 1 Abs. 9 BauNVO möglich.
Demgegenüber gibt es für einen Ausschluss von Zweitwohnungen aus der Sicht der Stadt Füssen keine Festsetzungsgrundlage. Entscheidend für eine Wohnnutzung ist, dass diese im Sinne einer „auf Dauer angelegten Häuslichkeit“ genutzt wird, also nach Ausstattung und Bestimmung das dauerhafte Wohnen ermöglicht (ohne dass der Eigentümer auch tatsächlich dauerhaft dort Wohnen muss). Liegt diese „Häuslichkeit“ vor, ist auch eine Zweitwohnung Wohnen i.S.d. § 3 und § 4 BauNVO (siehe etwa Bönker/Bischopink, BauNVO, 2. Aufl., § 3 Rn. 27; Fickert/Fieseler, BauNVO, 13. Aufl., § 3 Rn. 1.2; König/Roeser/Stock, BauNVO, 5. Aufl., § 3 Rn. 17a; Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Der Erwerb von Zweitwohnungen, S. 9). Die Nutzung von Wohnungen als Erstwohnsitz kann in einem Bebauungsplan nicht festgesetzt werden.
Auch bei der Regelung in B V 2.3 dürfte es sich aufgrund ihrer Formulierung („es soll darauf hingewirkt werden“ um kein abschließend abgewogenes Ziel der Raumordnung handeln.
|
|
|
|
Der Bebauungsplanvorentwurf wird entsprechend der fachlichen Würdigung/ Abwägung dahingehend geändert, dass Ferienwohnungen nicht zulässig sind.
|
|
|
- Staatliches Bauamt Kempten vom 23.11.2023
|
|
- Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können (z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen):
|
|
|
Das geplante Baugebiet ist straßenrechtlich in der Ortsdurchfahrt von Füssen unmittelbar an die Bundesstraße 17 angeschlossen.
Bei den Abbauarbeiten darf keine übermäßige, den Verkehr beeinträchtigende, Staubentwicklung entstehen.
|
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
|
|
Den Straßengrundstücken und den Straßenentwässerungsanlagen dürfen keine Abwässer und kein Niederschlagswasser zugeleitet werden.
|
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Durch die Höhenlage der Bundesstraße B17 ist ein Abfließen von Niederschlagswasser aus dem Plangebiet ausgeschlossen.
|
|
Die Straßenbauverwaltung ist von jeglichen Ansprüchen des Bauwerbers freizustellen, die sich aus dem Bestand und dem Betrieb der Straße ergeben. Das bedeutet, dass gegen die Straßenbauverwaltung keinerlei Ansprüche in Bezug auf Lärmsanierung geltend gemacht werden können.
|
Die Verkehrslärmproblematik ist von der Stadt Füssen erkannt, gutachterlich untersucht und durch Festsetzung der Bereiche, in denen Wohnnutzungen zulässig sind und zur Grundrissgestaltung bewältigt worden.
|
|
Des Weiteren sind gemäß der RAST 06 beidseits Sichtdreiecke mit einer Schenkellänge von 30 m, gemessen 3 m von Mitte des Geh- & Radweges, gewährleistet werden.
Um weitere Beteiligung im Verfahren wird gebeten.
|
Die angeregten Sichtdreiecke sind im B-Plan dargestellt und werden im Rahmen der Ausführungsplanung berücksichtigt.
|
|
|
|
Aufgrund der eingegangenen Stellungnahme erfolgt keine Änderung des Bebauungsplanvorentwurfs.
|
|
|
- Wasserwirtschaftsamt Kempten vom 15.12.2023
|
|
- Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Sehr geehrte Damen und Herren,
es bestehen Einwände zu o. g. Vorhaben. Zum gegenständlichen Bebauungsplan wurde bereits mehrfach gegenüber der Stadt Füssen und dem Büro f64 Architekten Stellung genommen. Die Stellungnahmen wurden in der vorliegenden Bauleitplanung nur ansatzweise eingepflegt.
|
|
|
Retentionsraumverlust durch die Auffüllung des alten Mühlkanals
Ein Ausgleich des Retentionsraumverlustes ist nur notwendig, wenn die Rückbauanordnung des LRA Ostallgäu vom 27.12.2016 (Az.40-00659/16) nicht vollzogen wird.
Nach unserer Kenntnis wurde der in der Bauleitplanung beschriebene Retentionsraumverlust weder genehmigt, noch hergestellt.
Aus unserer Sicht ist zunächst zu klären, ob die o.g. Rückbauanordnung noch Bestand hat. Ist dies nicht der Fall, ist ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren für die Herstellung des Retentionsraumausgleiches genehmigen zu lassen. Erst dann sind eine weitere Bebauung bzw. eine Transformation des Gebietes möglich.
|
Aus Sicht des Denkmalschutzes kommt dem Mühlgraben durchaus eine denkmalfachliche Bedeutung zu. Das Landratsamt hat vor diesem Hintergrund eine Wiederöffnung des Mühlgrabens angeordnet. Der Vollzug dieser Rückbauanordnung ist im Einvernehmen mit dem LRA und dem BLfD seiner Zeit ausgesetzt worden, um eine ganzheitliche städtebauliche Neubewertung der Situation anhand eines Gesamtkonzeptes, welches auch konkret auf die denkmalfachlichen Aspekte eingeht, zu ermöglichen. Auf Grundlage dieses Konzeptes und einer entsprechend Stellungnahme des BLfD, wird seitens des LRA eine Neubeurteilung der Situation mit dem verfüllten Mühlbach und der angestrebten Planung erfolgen.
Der mögliche Retentionsraumausgleich wurde mit dem WWA Kempten dem Grunde nach abgestimmt und ist mit E-Mail vom 05.02.2024 aktuell nochmals bestätigt worden.
|
|
Hundertjährliches Hochwasser
Das Hanfwerkeareal wird bei Hochwasserereignissen zum großen Teil von der bestehenden Ufermauer geschützt. Das Hanfwerkeareal ist bis auf den Mühlkanal (nachdem er wieder freigelegt wurde) bei einem HQ100 nicht überschwemmt.
Grundlage hierfür ist eine funktionsfähige Ufermauer sowie die Anwendung der mobilen Hochwasserschutzelemente.
Um auch in Zukunft die Hochwassersicherheit des Areals zu gewährleisten ist die Ufermauer in einem funktionsfähigen Zustand zu erhalten. Eventuell vorhandene Lücken in der Ufermauer sind zu schließen und eine einheitliche Höhe der Maueroberkante ist zu schaffen. Für den Einsatz der mobilen Hochwasserelemente an den Durchfahrten in der Ufermauer empfehlen wir einen Alarmplan aufzustellen.
|
Die Stadt bedankt sich für die Hinweise zum HQ 100. Für den verfüllten Mühlbachgraben ist ein Retentionsraumausgleich durch einen Fachgutachter ausgearbeitet und mit dem WWA Kempten abgestimmt worden.
Die Anwendungshinweise zu den mobilen Hochwasserschutzelementen sowie der Funktionsfähigkeit der bestehenden Ufermauer werden zur Kenntnis genommen und sind vom Grundstückseigentümer zu beachten.
Ein Alarmplan für den Einsatz der mobilen Hochwasserelemente ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
|
|
Extremhochwasser
In den Unterlagen zur Bauleitplanung wurde das Extremhochwasser nicht behandelt.
Das Gebiet ist bei extremen Hochwasserereignissen betroffen und deshalb als Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten nach § 78b WHG einzustufen. Dort ist die Ausweisung neuer Baugebiete bzw. Änderungen von Bauleitplänen grundsätzlich möglich. Dabei ist die Abwägung nach §1 Absatz 7 des Baugesetzbuches zu berücksichtigen [Nach § 78 b WHG (1) 1. sind dies insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sachschäden].
Folgende Ermittlungen und Bewertungen sind hierzu notwendig:
- Gefährdungslage
- Gefahren für Leben und Gesundheit
- Einfluss des geplanten Vorhabens auf die Hochwassersituation
- Sachschäden am geplanten Objekt.
- Sekundäre Schäden und gesellschaftliche Auswirkungen
- Abschließende Bewertung und Vorsorgemaßnahmen
Auf der Basis der vorhergegangenen Ermittlungen und Bewertungen erfolgt nun eine abschließende Abwägung durch die Kommune ob das Risiko vertretbar ist.
|
Die Hinweise zum Extremhochwasser werden zur Kenntnis genommen. Ein Baustein wird hierzu in der Begründung mit aufgenommen. Die Stadt Füssen stellt klar, dass eine Gewerbe- und Industriebrache im Bestand überplant, also kein neues Baugebiet erstmals ausgewiesen wird. Den Belangen des Hochwasserschutzes wird mit dem fachgutachterlich ausgearbeiteten, mit dem WWA Kempten abgestimmten Retentionsraumausgleich angemessen Rechnung getragen.
|
|
Das Weitern wird auf Grund der besonders empfindlichen Anlage eine hochwasserangepasste Bauweise empfohlen (z. B. Höhe EG Decke deutliche über Höhe des gewachsenen Bodens, weiße Wanne, Verzicht auf eine Tiefgarage, etc.)
|
Die Stadt Füssen weist darauf hin, dass es sich bei dem vorliegen Bauleitplanverfahren in erster Linie um eine Revitalisierung einer Gewerbe- und Industriebrache geht. Neben der Sicherung des Bestandes, insbesondere der historischen Zeilenbauten, wird es einen Rückbau der Zwischenbauten geben. Die bestehenden, in Teilen denkmalgeschützten Baukörper bleiben erhalten, eine Tiefgarage wird nicht geplant.
Die geplanten Neubauten befinden sich einerseits östlich des „Südbaus“ sowie nördlich der B17. Die Erweiterung des Südbaus wird sich hierbei am Bestand orientieren. Die Stellplätze sollen in einem oberirdischen Mobilitätshub nachgewiesen werden, das im unmittelbaren Anschluss an die südlich angrenzende B17 errichtet werden wird. Dieser Neubau ist nicht zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen bestimmt.
Die Hinweise werden zur Kenntnis gekommen.
|
|
Die Fläche des Extremhochwassers ist nachrichtlich in den Flächennutzungsplan und Bebauungsplan zu übernehmen.
|
Da das Plangebiet bei einem HQextrem fast weitestgehend betroffen ist, wird zur besseren Lesbarkeit die Thematik (Bild und Text) in der Begründung des Bebauungsplanes berücksichtigt.
Der Bebauungsplan wird nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt (Bebauungsplan der Innenentwicklung). In diesen Fällen wird der Flächennutzungsplan nicht geändert, sondern im Wege der Berichtigung angepasst
|
|
Die Stadt Füssen hat bereits Erfahrung mit der Bauleitplanung im Risikogebiet nach § 78b WHG.
Hier ist als Beispiel die Bauleitplanung O 65 "Weidach Nord 2" zu nennen.
|
Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme.
|
|
Hinweise:
Es wird empfohlen auf kritische Nutzungen (wie z.B. Tiefgaragen, Schlafzimmer), sowie Ölheizungen (vergleiche § 78c WHG) zu verzichten. Außerdem sollte keine hochwertige Nutzung und somit Erhöhung des Schadenpotentials unterhalb des HQextrem-Wasserspiegels erfolgen.
aktuelle Hinweise & Literatur für Gemeinde, Planer & Bauherr
weitere Links:
- Bayerisches Bauministerium: Klimasensibler Umgang mit Niederschlagswasser in der Bauleitplanung (bayika.de) Schreiben vom 27.07.2021 des Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr mit dem Titel: Klimasensibler Umgang mit Niederschlagswasser in der Bauleitplanung; insbesondere:
- Klimabezogene Festsetzungen im Bebauungsplan betreffend Umgang mit Niederschlagswasser (u.a. „Zisternenpflicht“)
- Ermittlung der Grundfläche in Bezug auf „Steingärten/Schotterflächen“
Das Landratsamt Ostallgäu erhält einen digitalen Abdruck dieses Schreibens.
|
Die Hinweise zu kritischen Nutzungen und weiterführender Literatur für Gemeinde, Planer und Bauherr werden zur Kenntnis genommen.
|
|
|
|
Die Begründung des Bebauungsplanvorentwurfs wird entsprechend der fachlichen Würdigung/ Abwägung redaktionell um das Thema Extremhochwasser ergänzt.
|
|
|
2. Öffentlichkeit
- Bürgerworkshop vom 30.11.2023
|
|
- Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Anregungen zu den Bauten
|
Die Stadt Füssen begrüßt die von den Bürgern und Bürgerinnen, Mieter und Mieterinnen vorgebrachten Nutzungsvorschläge. Die nachfolgende Auflistung, untergliedert in die einzelnen Gebäudeteile, stellt eine Auswahl an gewünschten Nutzungen dar. Durch die Festsetzung eines Urbanen Gebietes ist die baurechtliche Bedingung für eine durchmischte Nutzungsstruktur im zukünftigen Urbanen Quartier „Magnus Park“ gewährleistet.
Ausgeschlossen sind leidlich die Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Ferienwohnungen, Vergnügungsstätten, Tankstellen für fossile Brennstoffe und eine Entstehung von Einzelhandelsagglomerationen.
Die eingebrachten Vorschläge können in der weiteren Ausführungsplanung und Strukturierung des Quartiers vom Grundstückseigentümer berücksichtigt werden.
|
|
Lechbau
- Mehrgenerationenwohnen
- Jugendzentrum bzw. Ort für Jugendliche Allgemein
- Wohnnutzung zur Hälfte als Sozialwohnungen planen
- Ein weiterer Hotelanbau und / oder Neubau wird in Füssen nicht benötigt. Wir liegen was Tourismus anbelangt bereits über der Belastungsgrenze für Natur und Bürger.
- Lechbau Nord Veranstaltungen, 2 - 3 Ausstellungen, Konzerte, usw.
- Wenn Wohnraum, dann bezahlbar
- Mittagstisch für Handwerker
|
|
|
Mittelbau
- BMX / Dirt-Halle
- Festival „Lechrauschen“ vor Nutzungskonflikt schützen
- Tanzschule
- Indoor Paintball
- Escape Room
- Genügend Platz für das bereits bestehende Gewerbe (Kleingewerbe)
- Schwimmhalle
|
|
|
Südbau
- Indoor Skatehalle
- Fahrradwerkstatt
- Second-Hand Geschäft (Möbel & Bekleidung & Dinge des täglichen Gebrauchs)
- Akademien für kreatives (Musik, Tanz, Kunst)
- Kulturinitiative Füssen e.V.
- Integrative / Inklusive Begegnungsorte
- Inklusives Café / Werkstatt / Allg. Arbeitsstellen
- Kostengünstige Räumlichkeiten für die Kulturinitiative Füssen
- Kleinstgewerbeflächen 50 - 100 m²
- Ateliers (1. OG)
- Bandräume (1. OG)
- Kulturzentrum (Musikveranstaltungen, Tanz, Theater, Lesungen, Begegnungsort für ALLE, etc.)
- 2 - 3 verschieden große Räume für Veranstaltungen flexibel nutzbar, Lärmschutz beachten
- Wohnen
- Fotostudio
|
|
|
Faserzentrum
|
Die Stadt weist darauf hin, dass das ehem. Faserzentrum derzeit durch einen Ankermieter (Erhart GmbH, Werkzeug- und Gerätebau) belegt ist. Das bestehende Gewerbe soll gestärkt werden und nicht durch neue Nutzungen verdrängt werden. Das ehem. Faserzentrum ist Ende der 1980er Jahre aus Mitteln der Wirtschaftsförderung von Bund und Länder unter Einsatz des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten gefördert worden und war Bestandteil einer Kooperation des Freistaats Bayern mit dem Land Baden-Württemberg. Es soll nach dem Willen der Stadt Füssen erhalten werden.
|
|
Werkstatt
|
|
|
Heizhaus
|
|
|
Mobilitätshub
- Dachbegrünung auf Parkhaus
- Parken komplett auslagern an den Rand der Stadt (Infrastruktur ist in Füssen bereits ausgelastet)
|
Der geplante Mobilitätshub soll die Oberkante Fahrbahndecke der Tiroler Straße nicht übersteigen. Der Baukörper wird zudem in Teilbereichen an die bestehende Stützwand gebaut. Durch eine entsprechende Fassadengestaltung (z. B. Grünfassaden) kann das Parkhaus entsprechend in das historische Ensemble und Landschaftsbild integriert werden. Die Stadt Füssen stellt mit ihren Festsetzungen und ergänzenden vertraglichen Regelungen sicher, dass das Mobilitätshub entsprechend sensibel und in Abstimmung mit der Stadt und dem Denkmalschutz in das Areal integriert wird.
|
|
Anregungen zum Freiraum
|
|
- Extensive Wandbegrünung (an nicht denkmalgeschützten Fassaden)
- Bike / Dirtpark
- öffentlich nutzbare Grünflächen
- Urban-Gardening (Hochbeete, etc.)
- Biergarten nur mit Kastanien bepflanzen
- Nachhaltiger Wasserkreislauf (z.B. Zisternen für Regenwasser)
- Heimische Pflanzen pflanzen und Biodiversität fördern (#Wildbienen & andere Insekten, #Vögel)
- Einbau von Magnetstreifen für autonome Mobilität
- Kanal für eine „stehende“ Surfwelle anlegen, in der Nähe der geplanten Außengastronomie Lechbau Nord
|
Der Bebauungsplan enthält grünordnerische Festsetzungen, welche die historische Zeilenbebauung in ihrer Struktur unterstützen und stärken sollen. Die Details werden im Zuge einer nachfolgenden Freiraumplanung zu planen und gestalten sein.
|
|
Allgemeine Anregungen
|
|
- Barrierefreiheit
- Bezahlbare Mieten
- Emissionsgerechte Planung für Konfliktnutzungen, z. B. Hotel und Proberaum
- Füssens Bürger wollen kein weiteres Hotel! Auch ein Nieschenhotel bringt Konflikte mit anderen Nutzern.
- Lärmschutz für Anwohner für Anwohnerinnen / Hotelgäste und Koexistenz mit Veranstaltungen / Bandräume!
- Hauptnutzungen für Einheimische
|
|
Bilder:   |
|
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplanvorentwurfs.
|
|
|
Beschlussvorschlag
- Abwägung siehe oben stehende Einzelbeschlüsse
Verfahrensbeschluss: Der Stadtrat Füssen billigt den vom Büro OPLA ausgearbeiteten Entwurf zum Bebauungsplan S 55 „Mühlbachgasse“ in der Fassung vom 19.03.2024, mit den heute beschlossenen Änderungen. Die Verwaltung wird beauftragt, die Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.
Siehe Anlagen im Ratsinformationssystem.
Diskussionsverlauf
Frau Deckwerth ist sich bei den einzelnen Abwägungen uneins. Ihr fehlen hier Punkte, die damals bei der Präsentation des Projekts vorgestellt wurden. Sie bemängelt, dass auch hier die Abwägungen nur vorgetragen wurden. Sie sieht hier noch Diskussionsbedarf.
Herr Eichstetter stellt klar, dass er gerade alle Abwägungen von den unterschiedlichen Abteilungen vorgetragen habe, dies auch Teil der Sitzungseinladung war; er sieht hier keinen Verfahrensfehler.
Die Mitglieder des Stadtrates konnten in einer kleinen Diskussion einige Fragen zum Baufenster klären.
Beschluss 1
Der Stadtrat beschließt die Abwägung der Stellungnahmen Nrn. 04, 09, 10, 25, 33 und 35 gemäß den dazu ausgearbeiteten zuvor genannten Vorschlägen.
Siehe Anlagen im Ratsinformationssystem.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 17, Dagegen: 3
Beschluss 2
Der Stadtrat beschließt die Abwägung der Stellungnahmen Nrn. 03, 06, 07, 08, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 34, und 37 gemäß den dazu ausgearbeiteten zuvor genannten Vorschlägen.
Siehe Anlagen im Ratsinformationssystem.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 17, Dagegen: 3
Beschluss 3
Der Stadtrat beschließt die Abwägung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit (s. o. Punkt 2 Nr. 01) gemäß den dazu ausgearbeiteten zuvor genannten Vorschlägen.
Siehe Anlagen im Ratsinformationssystem.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 17, Dagegen: 3
Beschluss 4
Verfahrensbeschluss: Der Stadtrat Füssen billigt den vom Büro OPLA ausgearbeiteten Entwurf zum Bebauungsplan S 55 „Mühlbachgasse“ in der Fassung vom 19.03.2024, mit den heute beschlossenen Änderungen. Die Verwaltung wird beauftragt, die Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.
Siehe Anlagen im Ratsinformationssystem.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 17, Dagegen: 3
Dokumente
Download Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung saP_Füssen-Magnuspark_Relevanzprüfung_F2.pdf
Download Beschlüsse Abwägung, Verfahren 2024-03-07_BV_22047_MG.pdf
Download LA23-272-G02-01.pdf
Download Planzeichnung VA2024-03-07_P_22047_MG.pdf
Download Textliche Festsetzungen VA2024-03-07_TF_22047_MG.pdf
Download VA2024-03-18_B_22047_MG.pdf
zum Seitenanfang
8. Jugendparlament; Bericht des Jugendparlaments 2024
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
0241. Sitzung des Stadtrates
|
19.03.2024
|
ö
|
|
8 |
Sachverhalt
Thema 1: Aufgabenbereich des Jugendparlamentes
· Im Interesse aller Füssener Jugendlichen – regelmäßige Jugendfragestunden und Social-Media-Kanäle sowie Veranstaltungen für die Jugend; geringe Teilnahme von Jugendlichen
· Auf Belange von Kindern und Jugendlichen aufmerksam machen – Themen von Jugendkonferenz und -Fragestunden im Gremium sowie im Kinder- und Jugendbeirat angesprochen
· Beteiligung von politischen Planungs- und Entscheidungsprozessen ermöglichen – Teilnahme an Stadtratssitzungen mit der Meinung der Jugend; bisher kaum ermöglicht
· Politische Aufklärung und Bildung – Schulvorträge zu Partizipationsmöglichkeiten und Aufklärung zu politischen Themen (wie EU-Wahl, etc.)
Ziel: Mitgestaltung und Verbesserung des lokalen Lebensumfeldes – bisher kaum Resonanz
Thema 2: Vorstellung der Arbeit im Jugendparlament
• Aktuelle Planungen Basketballfeldlinien am vorhandenen Verkehrsübungsplatz
Aktueller Stand: Genehmigung der Polizei (hellblaue Linien, Verkehrsübungslinien nicht übermalen)
• Weitere Arbeitsschritte: Finanzen und Größe werden vom Tiefbauamt geklärt
Umsetzungsziel: Mai 2024 (Frühjahr 2024)
• Informations- und Aufklärungsveranstaltung(en) zur EU-Wahl ab 16 Jahre
Informationsvortrag und Planspiel am 24.04.2024 im Jugendtreff geplant
• Schulvorträge für 10. Und 11. Klassen – viel Resonanz, da SuS viel Interesse zeigen und Vorträge mit positivem Feedback bewertet werden; über Schulen bekommen wir mehr Aufmerksamkeit und erreichen mehr (aber nicht alle) Jugendliche
• Lange Nacht der Demokratie 2024
28. September – viel Planungsaufwand, da wir keine Unterstützung mehr vom KJR bekommen, da diese in einer anderen Kommune unterstützen werden
• Band- und Programmsuche – aufwendiger, da der Programmpunkt Landtagswahlen weg fällt → andere Ideen werden dringend gesucht
Kleinere Veranstaltungen:
• Schulvorträge zu Partizipationsmöglichkeiten in der Kommunalpolitik (bereits im Gymnasium Hohenschwangau abgehalten)
• Jugendfragestunden (keine festen Termine – kurzfristig, mind. 3 Wochen vorher, bekannt)
• Öffentliche Sitzungen des Jugendparlamentes
Thema 3: Neuwahl des Jugendparlamentes
§3 (1): Die Wahl findet alle zwei Jahre nach den Herbstferien und vor den Winterferien statt 2024!
Wahlordnung: Gewählt wird in den verschiedenen Schulen und am letzten Wahltag im Jufo Füssen Probleme von letzter Wahl: (vom P-Seminar ausgehend)
Berufsschule, sowie Förderschule wurden nicht berücksichtigt
Auszubildende, in Füssen wohnende aber außerhalb studierende, arbeitende und Schüler konnten nicht wählen, bzw. wussten nichts von der Wahl
Lösungsvorschläge:
- Wahlbenachrichtigung an alle wahlberechtigten 13 – 21-jährigen per Post (zu teuer/Kosten?!)
Online-Wahl – wie erreicht man alle Jugendliche, wie kontrolliert man, ob alle Jugendliche wahlberechtigt sind?
Über alle Schulen – gleiche Problem wie letztes Jahr: wie erreichen wir Jugendliche, die nichtmehr auf Füssener Schulen gehen?
Kandidatengewinnung:
2 von aktuell 7 aktiven Jugendlichen aus dem Parlament lassen sich neu aufstellen
- Wie gewinnen wir neue Interessenten?
- Social Media – nicht ausreichende Reichweite
- Presseartikel – viele Jugendliche lesen nicht selbst Zeitung, höchstens die Eltern, welche informieren könnten
- Schulvorträge – es werden wieder nicht alle berechtigten erreicht
- Was passiert, wenn sich nicht genug Jugendliche bereiterklären?
Diskussionsverlauf
Herr Lukas Grosch bedankt sich bei den Mitgliedern des Stadtrates für die Möglichkeit der Vorstellung der Tätigkeiten des Jugendparlaments. Er würde sich über einen regelmäßigen Austausch sehr freuen.
Stadtrat Eggensberger gibt den Tipp, für die Anwerbung neuer Mitglieder für das Jugendparlament auf die IHK Schwaben und die Handwerkskammer zuzugehen. Sie können die Auszubildenen anschreiben und über das Jugendparlament informieren.
Auch Stadträtin Deckwerth verweist auf die Gewerkschaftsjugend die hilfreich sein könnte.
Stadtrat Wolfgang Bader fügt an, dass es in der Förderschule aktive Ansprechpartner dafür gäbe. Er bedankt sich bei Herrn Grosch und dem Jugendparlament für das große Engagement. Der Bildungsauftrag ist enorm wichtig und befürwortet eine regelmäßige Vorstellung im Stadtrat oder in einer der Ausschusssitzungen.
zum Seitenanfang
9. Veränderung Mobilfunk-Sendeanlage Bad Faulenbach
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
0241. Sitzung des Stadtrates
|
19.03.2024
|
ö
|
Bekanntgabe
|
9 |
Sachverhalt
Auf der Geländeerhebung zwischen Bad Faulenbach und dem Maxsteg befindet sich eine Mobilfunksendeanlage von Vodafone. Die Anlage dort ist relativ unscheinbar. Sie ist im Westen und Norden von Bewuchs verdeckt, auch von Osten und Süden her fällt der Sender durch die rückwärtigen Bäume kaum auf.
Am 10.01.2024 hat die Firma Vantage Towers (für Vodafone) die Grundstückeigentümerin Stadt Füssen informiert, dass die derzeitige Technik um LTE und 5G erweitert werden soll.
Es bestehen aktuell vertragliche Einschränkungen für den Netzbetreiber:
Derzeit ist nur eine Nutzung durch Vodafone zugelassen, die Masthöhe ist auf 10m und die Technik auf GSM beschränkt.
Eine Erweiterung des bestehenden Standorts ist vom aktuellen Nutzungsvertrag nicht abgedeckt, so dass ein neuer Nutzungsvertrag abgeschlossen werden soll.
Die Stadt Füssen hat die Sachlage mit ihrem Mobilfunkberater IB Weller geprüft. Der neue vorgelegte Vertragsentwurf ist nach Prüfung und Vergleich mit einer Mustervorlage des Bayerischen Gemeindetages ein üblicher Vertrag, der alle Technologien, Frequenzbänder und Mitnutzer zulässt:
- Nutzungsbeschränkungen auf GSM entfallen
- Masthöhe darf von 10m auf 20m erhöht werden
- Die Pachtfläche erhöht sich um 15qm auf 50qm
- Vantage Towers AG (für Vodafone) ist berechtigt, Dritten ihre Mietfläche und Mast zur Mitnutzung unterzuvermieten.
Von den drei anderen Mobilfunkbetreibern liegen diesbezüglich folgende Stellungnahmen vor:
- Telefonica hat ein konkretes Mitnutzungsinteresse mitgeteilt aufgrund von Netzschwächen in diesem Bereich
- die Deutsche Telekom mit der DFMG verfügt über Sendeanlagen auf dem Kamin Magnuspark.
Solange die Bausubstanz es zulässt, soll dieser Standort erhalten bleiben.
- 1&1 Drillisch hat keine Stellungnahme abgegeben.
Ziel der Stadt Füssen ist aus Gründen von Landschaftsbild und Landschaftsschutz eine Bündelung der Netzbetreiber an einem Standort. Eine Ablehnung von Standorten hat in der Regel die Folge, dass sich die Netzbetreiber zukunftsfähige Standorte auf Privatgrund besorgen. Schlimmstenfalls würde das für den aktuellen Fall bedeuten, dass 2 Suchkreise für 2 Standorte (Ortsteil Bad Faulenbach und Ortsteil Ziegelwies) akzeptiert werden müssen.
Der beabsichtigte Standort-Ausbau durch Vodafone wurde uns wie folgt mitgeteilt:
- zunächst sollen auf dem bestehenden 10m-Mast die Antennen getauscht und die Technik auf 4G und 5G erweitert werden
- wenn die Mitnutzung durch wenigstens einen anderen Netzbetreiber gesichert ist, soll dann ein neuer höherer Mast für die Anlagen der betreffenden Interessenten gebaut werden
Für die erforderlichen Genehmigungen werden die entsprechenden Fachbehörden eingebunden sein (z.B. die Untere Naturschutzbehörde wegen Landschaftsschutz, Fauna-Flora-Habitat, Vogelschutz usw.).
Diese Informationen über die Ausbauabsichten werden in transparenter Form bekanntgegeben. Die Details des Pachtvertrags müssen im nichtöffentlichen Teil der Sitzung beschlossen werden.
Beschlussvorschlag
Der Stadtrat stimmt dem Ausbau des Standorts zu.
Beschluss
Der Stadtrat stimmt dem Ausbau des Standorts zu.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 20, Dagegen: 0
zum Seitenanfang
10. Auflösung der Vereinbarung des KOD vom 28.02./24.04.2012 über die Überwachung des ruhenden Verkehrs in Seeg
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
0241. Sitzung des Stadtrates
|
19.03.2024
|
ö
|
beschliessend
|
10 |
Sachverhalt
Seit 2012 überwacht die kommunale Verkehrsüberwachung der Stadt Füssen auch den ruhenden Verkehr im Gemeindegebiet Seeg. Rechtsgrundlage hierfür ist die Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Füssen und der Gemeinde Seeg vom 28.02./24.04.2012.
Wir haben festgestellt, dass in Seeg seit Jahren schon kaum mehr Parkverstöße zu verzeichnen sind (in den Jahren 2019, 2021 und 2022 wurde keine einzige Verwarnung ausgestellt, im Jahr 2018 fünf Verwarnungen, 2020 sieben Verwarnungen und 2023 vier Verwarnungen), so dass sich der Personalaufwand in Seeg nicht mehr lohnt.
Die Verwaltung hat deshalb mit Schreiben vom 15.02.2024 der Gemeinde Seeg mitgeteilt, mit deren Einverständnis die Zweckvereinbarung zum Jahresende kündigen zu wollen. Mit Antwortschreiben vom 19.02.2024 hat sich die Gemeinde Seeg mit der Beendigung der Verkehrsüberwachung zum Jahresende einverstanden erklärt.
Nach § 8 Abs. 2 der Zweckvereinbarung kann die Vereinbarung mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines jeden Kalenderjahres gekündigt werden.
Beschlussvorschlag
Die Zweckvereinbarung vom 28.02./24.04.2012 über die Überwachung des ruhenden Verkehrs in Seeg durch die Stadt Füssen wird zum 31.12.2024 gekündigt.
Beschluss
Die Zweckvereinbarung vom 28.02./24.04.2012 über die Überwachung des ruhenden Verkehrs in Seeg durch die Stadt Füssen wird zum 31.12.2024 gekündigt.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 20, Dagegen: 0
zum Seitenanfang
11. Zweite Satzung zur Änderung der Gebührensatzung Mittagsbetreuung/Verlängerte Mittagsbetreuung an der Grundschule Füssen
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
0241. Sitzung des Stadtrates
|
19.03.2024
|
ö
|
beschliessend
|
11 |
Sachverhalt
Da sich ab dem neuen Schuljahr die Kosten der Kath. Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF Augsburg) für das Mittagessen von 5,20 € auf 5,70 € erhöhen, muss die Verpflegungsgebühr in § 6 der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der Mittagsbetreuung und verlängerten Mittagsbetreuung an der Grundschule Füssen (Gebührensatzung Mittagsbetreuung/Verlängerte Mittagsbetreuung) angepasst werden.
Darüber hinaus wird auf Wunsch des Trägers bei der Ferienbetreuungsgebühr die kurze Betreuungszeit von 13.00 Uhr auf 14.00 Uhr erweitert und ebenfalls in der Satzung angepasst.
Die Änderungen sind mit dem Träger der verlängerten Mittagsbetreuung, die Kath. Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF Augsburg) besprochen.
Wichtig:
Die Kosten für die Mittagsbetreuung kommen nicht von der Stadt Füssen, sondern vom Träger und werden 1:1, ohne Aufschläge durch die Stadt Füssen an die Eltern weitergegeben.
Beschlussvorschlag
Der Stadtrat stimmt dem Erlass der Zweiten Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Betreuungsgebühren – Rubrik: „Verpflegungsgebühr §6“ für den Besuch an der Mittagsbetreuung und verlängerten Mittagsbetreuung an der Grundschule Füssen mit Wirkung zum 1. September 2024 wie vorgetragen zu.
Beschluss
Der Stadtrat stimmt dem Erlass der Zweiten Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Betreuungsgebühren – Rubrik: „Verpflegungsgebühr §6“ für den Besuch an der Mittagsbetreuung und verlängerten Mittagsbetreuung an der Grundschule Füssen mit Wirkung zum 1. September 2024 wie vorgetragen zu.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 20, Dagegen: 0
zum Seitenanfang
12. Bekanntgaben
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
0241. Sitzung des Stadtrates
|
19.03.2024
|
ö
|
beschliessend
|
12 |
Sachverhalt
Es wird auf geänderte Öffnungszeiten in den Museen im Sommer hingewiesen.
Anstatt bisher von 11 Uhr bis 17 Uhr wird im Sommer 2024 die Uhrzeit verkürzt auf 11 Uhr bis 16 Uhr.
zum Seitenanfang
13. Vollzug der Geschäftsordnung - Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 27.02.2024
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
0241. Sitzung des Stadtrates
|
19.03.2024
|
ö
|
beschliessend
|
13 |
Beschlussvorschlag
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 27.02.2024 wird genehmigt.
Beschluss
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 27.02.2024 wird genehmigt.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 20, Dagegen: 0
zum Seitenanfang
14. Anträge, Anfragen
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
0241. Sitzung des Stadtrates
|
19.03.2024
|
ö
|
beschliessend
|
14 |
Diskussionsverlauf
Stadtrat Adam schlägt vor, den Markt wieder in die „Innere Kemptenerstraße“ zu verlegen, wie früher. Hintergrund ist die Einnahmegenerierung am Morisseparkplatz zu den Marktzeiten.
Herr Eichstetter gibt an, dass dies bereits zweimal versucht wurde. Es wurden mit allen Marktanbietern gesprochen, diese lehnen aber die Variante noch ab.
Ein Testlauf wäre jedoch möglich, mit dem EWR wurde die Stromversorgung bereits abgesprochen. Im Jahr 2025 könne man sich einen Testlauf vorstellen.
Herr Peresson erinnert an die Fassadengestaltung des Bauprojekts in der Reichenstraße, hier sollte die Kontrolle nicht versäumt werden.
Herr Eichstetter pflichtet bei, dass diese Woche die Baukontrolle durch das Landratsamt Ostallgäu stattfinden wird. Die Ergebnisse werden der Stadtverwaltung unverzüglich mitgeteilt und zudem wurde darauf hingewiesen, die Stadträte Peresson und Dr. Böhm zur Besichtigung mit einzuladen.
Datenstand vom 25.03.2025 16:08 Uhr