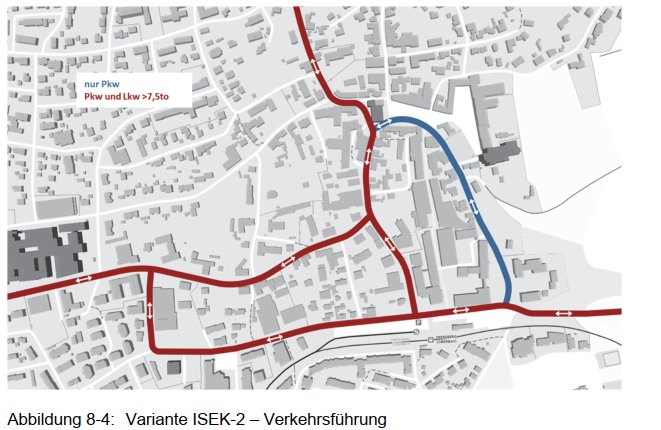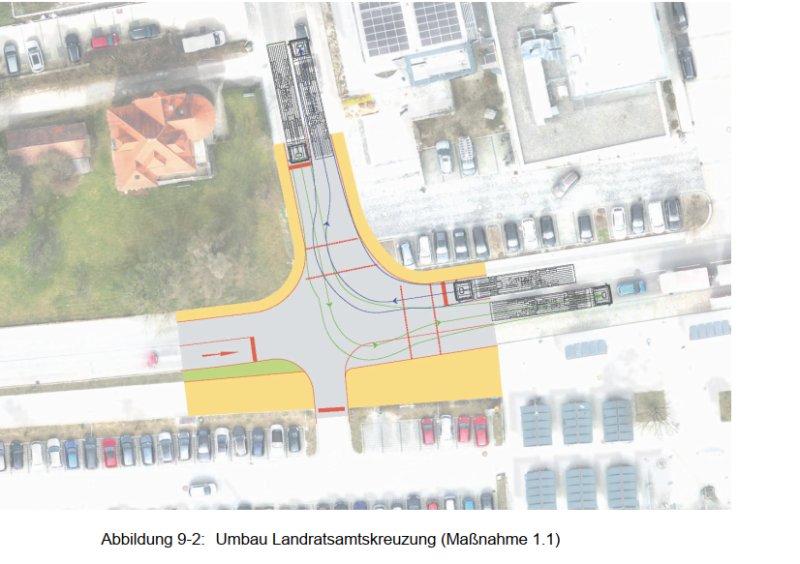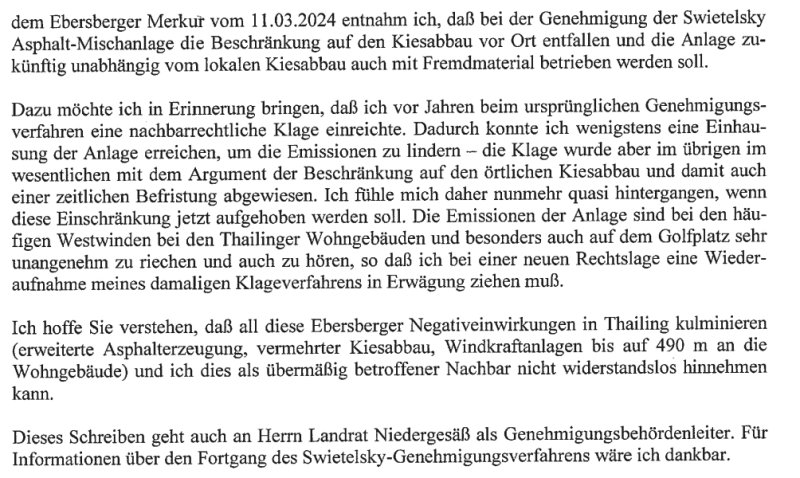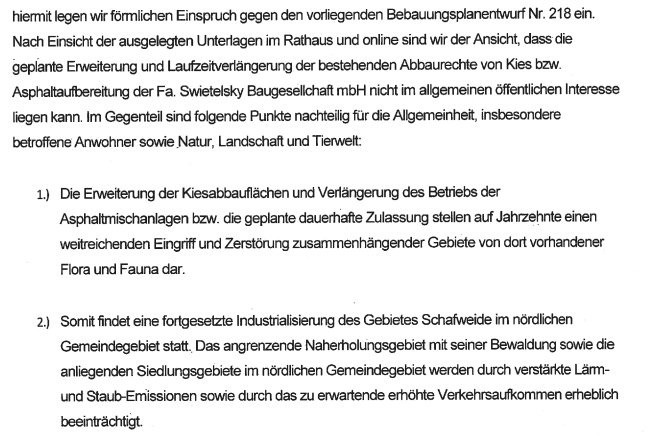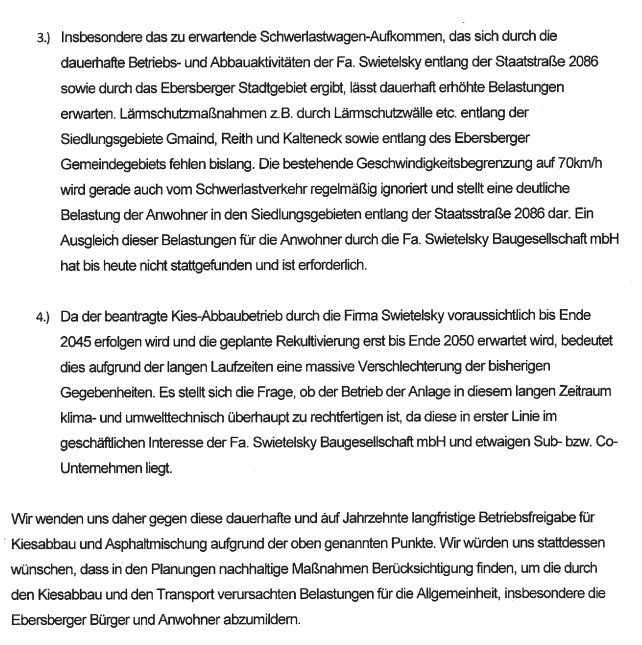Datum: 05.11.2024
Status: Niederschrift
Sitzungsort: Sitzungssaal Rathaus
Gremium: Stadtrat
Öffentliche Sitzung, 19:00 Uhr bis 22:58 Uhr
Nichtöffentliche Sitzung, 22:58 Uhr bis 23:05 Uhr
Öffentliche Sitzung
| TOP-Nr. |
Bezeichnung
|
| 1 |
Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Sitzung des Ferienausschusses am 20.08.2024 gefassten Beschlüsse
|
| 2 |
Integriertes Mobilitätskonzept für die Stadt Ebersberg;
a) Vorstellung und Empfehlung der Annahme des Konzeptes;
b) Behandlung der Empfehlungen des AK Verkehr
|
| 3 |
Kindergarten St. Sebastian, Finanzierungszusage
|
| 4 |
Kindergarten Ringstraße
Vorstellung Überarbeitung Entwurf und Kostenberechnung
|
| 5 |
Tiefgarage bei KiTa St. Sebastian
|
| 6 |
15. Flächennutzungsplanänderung, Änderung einer Kiesabbaufläche in ein Sondergebiet (SO) Asphaltmischanlage, FlNr. 3294, 3295, 3284 TFl., 3285 TFl., 3283 TFl., jeweils Gemarkung Oberndorf (Teilgebiet A);
Behandlung der Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB;
Empfehlung für den Feststellungsbeschluss
|
| 7 |
17. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan - "Sondergebiet Windenergie Föhrenpold";
Ausweisung eines Sondergebiets Windenergienutzung nordwestlich der Ortschaft Pollmoos (FlNr. 1829, 1830, 1831, 1833, 1538/5, 1538/4, 1540, 1787 jeweils Gemarkung Oberndorf);
Behandlung der Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB);
Empfehlung für den Feststellungsbeschluss
|
| 8 |
19. Änderung des Flächennutzungsplanes-Bereich westlich der Hohenlindener Straße, östlich der Schwabener Straße;
Behandlung der Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB);
Empfehlung des Feststellungsbeschlusses
|
| 9 |
Verordnung über die verkaufsoffenen Sonntage im Jahr 2025
|
| 10 |
Antrag der Frauenunion Ortsverband Ebersberg auf Aufstellung einer weiteren Beerdigungsmöglichkeit in Ebersberg
|
| 11 |
Ausfallbürgschaft Gautrachtenfest 2027
|
| 12 |
Verschiedenes
|
| 13 |
Wünsche und Anfragen
|
Sitzungsdokumente öffentlich
Download Bekanntmachung.pdf
Download Niederschrift nur öff.pdf
zum Seitenanfang
1. Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Sitzung des Ferienausschusses am 20.08.2024 gefassten Beschlüsse
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
05.11.2024
|
ö
|
informativ
|
1 |
Sachverhalt
In der Sitzung des Ferienausschusses am 20.08.2024 wurde die Einstellung einer Mitarbeiterin, die Veräußerung eines Erbbaurechts, ein städtebaulicher Vertrag sowie diverse Auftragsvergaben beschlossen.
zum Seitenanfang
2. Integriertes Mobilitätskonzept für die Stadt Ebersberg;
a) Vorstellung und Empfehlung der Annahme des Konzeptes;
b) Behandlung der Empfehlungen des AK Verkehr
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Technischer Ausschuss
|
Sitzung des Technischen Ausschusses
|
14.05.2024
|
ö
|
vorberatend
|
7 |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
05.11.2024
|
ö
|
beschließend
|
2 |
Sachverhalt
Zu a)
Der Stadtrat der Stadt Ebersberg hat in seiner Sitzung vom 14.12.2021 auf eine Empfehlung des AK Verkehr beschlossen, ein Integriertes Mobilitätskonzept für die Stadt Ebersberg aufzustellen.
Nach Durchführung einer beschränkten Ausschreibung wurde am 10.05.2022 der Auftrag an das Büro BVR aus Innsbruck vergeben.
Bis zum heutigen Tag wurden mehrere Sitzungen im AK Verkehr zu diesem Thema abgehalten in denen eine umfassende Leitidee des Integrierten Mobilitätskonzeptes für Ebersberg erarbeitet wurde.
Parallel dazu wurden umfassende Erhebungen des Verkehrsgeschehens in Ebersberg durchgeführt, um eine wissenschaftlich gesicherte Datenbasis zu gewinnen. Neben den Zählungen und Messungen wurde auch eine Haushaltsbefragung durchgeführt; hierzu wurden insgesamt rund 900 Ebersberger Haushalte angeschrieben und nach ihrem Verkehrsverhalten an einem bestimmten Stichtag befragt.
In zwei Bürgerversammlungen hatten die Anwesenden Gelegenheit sich mit dem Thema zu befassen, mit den Vertretern des Verkehrsplanungsbüros ins Gespräch zu kommen und auf den ausgehängten Plänen und Plakaten Ihre Anregungen zu vermerken.
Zusätzlich zu der vorgenannten Öffentlichkeitsbeteiligung wurden verschieden Fokusgruppen speziell beteiligt. Diese waren die Gruppe der Senioren, der Jugendlichen (8er-Rat) sowie der Kinder (Grundschulalter).
Mit dem Integrierten Mobilitätskonzept wurde ein übergeordnetes Leitbild für die Stadt Ebersberg im Hinblick auf das künftige Verkehrssystem und dessen Entwicklung sowie zahlreiche Maßnahmenvorschläge inklusive fachlicher Priorisierung erarbeitet. Beides wird nun zur Abstimmung vorgeschlagen:
„In der Stadt Ebersberg soll das Verkehrssystem
negative Effekte vermeiden und auch künftig
zum Erhalt und zur Verbesserung von
Lebensqualität und Wirtschaftskraft beitragen
und dabei die notwendigen Mobilitätsansprüche
von Bevölkerung, Gästen und Wirtschaft
berücksichtigen.“
Das Mobilitätskonzept liegt nun in drei Teilen, dem Teil 1 – Analyse und dem Teil 2 – Lösungen und Maßnahme und dem Teil 3 – Materialband vor. Auf die beiliegenden Sitzungsunterlagen wird verwiesen.
Ziel der heutigen Sitzung ist die Empfehlung an den Stadtrat, das Konzept in den drei Teilen anzunehmen und zu beschließen. In der darauffolgenden Zeit muss an der schrittweisen Umsetzung des Konzeptes gearbeitet werden.
Bei der Konzeptumsetzung ist allerdings stets die haushaltsrechtliche Lage der Stadt in Blick zu nehmen. Seitens der Verwaltung wird darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Maßnahmen nicht um Pflichtaufgaben handelt und größere bauliche Maßnahmen den entsprechenden zeitlichen Vorlauf haben und zuerst finanziell abgesichert sein müssen.
Zum weiteren Vorgehen wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, dass sich nach den Beratungen im TA eine weitere Öffentlichkeitsphase anschließen soll. Dies könnte zum einen über eine Ausstellung der Ergebnisse im Rathaus, die individuell besucht werden kann und / oder über eine Online-Beteiligung (Veröffentlichung auf der Homepage mit der Möglichkeit Stellungnahmen abzugeben) erfolgen.
Alle Interessierten können sich dann zu dem Konzept nochmals äußern. Die Reaktionen würden von der Verwaltung gesammelt und unter fachlicher Begleitung des Planungsbüros dem TA/StR vorgelegt.
Im Anschluss daran sollte der Stadtrat das Konzept endgültig beschließen.
In der Sitzung des AK Verkehrs vom 26.02.2024 wurde die Frage aufgeworfen, ob zur Konzeptumsetzung weiterhin die Begleitung durch den AK-Verkehr erforderlich ist. Aus Sicht der Verwaltung und der Moderation (Dr. Stegen) sind mit dem vorliegenden Konzept alle Aufgaben aus dem Auftrag des AK Verkehrs abgearbeitet.
Eine Entscheidung über die weitere Beteiligung des AK-Verkehr hat der Technische Ausschuss zu treffen.
Zu b):
In der letzten Sitzung des AK Verkehr am 26.02.2024 befasste man sich intensiv mit dem Bereich der Maßnahmen und Lösungen.
Der AK Verkehr entwickelte im Zuge der Beratungen drei einstimmige Beschlussempfehlungen an den Technischen Ausschuss. Über diese Punkte ist im TA zu beraten und abzustimmen:
- Schulstraße und Elternbahnhof
- Sektorales Fahrverbot
- Innerörtliche Staatsstraßenverlegung mit dem staatl. Bauamt besprechen
Zu 1: Schulstraße:
Aus den Ergebnissen der Haushaltsbefragung lässt sich ableiten, dass der überwiegende Teil der Schulkinder umweltfreundlich zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommt. Zu Fuß ist für die Grund- und Mittelschule (GMS) aus den Stadtteilen überwiegend eine gute Erreichbarkeit entlang von zentralen Wegachsen möglich, die an den Querungsstellen durch Lichtsignalanlagen, Fußgängerüberwege (Zebrastreifen) und/oder Verkehrshelfer gesichert sind. Handlungsbedarf besteht
diesbezüglich vor allem für den Bereich Eggerfeld im Nordosten des Stadtgebietes, von wo eine sichere Querung der St2080 derzeit zum Teil nur mit größeren Umwegen möglich ist (siehe Maßnahmen 2.5 und 2.6 des Konzeptes).
Dagegen wird nur ein kleiner Teil der Schulkinder mit dem Auto gebracht, unter anderem weil keine oder nur ungenügende Alternativen zur Verfügung stehen, vermutlich oft aber auch aufgrund einer subjektiven Wahrnehmung von Sicherheitsdefiziten im Zuge des Schulweges. Der daraus resultierende Kfz-Verkehr führt daher regelmäßig zu unübersichtlichen Situationen im unmittelbaren Schulumfeld und damit letztlich zu einer zunehmend auch objektiven Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit.
Um diesen Kreislauf nachhaltig zu durchbrechen, ist die Vorlage eines Masterplans zur Reduzierung des Bring- und Holverkehrs im Schulumfeld erforderlich, der neben einer grundlegenden Bewusstseinsbildung die punktuelle Umsetzung von sozialen, gestalterischen bzw. verkehrsorganisatorischen und rechtlichen Maßnahmen erfordert. Besonders effizient sind dabei rechtliche Maßnahmen, wobei sich deren Geltung auch direkt aus dem jeweiligen Umfeld ableiten lassen sollte. In Italien, den Niederlanden oder Österreich zählt dazu die Einrichtung von Schulstraßen (Maßnahme 3.10.1), um so die
Zufahrt unmittelbar vor das Schultor effektiv zu unterbinden und damit eine Entflechtung von zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommenden Kindern und insbesondere kurz vor Schulbeginn sich verdichtenden Kfz-Fahrten zu bewirken. Im Detail beinhaltet das Maßnahmenpaket für die Umsetzung einer Schulstraße ein kurzzeitiges Fahrverbot für Kraftfahrzeuge, das Radfahren in Schrittgeschwindigkeit, das Gehen auf der Fahrbahn und eine mechanische Absperrung etwa durch ein Scherengitter (Absperrschranke).
In Deutschland ist die Umsetzung von Schulstraßen in der Straßenverkehrsordnung derzeit noch nicht vorgesehen. Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, durch ein zeitlich auf Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende beschränktes Einfahrtsverbot Konfliktsituationen im Schulumfeld zu entschärfen und in den übrigen Zeiträumen die Straßen für den gesamten Verkehr offen zu halten.
Konkret wird für den Bereich der GMS empfohlen, an den aus Abbildung 9-20 des Integrierten Mobilitätskonzeptes ersichtlichen Punkten die Einfahrt in die Floßmannstraße, die Baldestraße, die Candid-Huber-Straße und die Bürgermeister Müller Straße in einem Zeitraum von jeweils 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende zu verbieten. Auszunehmen ist der Radverkehr, zudem ist das Befahren der Straßenabschnitte innerhalb dieses Bereiches ebenso wie das Ausfahren gestattet. Allenfalls kann auch für das Zufahren eine Ausnahmeregelung für Anrainer der genannten Straßenzüge erfolgen.
Abbildung 9-20: Schulstraße (Maßnahme 3.10.1)
Ergänzend zu den temporären Einfahrtsverboten soll für die nicht vermeidbaren Bring- und Holverkehre eine adäquate Lösung vorgesehen werden, ohne die Verkehrssicherheit im Umfeld der GMS zu beeinträchtigen oder das Verkehrssystem im Wohnquartier zu belasten. Empfohlen wird die Einrichtung eines sogenannten Elternbahnhofs (Maßnahme 3.10.2) am östlichen Ende der Baldestraße im Bereich der Wertstoffinsel (Abbildung 9-21).
Vorgesehen ist eine Kiss+Go-Zone, an der mehrere Kfz gleichzeitig anhalten und Kinder aussteigen oder abgeholt werden können. Die Zufahrt erfolgt von der Eberhardstraße in die Baldestraße und von dort – unmittelbar vor dem Beginn der Schulstraße – in Einbahnführung über den bestehenden Parkplatz zurück zur Eberhardstraße. Die Kinder können direkt auf den angrenzenden Gehweg aussteigen und die Schule von dort sicher erreichen. Erforderlichenfalls ist eine Ausweitung des Angebotes für Kiss+Go ohne maßgebliche Beschränkung der bestehenden Kfz-Stellplätze möglich.
Bei Umsetzung dieser Maßnahme bedarf es vor Erlass der verkehrsrechtlichen Anordnung jedenfalls der direkten Einbeziehung/Information (Anhörung gem. Art. 28 BayVwVfG) der betroffenen Bevölkerung, der Schule sowie der Polizei. Der Anordnung ist eine tragfähige Begründung gem. § 45 StVO beizugeben, die u. a. durch vertiefte Untersuchungen (Auswirkungen auf die umliegenden Straßen, Verkehrsverlagerungen, positive Effekte etc.) zu erstellen ist.
Zu 2: sektorales Fahrverbot:
Mit dieser Regelung soll ein Durchfahrtverbot auf dem innerörtlichen Straßennetz (vorwiegend Eberhardstraße/Schwabener Straße) für Nutzfahrzeuge mit einer Gesamtmasse von mehr als 7,5 t erreicht werden (vgl. Maßnahme 3.21, S. 104 ff Maßnahmenkonzept). Im Integrierten Mobilitätskonzept ist dargelegt, dass das übergeordnete Straßennetz im Zuge der B 15 und der A99 / A 94 sowie der B304 eine zumutbare und geeignete Alternative für den nicht auf die Stadt und die Gemeinden des Landkreises bezogenen Schwerverkehr darstellt und deswegen jegliche Verlagerung in andere schutzwürdige Gebiete – wie etwa das Stadtgebiet von Ebersberg – unterbunden werden kann.
Da die Stadt hier aus straßenrechtlichen Gründen keine Anordnungsbefugnis hat muss diese Maßnahme mit den zuständigen Behörden (Straßenbauamt Rosenheim, LRA Ebersberg) besprochen werden. Um an diese Behörden heranzutreten, benötigt die Verwaltung allerdings einen entsprechenden Beschluss als Ausdruck des städtischen Willensbildungsprozesses.
Im Zuge des Fahrverbots wurde in einer früheren Sitzung des AK Verkehr über die Erstellung eines Lärmaktionsplanes beraten und dem Stadtrat empfohlen. Dieser hat mit Beschluss vom 14.12.2021 den Beschluss angenommen.
Für den Lärmaktionsplan müssen Kosten von ca. 20.000,- € veranschlagt werden. Diese sind aufgrund der angespannten Haushaltssituation im Haushaltsplan 2024 nicht vorgesehen. Aufgrund der begrenzten Verwaltungskapazitäten wurde zunächst und vordringlich das Integrierte Mobilitätskonzept auf den Weg gebracht.
Aufbauend auf das IMK könnte nun, sofern die Mittel hierfür bereitgestellt werden können, der Lärmaktionsplan beauftragt werden.
Zu 3: Innerörtliche Staatsstraßenverlegung mit dem staatlichen Bauamt besprechen:
Dies beinhaltet die Idee, die St. 2080 innerörtlich zu verlegen und zwar in beide Fahrtrichtungen auf den Straßenzügen Bahnhofsplatz – Eichthalstraße – Heinrich-Vogl-Straße. Diese Lösung würde es ermöglichen, den Marienplatz vom Schwerverkehr freizuhalten und dadurch eine signifikante Verbesserung der Aufenthaltsqualität zu erreichen, da der verbleibende PKW-Verkehr auf dem Marienplatz deutlich unter dem für „Shared-Space“ bzw. für eine Begegnungszone erforderlichen Grenzwert von rund 10.000 kfz/24 Std. liegen würde (vgl. Maßnahme Nr. … S. …ff)
Es wird an dieser Stelle nochmals deutlich herausgestellt, dass mit der Maßnahme „Staatsstraßenverlagerung“ kein Neubau einer Umgehungsstraße angesprochen wird.
Im AK Verkehr wurde hierzu aufgrund eines Missverständnisses bei der Priorisierung keine einvernehmliche Empfehlung verfasst. Vielmehr handelt es sich bei diesem Vorschlag um die vornehmliche Empfehlung der Gutachter. Aufgrund dieser Situation ergeben sich zwei weitere Bearbeitungsvarianten:
a) wie dargelegt Gespräche mit dem StBA und Umbau LRA-Kreuzung, B-Plan etc.
b) vertiefende Untersuchungen von Trassenkorridoren, Geologie, Lärm-, Arten- und
Naturschutz etc.
c) a und b parallel
Mit dem Vorschlag der Gutachter wird im Integrierten Mobilitätskonzept damit eine Neuordnung bzw. eine andere Verkehrsführung innerhalb Ebersbergs empfohlen. Die beabsichtigte Verkehrsführung in der Innenstadt soll sich nach der sog. Variante ISEK-2 richten. Grundlage ist die bereits im Verkehrskonzept von 2010 ausgearbeitete und im ISEK vom 2011 als Ausbaustufe 2 zur mittel- bis langfristigen Umsetzung empfohlene Verkehrsführung entsprechend nachfolgender Abbildung:
Diese Maßnahme erfordert allerdings zwingend den Umbau der Landratsamtskreuzung (Eichthal-/Dr.-Wintrich-Straße/Bahnhofsplatz). Empfohlen wird hier die Errichtung einer vollständigen, verkehrsabhängigen Lichtsignalanlage sowie die Vergrößerung des innenliegenden Radius (vgl. Maßnahme 1.1, S. 53 ff und nachfolgende Abbildung 9-2):
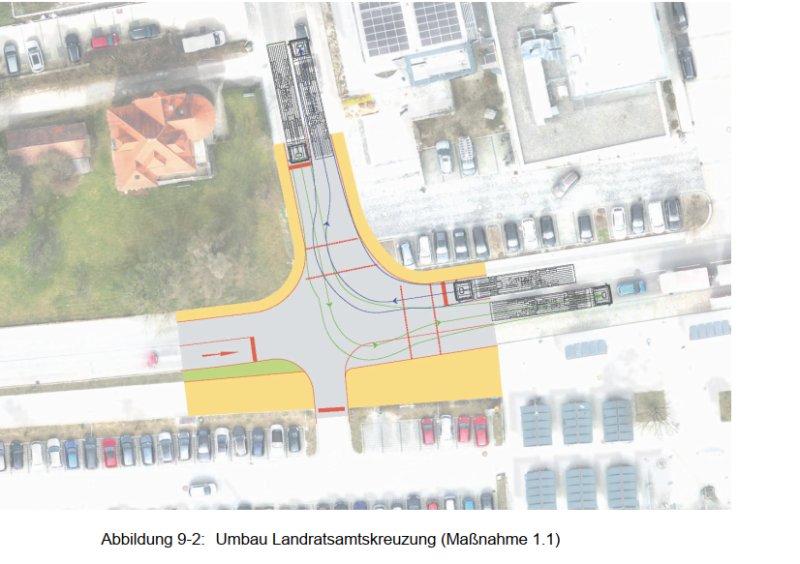
Weiterhin muss die bestehende Engstelle an der Heinrich-Vogl-Straße berücksichtigt werden (vgl. Maßnahme 1.4, S. 55 ff). Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass für den Bereich der Engstelle aufgrund des historisch gewachsenen Ortskerns und unter Berücksichtigung einer geringen Geschwindigkeit (≤ 40km/h) von eingeschränkten Bewegungsspielräumen und einem jedenfalls teilweisen Entfall von Sicherheitsräumen ausgegangen werden kann. Der erforderliche Raumbedarf kann daher mit 5,9 m beim Begegnungsfall LKW – LKW angesetzt werden. An der besagten Engstelle beträgt die Fahrbahnbreite inklusive Schutzstreifen derzeit knapp 6 m und erfüllt damit den unter Voraussetzung der örtlichen Gegebenheiten erforderlichen Raumbedarf bei reduzierter Geschwindigkeit.
In weiteren Schritten soll in diesem Bereich im Zuge der Bebauungsplanung im Bereich der Heinrich-Vogl-Str. 5 und 7 einerseits auf eine Verbreiterung der Fußgängerverkehrsanlagen (Gehwege) und andererseits auf eine geringfügige Aufweitung des Straßenquerschnitts hingewirkt werden. Dies ist ebenfalls bereits Bestandteil der Sanierungssatzung „Altstadt“; diese hat u. a. die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse zu Inhalt.
Die hat zur Folge, dass bei Neubebauungen in diesem Bereich zwingend ein Abrücken der Gebäude vom Fahrbahnrand erforderlich sein wird.
Die Maßnahme „Umfahrung“ wurde im Konzept ebenfalls behandelt (vgl. Ziff. 8.2.2 ff, S. 17 ff). Diese Lösung wurde in drei Untervarianten gegliedert – Umfahrung OST, Umfahrung MITTE (Tunnel) und Umfahrung WEST.
Bei der Umfahrungslösung würde ein Teil des KFZ-Verkehrs (Durchgangsverkehr) räumlich auf eine Umgehungsstraße verlagert. Ein wesentlicher Teil des Verkehrsaufkommens im Bereich der Stadt Ebersberg (Ziel- und Quellverkehr) verbleibt allerdings auf dem bestehenden Straßennetz. Die Analysedaten ergaben ein Gesamtverkehrsaufkommen von ca. 42.000 Kfz-Fahrten/24 Std in Ebersberg. Mit einer Umfahrung würde einen Anteil von ca. 18% (reiner Durchgangsverkehr, der kein Ziel oder keine Quelle in Ebersberg hat) des Verkehrsaufkommens verlagert werden können. Jeweils ca. 32 % des Verkehrsaufkommens betrifft den sog. Ziel- und Quellverkehr (insgesamt somit 66%), der durch eine Umgehungsstraße nicht verlagert werden würde und somit weiterhin im Stadtgebiet abgewickelt werden muss. Der Rest (16%) ist der Binnenverkehr.
Das Konzept kommt zum Ergebnis, dass eine Umfahrung OST vergleichbare Verlagerungseffekte wie die in der Vergangenheit betrachtete kurze Tunnelvariante zwischen Wasserburger Straße und Klostersee (Umfahrung MITTE) bringen würde.
Vertiefte Untersuchungen zu Trassenkorridoren, Geologie, Lärm-, Arten- und Naturschutz etc. sowie etwaige Verkehrszahlen waren nicht Gegenstand des Integrierten Mobilitätskonzeptes und müsste ggfs. in weiteren Planungsprozessen untersucht werden.
Weiteres Vorgehen / Konzeptumsetzung:
Zur Umsetzung des IMK ist eine intensive Abstimmung innerhalb der städtischen Gremien erforderlich.
Eine mögliche Variante wäre nach Ansicht der Verwaltung, dass sich der AK Verkehr ab Anfang 2025 zusammenfindet und eine Strategie für die Konzeptumsetzung entwickelt.
Der Teil 3 des IMK (Maßnahmen und Lösungen) schlägt schon eine gewisse Priorisierung von Maßnahmen (MUSS, SOLL, KANN) vor. Diese Empfehlungen des Gutachters könnten als Handlungsleitlinie für die Besprechungen im AK Verkehr dienen.
Angesichts der Vielzahl der Maßnahmen und der bekannt knappen finanziellen Mittel und der personellen Kapazitäten der Verwaltung kann nur eine Umsetzung in kleinen Schritten erfolgen. Haushaltsrechtlich sei nochmals darauf hingewiesen, dass es sich hier um freiwillige Leistungen handelt. Größere Maßnahmen erfordern ohnehin eine längere Planungsphase, insbesondere wenn das qualifizierte Straßennetz betroffen ist.
Ungünstig und zu vermeiden wäre aus Sicht der Verwaltung ein einzelnes Herausgreifen von Maßnahmen durch verschiedene gesellschaftliche Interessengruppen, so dass die Projekte möglicherweise in Konkurrenz zueinander treten.
Haushaltsrechtliche Auswirkungen:
Ja – Beschaffung der Verkehrszeichen für die Schulstraßen
(Kosten für weitere Untersuchungen, Verkehrszeichen etc.)
Erstellung eines Lärmaktionsplanes ca. 20.000,- €
Planungs- und Baukosten für den Umbau der LRA-Kreuzung (Grobkostenschätzung inkl. Planung ca. 150.000,- € - erst bei erfolgreichen Gesprächen mit dem LRA, Straßenbauamt usw.; bis dahin fallen Planerstunden bei BVR für die fachliche Begleitung an)
Vertiefte Untersuchungen zu Trassenkorridoren der versch. Umfahrungsvarianten
(aktuell keine Angaben möglich)
Die hierfür notwendigen Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan 2024 nicht veranschlagt. Die Mittelbereitstellung muss, sofern ein positiver Beschluss gefasst wird, im Rahmen der Haushaltsberatungen 2025ff beraten werden.
Diskussionsverlauf
Der Verkehrsplaner Herr Steinlechner vom Büro für Raum- und Verkehrsplanung in Innsbruck hält einen Vortrag anhand der beiliegenden Präsentation und beantwortet Fragen.
Insgesamt wird das Mobilitätskonzept von den Stadträten gelobt, es gibt aber durchaus auch die Meinung, dass einige vorgeschlagene Maßnahmen nicht durchführbar sind und auch nicht auf Realisierung getestet worden sind. Zudem könnten bei der derzeitigen Haushaltslage einige Maßnahmen gar nicht umgesetzt werden, auch im Hinblick auf die Vorschläge die Staatsstraßen betreffend. Die Variante ISEK2 wird von einigen Stadträten sehr kritisch gesehen.
Es schließt sich noch eine kurze Debatte über das weitere Vorgehen mit dem AK Verkehr an.
Zu a)
Der Stadtrat hat Kenntnis vom Integrierten Mobilitätskonzept für die Stadt Ebersberg mit Stand vom März 2024 und nimmt dieses Konzept in seinen drei Teilen (Teil 1 – Analyse und dem Teil 2 – Lösungen und Maßnahme und dem Teil 3 – Materialband) an.
19 Ja : 3 Nein
Zu b)
Der Stadtrat hat Kenntnis von den Empfehlungen des Technischen Ausschusses aus der Sitzung vom 14.05.2024 und beschließt die Umsetzung der Maßnahmen wie folgt:
|
Maßnahme
|
Ja
|
Nein
|
|
Schulstraßen
|
22
|
0
|
|
Sektorales Fahrverbot
|
13
|
9
|
|
Staatsstraßenverlagerung besprechen
|
13
|
9
|
Dokumente
Download EBE_SR_20241105.pdf
zum Seitenanfang
3. Kindergarten St. Sebastian, Finanzierungszusage
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Finanzen, Wirtschaft und Digitales
|
Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Digitales
|
15.10.2024
|
nö
|
beschließend
|
9 |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
05.11.2024
|
ö
|
beschließend
|
3 |
|
Finanzen, Wirtschaft und Digitales
|
Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Digitales
|
25.03.2025
|
nö
|
beschließend
|
8 |
Sachverhalt
Die Diözese legte am 02.10.2024 eine fortgeschriebene Kostenberechnung des Projektierers Ernst & Young für die KiTa St. Sebastian zum Stand 24.09.2024 vor (sh. Anlage). Zahlenmäßig ergibt sich folgende Kostenentwicklung ausschließlich für die KiTa:
|
Berechnung vom
|
07.12.2022
|
15.02.2024
+24.09.2024
|
|
Neubau KiTa KG200-700 incl. 5% Zuschl.
|
14.465.918 €
|
15.387.000 €
|
|
10% Zuschl. Unvorherg.
|
1.446.592 €
|
1.539.000 €
|
|
Baukostensteigerung 24% (18 Mt.) auf KG 200-600
|
2.791.975 €
|
2.983.000 €
|
|
Schätzung tlw. Wiederholung LPH 3 & Tektur LPH 4
|
0
|
160.000 €
|
|
Schätzung Stellplätze oberirdisch
|
0
|
80.000 €
|
|
Gesamtkosten
|
18.674.185 €
|
20.149.000 €
|
|
Maximaler Anteil Stadt = 2/3 davon:
|
12.449.457 €
|
13.432.000 €
|
In den Berechnungen 2024 wurde zudem die Baukostensteigerung um ein weiteres Jahr fortgeschrieben sowie Kostenänderungen aufgrund des Wegfalls der ursprünglich unter der KiTa geplanten Tiefgarage berücksichtigt.
Weitere Details sind den beiliegenden Kostenberechnungen zu entnehmen.
Auf die Stadt kommen also Kosten in Höhe von höchstens 13.432.000 € zu. Wenn die Stadt die Option des Baus einer Tiefgarage neben der KiTa nach Baubeginn der KiTa haben will, hat Ernst & Young weitere Kosten für ggf. notwendige Unterfangungen, Fundamente usw. in Höhe von 500.000 € angesetzt, die vorstehend nicht enthalten sind.
Das Ordinariat hat mit der Förderstelle bei der Regierung von Oberbayern die Wirtschaftlichkeit und grundsätzliche Förderfähigkeit des Projekts geklärt. Nach der Berechnung von Ernst & Young ergibt sich unter Ansatz von derzeitigen Kosten von 15.041.267 € und der Flächen ein Kostenwert von 6.861 €/m², der unter dem Kostenrichtwert von 6.926 €/m² liegt. Die ROB hat deshalb gegenüber dem Ordinariat vorbehaltlich der näheren Prüfung eine Förderfähigkeit zugesagt. Analog des Förderantrags für die KiTa Oberndorf schätzt die Kämmerei die Förderung auf ca. 30% des städtischen Kostenanteils, also auf 4.030.000 €. Ein erneuter Förderantrag mit den aktuellen Zahlen wird durch die Verwaltung nach diesem Beschluss gestellt.
Haushalterisch bzw. hinsichtlich dazu erforderlicher Neuverschuldung ergeben sich folgende Beträge:
|
Beträge jeweils maximal
|
Haushalt 2024
|
Nun
|
Mehrung
|
|
Kostenanteil Stadt
|
12.450.000
|
13.432.000
|
+982.000
|
|
Erwarteter Zuschuss
|
3.735.000
|
4.030.000
|
+295.000
|
|
Verbleiben zu tragen
=anteilige Neuverschuldung
|
8.715.000
|
9.402.000
|
+687.000
|
|
Verteilt auf Jahre
|
2026-2028
|
2027-2029
|
|
Eine Überprüfung des Raumprogramms bzw. eine Umplanung würde eine Neuplanung und aufsichtsrechtliche Genehmigung erfordern und ist – da offensichtlich zur Anerkennung der Förderung nicht mehr notwendig – unterblieben.
Mit der Baumaßnahme kann erst begonnen werden, wenn die KiTa Ringstraße fertig gestellt ist. Wenn alles glatt läuft, dürfte diese im August/September 2026 bezugsfertig sein. Noch in 2026 könnte dann der Abbruch der KiTa St. Sebastian und in 2027/2028 der Neubau mit Fertigstellung voraussichtlich in 2029 erfolgen.
Herr Miller vom Ordinariat wird bei der Beratung anwesend sein und Fragen beantworten. Er benötigt bis Mitte November 2024 ein Votum der Stadt für die Umsetzung der Maßnahme mit einem auf die Stadt fallenden Kostenrahmen von bis zu 13.432.000 € brutto, damit die Diözese ihrerseits auch weiterhin Mittel für die Baumaßnahme bereitstellt. Eine finale Finanzierungsvereinbarung mit Details kann noch in den nächsten Monaten verhandelt werden.
Die Finanzierungszusage bzw. die darauffolgende Finanzierungsvereinbarung stellen ein kreditähnliches Rechtsgeschäft dar, das wie auch die Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2025 durch das Landratsamt zu genehmigen ist. Eine Zusage kann deshalb nur unter Vorbehalt der Genehmigung des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes als auch des Haushalts 2025 durch das Landratsamt Ebersberg erfolgen.
Diskussionsverlauf
Herr Miller vom Erzbischöflichen Ordinariat München erläutert den aktuellen Stand und erklärt das geplante Bauvorhaben anhand der beiliegenden Präsentation und beantwortet Fragen.
Beschluss
Der Stadtrat beschließt, der Diözese für den Neubau der Kita St. Sebastian eine Kostenübernahme von 2/3 der nachgewiesenen Baukosten, höchstens jedoch 13.432.000 € brutto vorbehaltlich
- einer Förderfähigkeit des Projekts durch die ROB
- der Genehmigung der Finanzierungsvereinbarung als kreditähnliches Rechtsgeschäft als auch der entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2025 durch das Landratsamt Ebersberg
zuzusagen.
Da der Bau einer Tiefgarage auf absehbare Zeit nicht verfolgt wird, ist auf weitere Kosten für Unterfangungen und Fundamente zu verzichten; dabei ist bekannt, dass damit eine Tiefgarage nur mit entsprechendem Abstand zur KiTa errichtet werden kann.
Näheres ist in einer Finanzierungsvereinbarung zu regeln und dann zu beschließen.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 21, Dagegen: 0
Abstimmungsbemerkung
bei Abwesenheit von Stadtrat Ried
Dokumente
Download 241104mi_BV Ebersberg - Kita_Projektinformation an Stadt Ebersberg - Stadtratssitzung.pdf
zum Seitenanfang
4. Kindergarten Ringstraße
Vorstellung Überarbeitung Entwurf und Kostenberechnung
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
05.11.2024
|
ö
|
beschließend
|
4 |
|
Finanzen, Wirtschaft und Digitales
|
Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Digitales
|
26.11.2024
|
ö
|
vorberatend
|
7 |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
17.12.2024
|
ö
|
beschließend
|
10 |
Sachverhalt
In der Sitzung vom Technischen Ausschuss am 17.09.2024 wurde der Entwurf für die Kinderbetreuung an der Ringstraße vorgestellt. Ein Empfehlungsbeschluss zur weiteren Bearbeitung für den Stadtrat wurde mit 7:5 gefasst. Es wurde besprochen den Entwurf noch bezüglich der Kosten zu optimieren und eine Lösung ohne Wohnungen mit Satteldach zu prüfen. In der vorliegenden Überarbeitung sind die Punkte eingearbeitet.
Überprüft wurde eine Optimierung der Fluchtwegsituation, so dass im Westen der Laubengang reduziert werden konnte. Dies führt jedoch dazu, dass im Inneren des Gebäudes zwischen den Gruppenräumen Türen erforderlich werden, die im Betrieb nicht verstellt werden dürfen. Zusätzlich müssen die Anforderungen der Verglasungen erhöht werden (absturzsichere Verglasung incl. Rahmenqualität).
Einsparmöglichkeiten ergeben sich im Bereich Sonnenschutz im Westen und Osten:
Westen Entfall Sonnenschutz Sanitärräume, Osten Entfall komplett wegen auskragendem Laubengang.
Ebenso wurde bei den technischen Gewerken Einsparpotential erarbeitet.
HLS: Änderung Beheizung Einsparung bei Fernwärmeanschluss ca. 41.000.- Euro
Elektro: ca. 43.000.- Euro durch diverse Reduzierungen Qualität.
Im Bereich Außenanlagen kann, durch Wegfall einiger Spielgeräte und Sitzgelegenheiten eine Einsparung von ca. 46.000.- Euro erzielt werden.
Abzüglich aller Einsparungen, auch die im TA vorgestellt wurden, ergibt sich ein Gesamtkostenansatz incl. Wohnungen von 9,35 Mio Euro.
Zu den Wohnungen wurden Vergleichsobjekte betrachtet mit dem Ergebnis, dass die Kosten pro M2 im Rahmen, bzw. sogar etwas günstiger sind. Ebenso wurde noch genauer ermittelt, welche Gesamtkosten ohne Wohnungen anfallen würden. Hier ergibt sich ein Kostenansatz von 9,33 Mio Euro (Kosten ohne Einsparungen), bzw 8,65 Mio Euro (Kosten incl. Aller Einsparungen). Mehrkosten für die Wohnungen (6 Stück) 700.000.-Euro.
Zum besseren Vergleich der Gesamtkosten zur Gruppenanzahl wurden 3 Objekte betrachtet. Es wurden jeweils die Gesamtkosten (brutto) KG 200-700 verwendet:
Gruppenkosten Ringstraße bei einer Bausumme von 9.325.000 € 8 Gruppen ergibt 1.165.625€ pro Gruppe Kostengruppe 200-700 Holzmodulbau
Gruppenkosten Kinderhaus Grafing ca. Bausumme 7.500.000 € 6 Gruppen ergibt 1.250.000€ pro Gruppe Hybridbau
Gruppenkosten KiGa Wörth Bausumme ca. 11.200.000 € 6 Gruppen ergibt 1.866.666 € pro Gruppe Holzbau
Seitens der Verwaltung wird empfohlen das Gebäude incl. Wohnungen weiter zu verfolgen, da das Angebot für Mitarbeiterwohnungen ein Vorteil bietet die Trägerauswahl für den Betrieb zu erhöhen. Einsparmöglichkeiten sollten einzeln abgestimmt werden.
Haushalterische Würdigung der Kämmerei:
Betrachtet wurden drei Kostenvarianten:
|
Bau von
|
KoBe
|
Baukosten
|
Förderprogn.
|
verbleiben
|
|
1. KiTa und Wohnungen
ohne Einsparungen
|
17.09.2024
|
13.500.000
|
3.345.000
|
10.155.000
|
|
2. KiTa und Wohnungen
mit Einsparungen
|
25.10.2024
|
12.685.000
|
3.345.000
|
9.340.000
|
|
3. Nur KiTa
mit Einsparungen
|
25.10.2024
|
10.996.000
|
2.350.000
|
8.646.000
|
Variante 2 und 3 sind mit allen durch den Architekten dargestellten Einsparpotentialen dargestellt. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Ersparnis von Möbel (219.000 €) die Weiterverwendung des Mobiliars von St. Sebastian voraussetzt.
Obwohl bei Var. 3 die Wohnungen mit einem Kostenanteil in Var. 2 von 1,825 Mio. € (ohne Förderung) wegfallen, ergibt sich gegenüber der Var. 2 lediglich eine verbleibende Kostenminderung von 694.000 €. Dies ist darin begründet, dass Fundamente und Haustechnische Anlagen etc. in Variante 2 auch den Wohnungen zugerechnet wurden und nun in Var. 3 gänzlich der KiTa zuzurechnen sind. Zudem entfallen die auch darauf gründenden Förderungen nach KommWFP.
Es wurden für alle drei Varianten Finanzierungsmöglichkeiten nach den derzeitigen Konditionen (Förderkredit als auch Kommunalkredit) und die daraus eintretende Haushaltsbelastung durchgerechnet. Bei Variante 2 stellt sich in den nächsten Jahren nur bezogen auf den Schuldendienst für die Wohnungen und den Mieten ein jährliches Defizit von 1.000 bis 4.000 € dar. Wenn auch zusätzlich, so ist dies im Vergleich zu anderen Kosten im Haushalt eine kleine Größe. Unterhalt und weitere Risiken (Förderausfall, Kostenmehrung, Leerstand…) sind dabei jedoch nicht berücksichtig.
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung nach der Kapitalwertmethode (sh. Anlage) ergibt unter Berücksichtigung von Unterhaltskosten (jährlich 0,7% der Baukosten):
- Bis 2032 ein jährliches Defizit von 10.000 bis 20.000 €.
- Break-Even-Point: Ab 2042 ist mit mehr Einnahmen als Ausgaben zu rechnen
- Insgesamt nach 30 Jahren aus dem laufenden Betrieb ein Minus von 22.500 € und nach Restwert des Gebäudes ein Plus von 853.000 €
Nach den Prognosen wird nach einer Interimsnutzung für St. Sebastian eine weitere KiTa benötigt. Bau und Betrieb von Kitas sind Pflichtaufgaben einer Gemeinde. Es ist deshalb sinnvoll, die Interimslösung gleich in Form einer neuen KiTa zu errichten.
Aufgrund der äußerst schwierigen Haushaltslage mit einer an die Grenze kommenden Verschuldung ist es geboten, die Aufgaben nur im zwingend erforderlichen Maß zu erfüllen und darüber hinaus nur bei entsprechender Wirtschaftlichkeit Aufgaben zu leisten. Für den Bereich der Kita bedeutet dies eine einfache und kostengünstige Ausführung; alle Einsparpotentiale sollten ausgenutzt werden. Die Wohnungen sollten nur umgesetzt werden, wenn diese keine Belastung für die Haushalte in den nächsten 10 Jahren darstellen. Auf den ersten Blick scheint der Schuldendienst durch die Mieteinnahmen nahezu gedeckt zu werden. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung mit Einbeziehung der Unterhaltskosten weist jedoch bis 2041 und die Summe des Kapitalwerts auf 30 Jahre ein Defizit aus. Die Kämmerei empfiehlt deshalb, vom Bau der Wohnungen abzusehen.
Frau Lohmann und Herr Rieger vom gleichnamigen Architekturbüro stellen die ausgearbeiteten Sparvorschläge anhand der beiliegenden Präsentation vor und beantworten Fragen.
Im Kreise des Stadtrates entbrennt eine Diskussion, die sich im Wesentlichen mit der Finanzierbarkeit des Projektes befasst. Es gibt viel Zuspruch zu dem vorgestellten Baukörper, von einigen Sparmaßnahmen gerade im Bereich des Sonnenschutzes wird sogar von Sparvorschlägen abgeraten. Ebenso wird der Wohnungsbau als dringend erforderlich angesehen, erst recht vor dem Hintergrund, dass das Projekt ohne die Wohnungen nicht wesentlich günstiger wird.
Dem wird entgegengehalten, dass das Projekt schlichtweg nicht finanzierbar sei, da der jährliche Schuldendienst erheblich steigen würde und der finanzielle Spielraum der Stadt dann weg wäre bis hin zu der Genehmigungsverweigerung durch das Landratsamt. Es sollte nicht ein langfristig nutzbarer massiver Bau entstehen sondern auf die günstigere Pavillonvariante zurückgegriffen werden.
Die Finanzsituation wird nicht von allen Stadträten als so dramatisch eingeschätzt und es wird vorgetragen, dass ein Kinderbetreuungsbetrieb in Pavillons für die Kinder und das Personal unschön sei. Vielleicht würde sogar deshalb kein Träger als Betreiber des Kindergartens gefunden werden.
Letztlich besteht Einvernehmen, dass die Finanzierbarkeit dieses Projektes angesichts aller anderen Kosten und der zukünftigen Einnahmeentwicklung bis zur nächsten Sitzung dargestellt werden soll. Die Stadt verlangt bei Grundstücksverkäufen in Bauland-Vergabeverfahren auch Finanzierungssicherungen.
Stadträtin Platzer beantragt gemäß der Geschäftsordnung ein Ende der Beratung.
20 Ja : 2 Nein
zum Seitenanfang
5. Tiefgarage bei KiTa St. Sebastian
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Finanzen, Wirtschaft und Digitales
|
Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Digitales
|
15.10.2024
|
nö
|
beschließend
|
10 |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
05.11.2024
|
ö
|
beschließend
|
5 |
Sachverhalt
Im Kontext mit dem Abbruch und Neubau der KiTa St. Sebastian steht die Entscheidung an, ob das Projekt Tiefgarage weiterverfolgt wird. Ein Bau der Tiefgarage macht aus Sicht der Verwaltung nur vor bzw. mit der Baumaßnahme KiTa Sinn, da ansonsten während der Bauphase der neu hergestellte Garten der KiTa wieder zerstört und der Nutzung für die Kinder (aufsichtsrechtliche Genehmigung!) entzogen wird und auch Mehrkosten von 500.000 € beim Kindergartenbau anfallen.
Zum Projekt Tiefgarage an der KiTa St. Sebastian hat die Kämmerei folgende konservative Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Annahme von ca. 55 Stellplätzen und weiteren geschätzten Faktoren angestellt:
|
|
Kosten/Erlöse
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baukosten je Stellplatz
|
40.000
|
45.000
|
50.000
|
55.000
|
60.000
|
|
|
Kosten TG brutto
|
2.200.000
|
2.475.000
|
2.750.000
|
3.025.000
|
3.300.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) Finanzierungskosten
|
|
|
|
|
|
|
|
Kosten TG
|
2.200.000
|
2.475.000
|
2.750.000
|
3.025.000
|
3.300.000
|
|
|
./. Vorsteuer
|
351.261
|
395.168
|
439.076
|
482.983
|
526.891
|
|
|
./. Rückl. Stellplatzablöse
|
120.000
|
120.000
|
120.000
|
120.000
|
120.000
|
|
|
./. mögl. Zuw. StBF je Stpl
|
786.500
|
786.500
|
786.500
|
786.500
|
786.500
|
|
|
Verbleiben abgeru. 1.000
|
942.000
|
1.173.000
|
1.404.000
|
1.635.000
|
1.866.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) Folgekosten pro Jahr:
|
|
|
|
|
|
|
|
Strom f. Licht etc.
|
3.000
|
3.000
|
3.000
|
3.000
|
3.000
|
|
|
Wartung CO etc.
|
1.500
|
1.500
|
1.500
|
1.500
|
1.500
|
|
|
Reinigung (2 x jährlich?)
|
5.000
|
5.000
|
5.000
|
5.000
|
5.000
|
|
|
UST-Abr., Steuerberatung
|
3.000
|
3.000
|
3.000
|
3.000
|
3.000
|
|
|
Personalkosten
|
7.500
|
7.500
|
7.500
|
7.500
|
7.500
|
|
|
Gesamt:
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) Ausgaben p.a.:
|
|
|
|
|
|
|
|
jährl. Schuldendienst
(Tilgung und Zins, Annuitätendarl. bei 20 Jahre Laufzeit, 3,5% Zins, 4 Raten/Jahr
|
65.690
|
81.799
|
97.908
|
114.017
|
130.125
|
|
|
Folgekosten netto d)
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
|
|
Summe = jährl. Haushaltsbelastg:
|
85.690
|
101.799
|
117.908
|
134.017
|
150.125
|
|
Erforderliche Einnahmen je Stellplatz, um den jährlichen Haushalt nicht zu belasten:
|
jährlich netto
|
1.558
|
1.851
|
2.144
|
2.437
|
2.730
|
|
monatlich netto
|
130
|
154
|
179
|
203
|
227
|
|
Je Stunde
bei Ø 3,19 Std. je Stpl./Tag (Std.)
|
1,36
|
1,61
|
1,87
|
2,12
|
2,38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f) Einnahmen p.a. (netto)
|
|
|
|
|
|
|
Bei Parkgebühr 1,20 € brt.
|
|
|
|
|
|
|
Parkgebühren je Jahr brutto
|
76.770
|
76.770
|
76.770
|
76.770
|
76.770
|
|
Parkgebühren je Jahr netto
|
64.513
|
64.513
|
64.513
|
64.513
|
64.513
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g) Ergebnis haushalt. (A-E)
(- = Defizit, +=Überschuss)
|
-21.177
|
-37.286
|
-53.395
|
-69.504
|
-85.613
|
Schätzung der durchschnittlichen täglichen Nutzungszeit je Stellplatz:
|
|
Stunden
|
Tage/Jahr
|
Summe
|
|
Werktags (Mo-Fr.)
|
4
|
248
|
992
|
|
Samstags
|
2
|
52
|
104
|
|
Sonntags
|
1
|
52
|
52
|
|
Feiertags
|
1
|
12
|
12
|
|
Summe / Ø je Tag
|
3,19
|
364
|
1.160
|
Vorstehend sind jedoch keine außerordentlichen Unterhaltsmaßnahmen (Reparaturen, Sanierung) enthalten! Im Übrigen lag die Kostenschätzung der Diözese für die ursprüngliche Tiefgarage unter der KiTa bei mindestens 80.000 € je Stellplatz.
Haushalterische Würdigung: Aufgrund der enorm ansteigenden Verschuldung und dem daraus erwachsenden Schuldendienst dürfen freiwillige Ausgaben nur geleistet werden, wenn die dadurch ausgelöste Ausgabenlast durch Einnahmen vollständig gedeckt wird (sh. Haushaltskonsolidierungskonzept Nr. 1, Absatz 3). Ansonsten wird auch die Erfüllung von Pflichtaufgaben gefährdet.
Wie vorstehend ersichtlich würde die Tiefgarage immer eine jährliche Belastung für den Haushalt darstellen; zudem kommen finanzielle Risiken durch außerordentliche Reparaturen oder Sanierungen.
Da das Projekt Tiefgarage an der KiTa St. Sebastian bereits jetzt nicht wirtschaftlich darstellbar bzw. haushalterisch tragbar ist, empfahl in seiner Sitzung vom 15.10.2024 der Ausschuss FWD dem Stadtrat, das Projekt nicht weiter zu verfolgen aber auf die Warteliste zu setzen.
Diskussionsverlauf
Stadtrat Zwingler fragt in diesem Zusammenhang, ob in der Ulrichstraße senkrecht parken möglich wäre.
Beschluss
Das Vorhaben eines Baus einer Tiefgarage an der KiTa Sebastian wird nicht mehr weiter verfolgt und ist aus dem Investitionsprogramm bzw. Finanzplanung zu nehmen. Es soll auf die Warteliste gesetzt werden, um es bei einer unvorhersehbaren wesentlichen Besserung der Haushaltslage wieder aufgreifen zu können.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 20, Dagegen: 0
Abstimmungsbemerkung
in Abwesenheit von Stadträtin Rauscher und Stadtrat Münch
zum Seitenanfang
6. 15. Flächennutzungsplanänderung, Änderung einer Kiesabbaufläche in ein Sondergebiet (SO) Asphaltmischanlage, FlNr. 3294, 3295, 3284 TFl., 3285 TFl., 3283 TFl., jeweils Gemarkung Oberndorf (Teilgebiet A);
Behandlung der Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB;
Empfehlung für den Feststellungsbeschluss
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
05.11.2024
|
ö
|
beschließend
|
6 |
Sachverhalt
Der Stadtrat der Stadt Ebersberg hat in seiner Sitzung vom 28.01.2021 den Aufstellungsbeschluss für die 15. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teil 15a - Sondergebiet Asphalt und Kies; Änderung einer bestehenden Kiesabbaufläche in ein Sondergebiet (SO) Asphaltmischanlage, FlNr. 3294, 3295, 3284 TFl., 3285 TFl., 3283 TFl., jeweils Gemarkung Oberndorf, gefasst.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 26.05.2021 gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB öffentlich bekannt gemacht. Das Bauleitplanverfahren wird im Regelverfahren durchgeführt.
Der Entwurf der 15. Flächennutzungsplanänderung, Teilgebiet 15a – Sondergebiet Asphalt und Kies; Änderung einer bestehenden Kiesabbaufläche in ein Sondergebiet (SO) Asphaltmischanlage, FlNr. 3294, 3295, 3284 TFl., 3285 TFl., 3283 TFl., jeweils Gemarkung Oberndorf mit Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom 14.11.2023, der Umweltverträglichkeitsstudie in der Fassung vom September 2022 und die bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen ist in der Zeit wurde vom 03.04.2024 bis einschließlich 06.05.2024 unter folgender Internetadresse veröffentlicht:
B. Behandlung der Stellungnahmen:
1. Keine Rückmeldungen haben abgegeben:
1.1 Landratsamt Ebersberg, Wasserrecht
1.2 Staatliches Bauamt Rosenheim
1.3 Landratsamt Ebersberg, Straßenverkehrsrecht
1.4 Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
1.5 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Ebersberg
1.6 Bayerischer Bauernverband München
1.7 Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern
1.8 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
1.9 Landratsamt Ebersberg, Brandschutzdienststelle
1.10 Polizeiinspektion Ebersberg
1.11 Handwerkskammer für München und Oberbayern
1.12 Deutsche Telekom
1.13 Vodafone GmbH
1.14 Stadt Grafing b. München
1.15 Gemeinde Forstinning
1.16 Gemeinde Hohenlinden
1.17 Gemeinde Anzing
1.18 Gemeinde Frauenneuharting
1.19 BUND Naturschutz, Kreisgruppe Ebersberg
1.20 Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe Ebersberg
1.21 Landesjagdverband Bayern e.V.
2. Keine Anregungen/Bedenken haben vorgetragen:
2.1 Stadt Ebersberg, Abfall/Umwelt, Schreiben vom 16.05.2024
2.2 Gemeinde Steinhöring, Schreiben vom 19.04.2024
2.3 IHK für München und Oberbayern, Schreiben vom 08.05.2024
2.4 Kreishandwerkerschaft Ebersberg, Schreiben vom 22.04.2024
2.5 Landratsamt Ebersberg Gesundheitsamt, Schr. vom 15.05.2024
2.6 Landratsamt Ebersberg, Bauleitplanung, Schreiben vom 06.05.2024
2.7 Markt Kirchseeon, Schreiben vom 30.04.2024
2.8 Regionaler Planungsverband München, Schr. vom 16.05.2024
2.9 Vodafone GmbH, Schreiben vom 14.05.2024
2.10 Landratsamt Ebersberg, untere Immissionsschutzbehörde, Schr. vom 07.05.2024
3. Folgende Anregungen wurden vorgetragen:
3.1 Stadt Ebersberg, Tiefbauamt, Schreiben vom 24.04.2024
3.2 Landratsamt Ebersberg, Bodenschutz und Altlasten, Schreiben vom 14.05.2024
3.3 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding, Schr. v. 29.05.2024
3.4 Landratsamt Ebersberg, untere Naturschutzbehörde, Schr. v. 29.05.2024
3.5 Öffentlichkeit 1, Schreiben vom 22.03.2024
3.6 Öffentlichkeit 2, Schreiben vom 29.04.2024
C. Abwägung der Stellungnahmen:
3.1 Stadt Ebersberg, Tiefbauamt, Schreiben vom 24.04.2024
Kanalisation
Siehe beiliegende Stellungnahme vom 16.06.2021
In dem betroffenen Gebiet betreibt die Stadt Ebersberg keine öffentliche Abwasseranlage.
Wasserversorgung
Siehe beiliegende Stellungnahme vom 16.06.2021
Das beschriebene Areal Teil 15 a – Sondergebiet ist an die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Ebersberg angeschlossen.
Die Gebäude auf der Fl. Nr. 3294 (Fa. Swietelsky) sind an einer von der Hauptwasserleitung DN 100 PVC in der Staatsstraße St 2086 abgehenden Hausanschlussleitung DA 63 PE für die Fl. Nr. 1193 (Landkreis Ebersberg) mit einer überlangen Hausanschlussleitung DA 32 PE über die Gemeindestraße An der Schafweide erschlossen. Diese Anschlussleitung dient aufgrund der geringen Dimension vermutlich ausschließlich der Trinkwasserversorgung und nicht dem Betrieb der Asphaltanlage. Eventuell betreibt die Fa. Swietelsky eine eigene Wasserversorgung auf dem Betriebsgelände.
Der letzte Oberflurhydrant (OH) sitzt am Ende der Hauptwasserleitung in der ST 2086 auf Höhe der Zufahrt zur Straße An der Schafweide. Von den Betriebsgebäuden der Fa. Swietelsky bis zum OH sind es ca. 200 m. Die anderen Gebäudeteile liegen weit verstreut auf dem Firmengelände. Aus Sicht der Tiefbauabteilung ist zu prüfen ob der Löschwasserbedarf für das Betriebsgelände durch das öffentliche Netz ausreichend ist oder wie vorher beschrieben, eine eigene Wasserversorgung auf dem Gelände den Bedarf decken kann.
Sollten sich Änderungen in Bezug auf den Anschluss ergeben, ist entsprechend der städtischen Wassersatzung (WAS) ein Bewässerungs-plan entsprechend den Vorgaben in der WAS, in 3-facher Ausfertigung der Stadt zur Genehmigung vorzulegen.
Die Bauausführung darf nur mit der genehmigten BWP und in enger Abstimmung mit der Wasserabteilung erfolgen.
Straßenbau
Siehe beiliegende Stellungnahme vom 16.06.2021
Die verkehrliche Anbindung der Flächen von Teil 15 a erfolgt weiterhin über die Straße An der Schafweide.
Anfallendes Regenwasser aus den eventuell notwendigen Erschließungsstraßen ist auf dem jeweiligen Grundstück zu versickern.
Die Kosten sowohl für die Planung als auch für den Bau einer notwendigen Erschließung trägt der Bauwerber.
Darüber hinaus ist ein Erschließungsvertrag mit der Stadt ist abzuschließen.
Behandlungsvorschlag:
Seitens der Tiefbauverwaltung wird auf die Stellungnahmen vom 16.06.2021 verwiesen.
Diese wurden bereits auf der Sitzung vom 24.05.2022 abgewogen. Hierzu haben sich keine neuen Erkenntnisse ergeben, so dass eine Anpassung der Planung nicht erforderlich ist.
Die Löschwasserversorgung ist durch einen Wasserlagertank (Fassungsvermögen 100.000l) auf dem Gelände gewährleistet, zusätzlich befindet sich an der ST 2080 ein Hydrant. Der Löschwassertank wird durch einen betriebseigenen Tiefbrunnen gespeist. Die Löschwasserversorgung ist Bestandteil der Auflagen der BImSch-Genehmigung der Asphaltmischanlage der Fa. Swietelsky Baugesellschaft mbH (siehe BImSch-Genehmigung vom 27.05.2004, AZ 44/824-/ Ebersberg/S Bd. III).
Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es ist keine Ergänzung der Planung erforderlich.
3.2 Landratsamt Ebersberg, Bodenschutz und Altlasten, Schreiben vom 14.05.2024
Zu oben genannten Verfahren wird aus bodenschutzfachlicher Sicht wie folgt Stellung ge-
nommen:
Die Fl-Nrn. 3283, 3284, 3285, 3294, 3295 und 3295/3 der Gemarkung Oberndorf und die Fl-
Nrn. 1122, 1120, 1119, 1118 und 1117 der Gemarkung Ebersberg sind derzeit nicht im Alt-
lastenkataster für den Landkreis Ebersberg eingetragen.
Behandlungsvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
3.3 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding, Schr. vom 29.05.2024
für die Beteiligung an o.g. Planungsvorhaben bedanken wir uns. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Ebersberg-Erding gibt eine gemeinsame Stellungnahme der Bereiche Landwirtschaft und Forsten ab.
Der Bereich der bestehenden Asphaltmischanlage an der Schafweide ist derzeit im Flächennutzungsplan als Fläche für Kiesabbau dargestellt. Die Genehmigung für die Asphaltmischanlage war bisher als mitgezogene Nutzung des privilegierten Kiesabbaus ausgestellt. Nach Beendigung des örtlichen Kiesabbaus sollte der Standort insgesamt rekultiviert werden. Nun soll ein dauerhafter, vom Kiesabbau unabhängiger Betrieb der Anlage erfolgen.
1. Landwirtschaftliche Stellungnahme (Theresa Scherm):
Eine Verunkrautung der überplanten Fläche während der einzelnen Bauphasen ist durch geeignete Maßnahmen zu verhindern. Insbesondere ist dafür zu sorgen, dass während der Bauphase kein Unkrautdruck (z. B. Ampfer, Disteln, Neophyten) von der Abbaufläche und den umgebenden Mieten auf die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen ausgeht. Deshalb sind die
Flächen v. a. im Randbereich entsprechend zu mähen oder zu mulchen, möglichst vor Samenreife und Samenflug. Durch die regelmäßige Pflege der Ausgleichsflächen soll das Aussamen eventueller Schadpflanzen und die damit verbundene negative Beeinträchtigung der mit Kulturpflanzen bestellten Flächen in der Nachbarschaft vermieden werden.
Der Oberboden und der Unterboden sind soweit vorhanden, getrennt abzutragen und zu lagern. Zur Vermeidung von Reduktionsschäden ist der Oberboden bei längerer Zwischenlagerung mit tiefwurzelnden Futterpflanzenmischungen (z.B. Klee- und Luzernegras) zu begrünen. Der Oberboden und ggf. auch der Unterboden dürfen nicht für andere Zwecke abgefahren
werden.
Landwirtschaftliche Wege, die als Zu- und Abfahrtswege benutzt werden, sind für die notwendige LKW-Benutzung entsprechend auszubauen und zu unterhalten.
Die Bewirtschaftung der benachbarten landwirtschaftlichen Flächen darf durch die geplante Maßnahme nicht beeinträchtigt werden. Entsprechende Abstände sind daher einzuhalten.
Darüber hinaus ist die Zufahrt zu den umliegenden landwirtschaftlichen Flächen weiterhin zu gewährleisten.
2. Forstfachlich-waldrechtliche Stellungnahme (Astrid Fischer, Dr. Martin
Bachmann):
Beim verfahrensgegenständlichen Bereich nordwestlich der bestehenden Mischanlage handelt es sich eindeutig um Wald im Sinne Art. 2 (1) BayWaldG, da dort die dafür einschlägige Gesamtflächengröße und -ausformung sowie Art der vorhandenen Vegetation gegeben sind.
Von ca. 0,8 ha Wald sollen ca. 0,65 ha dauerhaft gerodet (siehe a) werden, um einem Büro- und Werkstattgebäude zu weichen (Flächenbegang mit der Fa. Swietelsky). Während dort ca. 0,15 ha Wald als Restfläche („Eingrünung“ Wald) verbleiben sollen, gilt es insbesondere zu berücksichtigen, dass bedingt durch die „Umwidmung“ in ein Sondergebiet das überwiegende
Areal nicht mehr der ursprünglich beschiedenen Wiederbestockung mit standortgerechtem Mischwald zugeführt werden kann (siehe b).
a) Rodung
Die Beseitigung von Wald zugunsten einer anderen Bodennutzungsart (Rodung) bedarf nach Art. 9 (2) BayWaldG der Erlaubnis.
Die besondere Bedeutung des Waldes im Allgemeinen sowie dessen lokale Bedeutung im Konkreten wurden bereits in früheren Stellungnahmen (z. B. AELF-EE-F2-4611-37-5-6 von 28.07.2021) und Gesprächsforen detailliert herausgestellt und von der Stadt Ebersberg mitgetragen.
Eine Rodungserlaubnis soll versagt werden, wenn die Rodung Plänen im Sinn des Art. 6 widersprechen oder deren Ziele gefährden würde (Art. 9 (5) Nr. 1) bzw. wenn die Erhaltung des Waldes aus anderen Gründen im öffentlichen Interesse liegt (Art. 9 (5) Nr. 2). Der betroffene Wald erfüllt für das öffentliche Interesse die besondere Waldfunktion „regionaler Klimaschutz-
wald“.
Unter Berücksichtigung obiger Ausführungen sowie der Planungsunterlagen ergibt sich eine waldrechtliche Flächenausgleichsverpflichtung.
Nach Art 9 (8) BayWaldG ersetzt die gültige Baugenehmigung die Rodungserlaubnis. Das Benehmen dazu kann in Aussicht gestellt werden, soweit eine Ersatzaufforstung der dauerhaft beanspruchten Fläche von 6.500 m² im selben Naturraum erfolgt.
b) Nicht-Wiederbestockung des Areals mit standortgerechtem Mischwald
Die Ausführungen, dass „die im Rahmen der Anlagengenehmigung geleisteten forstrechtlichen Ausgleichsflächen in einem Umfang von etwa 4,876 ha bestehen bleiben und durch neue Ausgleichsmaßnahmen ergänzt werden“ (Begründung und Umweltbericht, S. 52) spiegeln die vorausgehenden Abstimmungsergebnisse wider (siehe c und d). Dabei wurde auch verein-
bart, dass ein Überschuss aus externen, früher verfahrensgegenständlichen Ausgleichsflächen in die nachfolgend skizzierte, von uns geringfügig angepasste Flächenbilanzierung eingeht.
c) Flächenbilanzierung (i. W. zu Begründung und Umweltbericht, S. 64)
Merkmal Fläche [ha] Bemerkung
aktuelle Rodung 0,6500 siehe a), nicht 0,6020 ha
Baugrundstück 4,8270 nicht 4,820 ha
Gesamtbedarf 5,4770 nicht 5,422 ha
Überschuss 1,3350 aus externen Ausgleichsflächen
Ersatzaufforstung 4,1420 nicht 4,087 ha (plus 550 m2)
Hinweis: Tab. 17 „Übersichtstabelle Eingriffsbilanzierung / Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarf“ (Begründung und Umweltbericht, S. 62) scheint einen kleinen Rechenfehler zu enthalten, Aus unserer Sicht ergibt sich statt einer Gesamtausgleichsfläche von 4,4610 ha ein Bedarf von 4,4541 ha.
d) Ersatzaufforstungen
Umfang und Art der Ersatzaufforstung sind grundsätzlich akzeptabel. Nachdem gegenwärtig geplant ist, den waldrechtlichen Ausgleich auf Flächen des naturschutzrechtlichen Ausgleichs zu inkludieren, letzterer flächenmäßig überwiegt und beide auf die Begründung von Wald im Sinne Art. 2 (1) BayWaldG abzielen, erscheint uns die geringfügige Diskrepanz bei der Flächenbilanzierung (siehe c) unerheblich.
Bzgl. der praktischen Umsetzung gibt es zwei Einwände:
• Auf S. 71 und S. 78, Begründung und Umweltbericht werden im Zuge der Maßnahmenbeschreibung die für die Ersatzaufforstung zu verwendenden Baumarten aufgelistet. Überwiegende soll Rotbuche eingesetzt werden. Hier ist darauf hinzuweisen, dass die Schattbaumart Buche, ebenso wie die angeführte Weißtanne, extrem spätfrostgefährdet ist und
ohne den Schutz eines Altbestandes, wie hier auf der Freifläche gegeben, zu hohen Ausfällen und Entwicklung minderer Qualitäten neigt. Ein Zurückgreifen auf für Erstaufforstungen besser geeignete Baumarten (z.B. Stieleiche, Bergahorn) wird dringend empfohlen, um ein rasches und
hochwertiges Aufwachsen der Kultur sicherzustellen.
• An obiger Stelle wird bzgl. der zu verwendenden Pflanzverbände auch eine sog. „Reihenaufforstung im Normalverband (ca. 2 m x 1 m) innerhalb der Gruppe“ empfohlen. Da dieses Vorgehen nicht der guten fachlichen Praxis der Waldbewirtschaftung entspricht und unterschiedliche Baumarten entsprechend angepasste Pflanzverbände erfordern, bitten
wir darum, die zielführenden Verbände der weithin gängigen Publikation „Kulturbegründung und Jungwuchspflege - Wegweiser für bayerische Waldbesitzer“ des Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu entnehmen.
Auch wenn gegenwärtig ein Ende des Betriebes des SO „Asphaltmischanlage“ nicht absehbar erscheint, wird angeregt, die Anlagen dann zurückzubauen und alle am Vorhabenstandort beanspruchten Flächen wieder als Wald zu entwickeln. Der im RP 14 vorgesehenen Nachfolgefunktion „forstwirtschaftliche Nutzung“ (RP 14 B IV (G) 5.7.2.1) könnte so mittelfristig in
der sensiblen Kulisse „Ebersberger Forst“ doch noch entsprochen werden.
Wir bedanken uns für die nochmalige Fristverlängerung und stehen für eventuelle Rückfragen zur Verfügung. Bitte nutzen Sie dafür unsere Poststelle poststelle@aelf-ee.bayern.de, da ansonsten eine Bearbeitung in meiner Abwesenheit nicht gewährleistet ist bzw. die formale und erforderliche Beteiligung aller hiesigen Ressorts nicht zeitgerecht erfolgen kann.
Behandlungsvorschlag:
- Landwirtschaftliche Stellungnahme
Im Umfeld der Abbaufläche und des Betriebsgeländes liegen keine landwirtschaftlichen Flächen, die Abbaufläche ist von Waldflächen und Verkehrsflächen umgeben. Ein unmittelbarer „Unkrautdruck“ auf landwirtschaftliche Flächen ist nicht vorhanden.
Die Ausgleichsflächen grenzen an landwirtschaftliche Flächen an. Die nicht bepflanzten Waldsaumflächen („Krautsaum“) werden regelmäßig jährlich gemäht. Ein Unkrautdruck auf benachbarte Flächen kann dadurch auf ein Minimum begrenzt werden, so dass die Vorgaben des AELF eingehalten sind. Die Vorgaben zur Verwendung und Lagerung von Oberboden sind in den bestehenden Normen (DIN 18915-18917) und dem Bodenschutzgesetz geregelt. Dieser Stand der Technik ist durch den Grundeigentümer bzw. Betreiber ohnehin zu beachten. Zusätzliche Regelungen sind im Bebauungsplan nicht zu treffen.
Durch die Herstellung und Unterhaltung der Ausgleichsflächen A1 Herterwiesen und A2 Neubruch-Wiese wird die Nutzung und Erreichbarkeit der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen nicht beeinträchtigt. Die Zufahrtsmöglichkeit zu den landwirtschaftlichen Flächen bleibt unverändert bestehen.
Bei den Pflanzmaßnahmen sind die geltenden Vorschriften des Nachbarschaftsrechts zu beachten, so dass eine Beeinträchtigung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen nicht vorliegt.
- Forstwirtschaftliche Stellungnahme
Seitens des AELF wird auf die waldrechtliche Flächenausgleichspflicht verwiesen und das Benehmen zur Waldrodung in Aussicht gestellt. Zusätzlich wird bestätigt, dass der Umweltbericht die vorausgegangenen Abstimmungsergebnisse wiederspiegelt. In der Flächenbilanz werden geringfügige Flächendifferenzen ausgemacht, die in der Gesamtschau als unerheblich eingestuft werden. Die Bilanzierung ist dennoch zu überprüfen und ggf. anzupassen.
In der Maßnahmenbeschreibung der Aufforstungsflächen empfiehlt das AELF die Verwendung anderer Hauptbaumarten. Empfohlen wird die Verwendung von Stieleiche und Berghorn anstelle von Rotbuche. Zusätzlich sollen die Pflanzverbände überprüft und angepasst werden auf der Grundlage der Publikaton „Kulturbegründung und Jungwuchspflege – Wegweiser für bayerische Waldbesitzer“.
Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme des AELF -Landwirtschaft und forstfachlich-waldrechtlich - zur Kenntnis. Durch die landwirtschaftliche Stellungnahme ergibt sich kein Änderungsbedarf an der Planung.
Mit der forstfachlichen und waldrechtlichen Stellungnahme wird das Ergebnis der bisherigen Abstimmungen bestätigt. Zusätzlich ist im Umweltbericht die Bilanzierung des forstrechtlichen Ausgleichs zu überprüfen und ggf. redaktionell anzupassen. Ergänzend sind in der Maßnahmenbeschreibung der Ausgleichsflächen A1 Herterwiesen und A2 Neubruch-Wiese hinsichtlich die zu verwendenden Hauptbaumarten redaktionell anzupassen und auch der Abstand der Pflanzverbände redaktionell abzustimmen.
Die Anregung zur Wiederbewaldung der Fläche nach Nutzungsaufgabe der Asphaltmischanlage wird zur Kenntnis genommen. Änderungen am Bebauungsplan sind daraus nicht begründet.
3.4 Landratsamt Ebersberg, untere Naturschutzbehörde, Schreiben vom 29.05.2024
wir bedanken uns für die gewährte Fristverlängerung und nehmen aus Sicht des Naturschutzes wie folgt Stellung:
Der vorgelegte Planentwurf war in seinen Grundzügen Gegenstand eines Abstimmungsgesprächs bei der Stadt Ebersberg am 19. Juni 2023, bei dem die Vorbehalte des Naturschutzes gegen die Planung der Ausgleichsmaßnahmen erörtert wurden. An der Sichtweise der UNB hat sich seit dem Abstimmungsgespräch nichts geändert. Die naturschutzfachlichen Bedenken gegenüber den Maßnahmenstandorten sind weiterhin aufrecht und werden nachfolgend dargestellt:
Die Planung sieht die Aufforstung eines östlich an einen Wald angrenzenden Dauergrünlands, der
sog. „Herterwiese“, sowie einer südexponierten, an bestehende Ausgleichsflächen angrenzenden
Dauergrünlandfläche vor. Beide zur Aufforstung vorgesehenen Maßnahmenstandorte werden derzeit in einer Kombination aus Mahd und Beweidung als sog. Mähweiden landwirtschaftlich genutzt. Die aktuelle landwirtschaftliche Nutzung durch Schafbeweidung bzw. 3-4 Mahdgänge pro Jahr kommt einem extensiven Nutzungskonzept bereits nahe. Zum Vergleich: Intensivgrünland wird in unseren Breiten wenigstens fünf Mal, häufig jedoch bis zu sieben Mal im Jahr gemäht. Bei Beschränkung auf Festmistdüngung und geringfügiger Anpassung d. Mahdkonzepts wäre die aktuell ausgeübte Bewirtschaftung sogar förderfähig nach den Maßstäben des Vertragsnaturschutzprogramms (VNP).
Aus naturschutzfachlicher Sicht bietet die sonnseitige Lage der zur Aufforstung vorgesehenen Flä-
chen i. V. m. der derzeit ausgeübten Bewirtschaftung eine ideale Ausgangslage zur Anlage von Ökokontoflächen mit dem Ziel der Entwicklung von artenreichen Blühwiesen unter Fortführung der bereits jetzt praktizierten Schafbeweidung. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Verknappung von Offenlandlebensräumen durch die rege Bautätigkeit im Münchner Umland halten wir es nicht für erstrebenswert, diese Flächen für einen Waldausgleich zu nutzen. Für die Anlage von Ausgleichsflächen für einen Eingriff im Offenland sind sie jedoch bestens geeignet.
Wie bereits im Abstimmungsgespräch erläutert, steht im Falle der „Herterwiese“ möglicherweise auch der Artenschutz (§44 BNatSchG) einer Aufforstung entgegen. Der Abstand zwischen dem bestehen den Waldrand und dem Siedlungsgebiet beträgt im Schnitt ca. 350 Meter. Dieser Raum wird ackerbaulich genutzt und ist frei von Störkulissen wie Bäumen oder Leitungen, welche Greifvögeln als Ansitzwarten dienen könnten. Nach Rücksprache mit Gebietskennern halten wir ein Vorkommen der Feldlerche in diesem Raum für mindestens möglich, wenn nicht sogar für wahrscheinlich. Bei Realisierung der geplanten Aufforstung der „Herterwiese“ würde der Waldrand als Störkulisse weiter in den Lebensraum feldbrütender Vogelarten hineinwirken. Deren Lebensraum würde dadurch geschmälert.
Fazit:
Hinsichtlich d. geplanten Aufforstung d. „Herterwiese“ besteht Klärungsbedarf betr. der Feldbrüter-
problematik (§44 BNatSchG). Davon abgesehen bestehen aus naturschutzrechtlicher Sicht keine
Gründe, die der Erteilung einer Aufforstungsgenehmigung sowohl für die „Herterwiese“, als auch für die anderen zur Aufforstung vorgesehenen Flächen entgegenstehen würden. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir die geplante Aufforstung dieser für die Entwicklung v. artenreichen Extensivwiesen äußerst potentialträchtigen Flächen aus den o.g. Gründen d. h. aus naturschutzfachlicher Sicht nicht mittragen können.
Behandlungsvorschlag:
Mit der Unteren Naturschutzbehörde wurden mehrere Abstimmungen durchgeführt. U.a. wurde eine Habitatanalyse für den Bereich Herterwiese erstellt, die den artenschutzrechtlichen Klärungsbedarf der Feldbrüter (Feldlerche) untersucht hat. Die Habitatanalyse (PLG Strasser GmbH, Fassung vom 30.07.2024) kommt zum Ergebnis, dass im betreffenden Raum der Herterwiese ein Vorkommen der Feldlerche und anderer Bodenbrüter mit hinreichender Prognosesicherheit ausgeschlossen werden kann. Seitens der Unteren Naturschutzbehörde wurde dem Ergebnis der Habitatanalyse zugestimmt (s. Mail vom 31.07.2024).
Weiterhin kommt die Habitatanalyse zum Ergebnis, dass die geplante Ausgleichsfläche Waldaufforstung mit Waldsaum die Habitateignung für andere Tiergruppen verbessern wird. Hierzu zählen z.B. Säugetiere (Haselmaus, Fledermäuse) Vögel und Insekten.
Der Ausgleich kann somit ohne artenschutzrechtliche Konflikte im Bereich der Herterwiese erbracht werden.
Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Unter Berücksichtigung der durchgeführten Habitatanalyse (plg Strasser GmbH, Fassung vom 30.07.2024) wird das Ausgleichsflächenkonzept Herterwiese weiterverfolgt.
3.5 Öffentlichkeit 1, Schreiben vom 22.03.2024
Behandlungsvorschlag:
Zunächst ist festzustellen, dass auf der Ebene des Flächennutzungsplanes (vorbereitender Bauleitplan) keine verbindlichen Rechte festgesetzt werden.
Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung vom 24.05.2024 bereits mit den Abständen der Anwesen des Einwenders ausführlich auseinandergesetzt. Hierauf wird insoweit verwiesen.
„In Beurteilung der vorgebrachten Bedenken wurde vom Landratsamt Ebersberg – SG Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatl. Abfallrecht per Email vom 25.08.2021 folgende Einschätzung vorgenommen:
„Die Ausweisung als Sondergebiet greift nicht auf die immissionsschutzfachlichen Anforderungen der Asphaltmischanlage zu. Sie ermöglicht lediglich die Loslösung vom zeitlich begrenzten Kiesabbau, was zu einer unbefristeten Genehmigung führen könnte. Die Anforderungen zum Schutz und zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen für den aktuellen Betriebszustand sind im Bescheid geregelt und entsprechend vollziehbar.
Es ist verständlich, dass die Einstellung zu einem befristeten Vorhaben ein anderes ist, als zu einem unbefristeten, zumal es wie ein Weg über die Hintertür erscheinen mag. Die immissionsschutzfachlichen Beurteilungsgrundlagen bleiben im vorliegenden Fall jedoch die gleichen. Im Zuge der Bauleitplanung sind daher keine weiteren Gutachten erforderlich. Bei wesentlichen Änderungen wird die Anlage neu beurteilt und erforderlichenfalls um die Vorlage von Gutachten gebeten.“
Die Abstände der baulichen Anlagen des Anwesens Thailing zum geplanten Vorhaben betragen mindestens circa 900 m. Die Abstände zu den als Golfplatz genutzten Freiflächen betragen circa 275 m. Die nördlich und nordöstlich an das Planungsgebiet heranreichenden, zwischenliegenden Flächen sind bewaldet, die östlich des Planungsgebiets benachbarten Flächen werden nach Beendigung des Kiesabbaus bzw. wurden in Teilen bereits rekultiviert bzw. aufgeforstet. Nach derzeitiger Einschätzung sind demnach durch die vorliegende Planung keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf das Anwesen Thailing zu erwarten.“
Zum Vortrag des Einwenders hinsichtlich der beschriebenen Klageverfahren ist nach Recherchen der Verwaltung folgendes zu entgegnen:
Der Einwender nimmt in seinem Schreiben vom 22.03.2024 Bezug auf die damaligen Verfahren, wobei die inhaltlichen Aussagen in dem Schreiben nahezu vollständig nicht zutreffen.
Daher wird nachfolgend kurz die wesentliche Historie zusammengefasst:
- Am 27.07.2001 erhielt die Antragstellerin für die geplante Errichtung und den Betrieb einer Asphaltmischanlage auf dem Betriebsgelände an der Schafweide den immissionsschutzrechtlichen Vorbescheid mit der Feststellung der grundsätzlichen Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens im Hinblick auf die bauplanungsrechtlichen, waldrechtlichen und naturschutzrechtlichen Vorgaben sowie im Hinblick auf die Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG (vgl. Anlage).
Am 28.08.2001 erhoben die Rechtsanwälte Klage (für eine Streitgenossenschaft, u.a. des Einwenders) gegen den Freistaat Bayern, mit dem Antrag, den Vorbescheid aufzuheben. Mit Urteil des Bayer. Verwaltungsgerichtes München vom 11.12.2003 wurde die Klage der Streitgenossenschaft abgewiesen.
- Am 07.02.2002 erhielt die Antragstellerin die zeitlich befristete immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Asphaltmischanlage auf o.g. Betriebsgelände. Der damalige Genehmigungsbescheid erging unter zahlreichen Nebenbestimmungen, so enthielt er u.a. eine auflösende Bedingung mit der Festsetzung, dass das für die Produktion notwendige Sand-, Kies- und Gesteinsmaterial ausschließlich aus dem umliegenden Kiesabbaugelände gefördert werden muss und die Anlieferung und Verarbeitung von Sand-, Kies- und Gesteinsmaterial aus anderen Abbaugebieten nicht zulässig ist. Gegen die Entscheidung des Landratsamtes Ebersberg erhoben die Rechtsanwälte im Auftrag der Streitgenossenschaft Klage. Die Klagen wurden im einstweiligen Rechtsschutzverfahren zu Lasten der Kläger abgewiesen.
Im Frühjahr 2003 wurde die Asphaltmischanlage in Betrieb genommen. Im April 2003 zeigte die Kanzlei beim Landratsamt Ebersberg die Anlieferung von Gesteinsmaterial aus anderen Abbaugebieten an. Anschließend wurde der Klageantrag der Streitgenossenschaft um einen Antrag ergänzt, mit dem die Feststellung des Eintritts der auflösenden Bedingung infolge der "Fremdgesteinsanlieferung" begehrt wurde. Nach einer mündlichen Verhandlung beim Bayer. Verwaltungsgericht München im September 2003 und erfolglosen Vergleichsverhandlungen im Herbst 2003 traf das Bayer. Verwaltungsgericht München mit Urteil vom 11.12.2003 (vgl. Anlage) folgende Hauptsacheentscheidung:
"I. Auf Klage des Klägers zu 1) (Einwender) hin wird festgestellt, dass der Genehmigungsbescheid des Landratsamtes Ebersberg vom 07. Februar 2002– Az. 44/824-7 Ebersberg/S – spätestens zum 14. April 2003 weggefallen ist. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen."
- Aufgrund des verwaltungsgerichtlichen Urteils vom 11.12.2003, welches jedoch aufgrund einer Berufung des Antragstellers und des Urteils des BayVGH vom 12.08.2004 nicht rechtskräftig wurde, wurde seitens der Antragstellerin im zeitigen Jahr 2004 die Neuerteilung einer Genehmigung für das Asphaltmischwerk angestrebt und beantragt. Im Antragsschreiben vom 21.01.2004 wurde eine zeitlich an die Betriebsdauer des Kiesabbaus gekoppelte Genehmigung beantragt.
Die (erneute) immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde mit Bescheid vom 27.05.2004 erteilt, welche die infolge des Eintritts einer auflösenden Bedingung entfallene Genehmigung aus dem Jahr 2002 ersetzte. Auch diese Genehmigung wurde von einer Streitgenossenschaft und einem Privatkläger (Einwender) beklagt. Die Klagen wurden jedoch im Rahmen der mündlichen Verhandlung beim VG München vom 05.07.2005 zurückgenommen, nachdem der Vorsitzende Richter erhebliche Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit der Klagen äußerte, so dass die Klageverfahren eingestellt wurden. Grund hierfür waren die Zweifels des Gerichts, ob die Kläger überhaupt eine Rechtsverletzung geltend machen können, da die Luftimmissionen zu keiner deutlichen Zusatzbelastung führen würden. Insofern stellt sich daher die Frage, welche anderen Gründe nun vorgetragen werden sollen, im Vergleich zu der bereits nicht tragfähigen Begründung von vor 20 Jahren. Im Übrigen weist die Verwaltung daraufhin, dass die Fragen der Umweltbelastung auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu klären sind.
- Mit Bescheid vom 10.07.2012 (vgl. Anlage) wurde der Fa. Swietelsky die bisher einzige Änderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG für das Asphaltmischwerk erteilt, welche nicht angefochten wurde.
Daneben fanden in den letzten 20 Jahren einzelne Anzeigeverfahren nach § 15 BImSchG für kleinere Änderungsmaßnahmen statt, welche keine Genehmigungsrelevanz aufwiesen.
Aufgrund der zwischenzeitlich bestehenden Rechtskraft der in der Vergangenheit getroffenen Entscheidungen kann nicht nachvollzogen werden, welche der damaligen Klageverfahren einer „Wiederaufnahme“ zugeführt werden sollen. Im Übrigen erreichten die damaligen Klageverfahren in materieller Hinsicht keine zusätzlichen Schutzvorkehrungen. Alle getroffenen Maßnahmen (insbesondere drittschützende Auflagen in den Genehmigungen) wurden von Amts wegen aufgrund entsprechender rechtlicher Vorgaben getroffen. In der Vergangenheit wurde in den verschiedenen verwaltungsgerichtlichen Instanzen eine rechtserhebliche Betroffenheit des Einwendungsführers durch den Betrieb der Anlage in Zweifel gezogen. Der tatsächliche Betrieb des Asphaltmischwerkes wird im Rahmen des § 52 BImSchG regelmäßig durch das Landratsamt Ebersberg überwacht. Die letzte Nachbarbeschwerde zum Betrieb der Anlage datiert aus dem Jahr 2017 und erwies sich nach unseren Feststellungen als unbegründet.
Zu widersprechen ist dem Vortrag des Einwenders auch dahingehend, dass er sich hinsichtlich der der nun angestrebten dauerhaften Genehmigung hintergangen fühle. Die Stadt hat mit der 15. Flächennutzungsplanänderung und der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 218 – Sondergebiet Asphalt und Kies ein transparentes öffentliches Verfahren durchgeführt. Der Vorwurf des „Hintergehens“ liegt somit völlig neben der Sache.
Beschlussvorschlag:
Die Einwendung wird Kenntnis genommen. Eine Planänderung ist nicht erforderlich.
3.6 Öffentlichkeit 2, Schreiben vom 29.04.2025 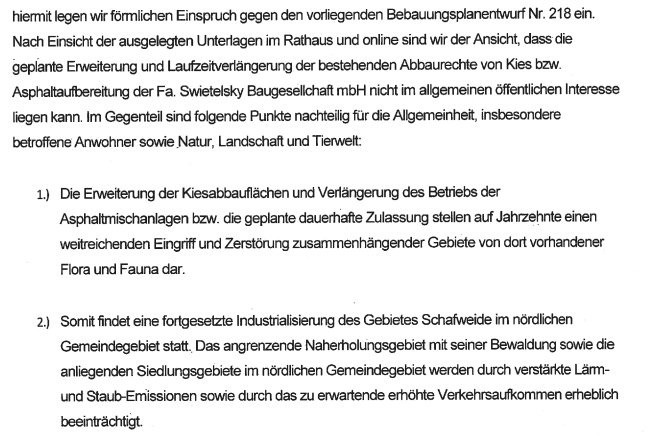
Behandlungsvorschlag:
Gegenstand der Planung ist nicht eine Erweiterung einer Kiesabbaufläche, sondern vielmehr ein dauerhafter Betrieb der bereits bestehenden Asphaltmischanlage ohne Koppelung an einen Kiesabbau vor Ort. Die Planung umfasst im Wesentlichen den bereits jetzt vorhandenen Bestand. Lediglich im östlichen Bereich erfolgt eine Erweiterung für ein Büro und Werkstattgebäude innerhalb eines Laubmischwaldes mit einer Fläche von rund 3.000 qm, was etwa 6% der Gesamtfläche entspricht.
Zu 2:
Es ist richtig, dass ein dauerhafter Betrieb der bestehenden Asphaltmischanlage erfolgen soll. Die Stadt geht davon aus, dass im Vergleich zum Bestand weder eine verstärkte Lärmentwicklung noch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen verursacht wird. Selbst wenn diese Prognose nicht zutreffen sollte, befinden sich im Umfeld keine Immissionsorte, die von einem erhöhten Lärm betroffen sein könnten.
Nach Ziffer 7.4 der TA Lärm kommen ggf. für Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstück in Kur-, Wohn-, Kern-, Dorf- und Mischgebieten Maßnahmen organisatorischer Art in Frage, soweit die nachfolgenden Anforderungen kumulativ erfüllt sind:
- Erhöhung des Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A),
- es ist keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt und
- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) werden erstmals oder weitergehend überschritten.
Die Stadt geht nicht davon aus, dass diese Kriterien kumulativ nicht vorliegen.
Selbst wenn diese Kriterien kumulativ erfüllt wären, wären Maßnahmen lediglich in einem Abstand von 500 m vom Betriebsgrundstück erforderlich. In diesem Bereich liegt aber keine schützenswerte Nutzung, so dass Maßnahmen insgesamt nicht erforderlich sind.
Zu 3:
Selbst wenn die Annahme zutreffen sollte, dass eine Verkehrserhöhung stattfindet, so wären hiergegen nach der TA Lärm keine Maßnahmen zu treffen.
Eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist über die Bauleitplanung nicht zu regeln. Im Übrigen wird davon ausgegangen, dass diese Geschwindigkeitsüberschreitung nicht ausschließlich durch den Verkehr der Asphaltmischanlage erfolgt.
Zu 4:
Aufgrund des dauerhaft zulässigen Betriebs der Anlage wird nicht von einer massiven Verschlechterung der Situation ausgegangen, sondern von einer Verlängerung des Betriebs.
Der Betrieb der Anlage ist genehmigt. In diesem Rahmen musste die Einhaltung der geltenden technischen Anforderungen und Umweltstandards nachgewiesen werden. Zusätzliche Auflagen können in der Bauleitplanung nicht gemacht werden.
Eine Betriebsaufgabe nach Auslaufen der Genehmigung würde die unterstellten Belastungen lediglich in andere Regionen verlagern, ohne dass die unterstellten Auswirkungen aber insgesamt verringert würden. Hinzu kämen längere Transportwege in die Region, da der Bedarf an Asphalt unabhängig vom Anlagenstandort durch eine Betriebsaufgabe in Ebersberg nicht geringer wird.
Die Erforderlichkeit der Bauleitplanung richtet sich nach den in § 1 BauGB genannten Kriterien. Hierbei spielt die Frage, ob davon einzelne Unternehmen profitieren keine wesentliche Rolle. Maßgeblich im Rahmen der Gesamtabwägung ist die Frage, ob die gegen die Planung sprechenden Belange soweit überwiegen, dass die Planung aufgegeben werden muss. Dies kann die Stadt hier aber insgesamt nicht erkennen.
Beschlussvorschlag:
Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen. Eine Ergänzung oder Änderung der Planung ist nicht erforderlich.
Der Technische Ausschuss hat sich der Sache in seiner Sitzung am 17.09.2024 angenommen.
Beschluss
- Der Stadtrat nimmt von den während der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlichen Belange eingegangenen Stellungnahmen zur 15. Flächennutzungsplanänderung (Teilgebiet A) – Sondergebiet Asphalt und Kies Kenntnis.
- Der Stadtrat macht sich die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage vom 05.11.2024 zu eigen. Der Planer wird beauftragt, die heute beschlossenen Änderungen in den Flächennutzungsplanentwurf einzuarbeiten.
- Der Stadtrat fasst für die 15. Flächennutzungsplanänderung (Teilgebiet A) Sondergebiet Kies und Asphalt für die FlNr. 3294, 3295, 3284 TFl., 3285 TFl., 3283 TFl., jeweils Gemarkung Oberndorf den Feststellungsbeschluss.
- Die Verwaltung soll beauftragt werden, das Genehmigungsverfahren für die 15. Flächennutzungsplanänderung (Teilgebiet A) – Sondergebiet Kies uns Asphalt einzuleiten.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 0
Abstimmungsbemerkung
bei Abwesenheit von zweitem Bürgermeister Obergrusberger und den Stadträten Münch und Dr. Schulte-Langforth
Dokumente
Download 15a FNP Ebersberg 231114.pdf
Download Begruendung 15a FNP_SO Kies _231114.pdf
zum Seitenanfang
7. 17. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan - "Sondergebiet Windenergie Föhrenpold";
Ausweisung eines Sondergebiets Windenergienutzung nordwestlich der Ortschaft Pollmoos (FlNr. 1829, 1830, 1831, 1833, 1538/5, 1538/4, 1540, 1787 jeweils Gemarkung Oberndorf);
Behandlung der Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB);
Empfehlung für den Feststellungsbeschluss
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
05.11.2024
|
ö
|
beschließend
|
7 |
Sachverhalt
A. Vorgeschichte:
Mit Beschluss des Ferienausschusses der Stadt Ebersberg vom 20.08.2024 wurde der Billigungs- und Auslegungsbeschluss für die 17. Flächennutzungsplanänderung gefasst. Die förmliche öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) und die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) fand zwischen dem 27.08.2024 und dem 27.09.2024 statt.
Von der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen.
B. Eingegangene Stellungnahmen:
1. Keine Rückmeldung haben abgegeben:
1.1 Landratsamt Ebersberg, Wasserrecht
1.2 Kreisheimatpfleger
1.3 Staatliches Bauamt Rosenheim
1.4 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Ebersberg
1.5 Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern
1.6 Bayerischer Bauernverband München
1.7 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
1.8 Landratsamt Ebersberg, Brandschutzdienststelle
1.9 Polizeiinspektion Ebersberg
1.10 Kreisjugendring Ebersberg
1.11 Evang. Pfarramt Ebersberg
1.12 Kath. Pfarramt Ebersberg
1.13 Erzbischöfliches Ordinariat München
1.14 Deutsche Telekom
1.15 Deutsche Funkturm
1.16 Energienetze Bayern
1.17 Stadt Grafing b. München
1.18 Gemeinde Forstinning
1.19 Gemeinde Hohenlinden
1.20 Gemeinde Anzing
1.21 Gemeinde Frauenneuharting
1.22 BUND Naturschutz, Kreis Ebersberg
1.23 Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe Ebersberg
1.24 Bayerischer Jagdverband
1.25 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
1.26 Stadt Ebersberg, Klima- und Energiemanager
1.27 Stadt Ebersberg, Amt für Familie und Kultur
1.28 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
1.29 Bayerische Staatsforsten
1.30 Landesamt für Umwelt
1.31 Regierung von Oberbayern, Gewerbeaufsichtsamt
1.32 Deutscher Modellfliegerverband e. V.
1.33 Modellflugsportverband Deutschlang e. V.
2. Keine Anregungen / Bedenken haben vorgetragen
2.1 Regionaler Planungsverband München, Schreiben vom 09.09.2024
2.2 Landratsamt Ebersberg, untere Immissionsschutzbehörde, Schr. v. 16.09.2024
2.3 Landratsamt Ebersberg, Gesundheitsamt, Schreiben vom 23.09.2024
2.4 Wasserwirtschaftsamt Rosenheim, Schreiben vom 27.08.2024
2.5 Handwerkskammer für München und Oberbayern, Schr. vom 24.09.2024
2.6 Vodafone GmbH, Schreiben vom 17.09.2024
2.7 Bayernwerk Netz GmbH, Schreiben vom 06.09.2024
2.8 Markt Kirchseeon, Schreiben vom 27.08.2024
2.9 Gemeinde Steinhöring, Schreiben vom 27.08.2024
2.10 Stadt Ebersberg, Abfall/Umwelt, Schreiben vom 24.09.2024
2.11 Bundesnetzagentur Richtfunk, Schreiben vom 27.08.2024
2.12 Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, Schreiben vom 26.08.2024
2.13 Ericsson Services GmbH, Schreiben vom 09.09.2024
2.14 Regierung von Oberbayern, Bergamt Südbayern, Schr. v. 24.09.2024
2.15 Bayernets GmbH, Schreiben vom 27.08.2024
2.16 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Schreiben vom 18.09.2024
2.17 LRA Ebersberg, Bauleitplanung, Schreiben vom 26.09.2024
2.18 IHK München und Oberbayern
2.19 Landratsamt Ebersberg, untere Naturschutzbehörde, Schr. vom 27.09.2024 (eing.27.09.24)
3. Folgende Stellungnahmen wurden abgegeben:
3.1 Regierung von Oberbayern, Raumordnung und Landesplanung, Schr. vom 27.08.2024
3.2 Stadt Ebersberg, Tiefbau, Schreiben vom 27.08.2024
3.3 Regierung von Oberbayern, Luftamt Südbayern, Schreiben vom 27.08.2024
3.4 Deutsche Flugsicherung GmbH, Schreiben vom 13.09.2024
3.5 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding Schr. v. 30.09.2024
C. Behandlung der Stellungnahmen:
3.1 Regierung von Oberbayern, Raumordnung und Landesplanung, Schreiben vom 27.08.2024
Sachvortrag:
die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde gibt folgen-
de Stellungnahme zur o.g. Bauleitplanung ab.
Ergebnisse der letzten Stellungnahme
Zur o.g. Planung gaben wir bereits mit Schreiben vom 28.06.2024 eine Stel-
lungnahme ab. Darin kamen wir zu dem Schluss, dass die Darstellung eines
Sondergebietes SO „Windenergie“ den Erfordernissen der Raumordnung nicht
grundsätzlich entgegensteht, sofern die Hinweise zu den Zielen und Grundsät-
zen der Raumordnung (u.a. Natur, Landschaft und Freiraumstruktur) beachtet
bzw. berücksichtigt werden.
Diese waren:
Planung:
Die Stadt Ebersberg beabsichtigt die Darstellung eines sonstigen Sondergebie-
tes nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Windenergie“. Ziel der Pla-
nung ist die Errichtung einer Windkraftanlage mit einer Gesamthöhe (einschl.
Rotor) von 246,60 m. Das Planungsgebiet (Größe ca. 4,2 ha) befindet sich
nordwestlich von Pollmoos innerhalb des Bergholzes und ist im gültigen Flä-
chennutzungsplan der Stadt überwiegend als „Flächen für Wald“ (forstwirtschaft-
liche genutzte Flächen) darstellt.
Erfordernisse der Raumordnung:
Gemäß LEP 1.3.1 (G) soll den Anforderungen des Klimaschutzes Rechnung
getragen werden, insbesondere durch (...) die verstärkte Erschließung und Nut-
zung erneuerbarer Energien (...).
Gemäß LEP 5.4.1 (G) sollen land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete
erhalten werden. Insbesondere hochwertige Böden sollen nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für andere Nutzungen in Anspruch genommen werden.
Gemäß LEP 5.4.2 (G) sollen große zusammenhängende Waldgebiete, Bannwälder und landeskulturell oder ökologisch besonders bedeutsame Wälder vor Zerschneidungen und Flächenverlusten bewahrt werden.
Gemäß LEP 6.2.1 (Z) sind erneuerbare Energien verstärkt zu erschließen und zu nutzen.
Gemäß LEP 6.2.2 (Z) sind in den Regionalplänen im Rahmen von regionsweiten Steuerungskonzepten Vorranggebiete für die Errichtung von Windkraftanlagen festzulegen.
Gemäß LEP 6.2.2 (G) können in den Regionalplänen im Rahmen von regionsweiten Steuerungskonzepten ergänzend Vorbehaltsgebiete für die Errichtung von Windkraftanlagen festgelegt werden.
Gemäß LEP 7.1.3 (G) sollen Freileitungen, Windkraftanlagen und andere weithin sichtbare
Bauwerke insbesondere nicht in schutzwürdigen Tälern und auf landschaftsprägenden Geländerücken errichtet werden.
Gemäß RP 14 B IV G 7.7 sollen kommunale Windkraftplanungen gefördert werden.
Landesplanerische Bewertung
Energieversorgung
Unter dem Aspekt einer nachhaltigen Energieversorgung ist die Planung als Positivsteuerung von Windkraftanlagen grundsätzlich zu begrüßen. Vorranggebiete für die Errichtung von Windkraftanlagen sind im Regionalplan der Region München bisher nicht festgelegt.
Natur, Landschaft und Freiraumstruktur
Das Planungsgebiet liegt innerhalb überwiegend forstwirtschaftlich genutzter Flächen. Das
Waldstück ist dabei gemäß Waldfunktionsplan der Bayerischen Forstverwaltung nicht als Fläche von besonderer Bedeutung kartiert. Auch handelt es sich nicht um Schutz- oder Bannwald.
Im Umfeld der geplanten Windenergieanlage kann weiterhin eine ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Nutzung gewährleistet werden. Des Weiteren ist aufgrund der Höhendifferenz zu den Baumwipfeln zu erwarten, dass die von den Rotoren überstrichene Fläche weiterhin forstwirtschaftlich genutzt werden kann. Die in der Bauphase temporär in Anspruch genommenen Flächen werden nach Abschluss der Bauarbeiten wiederaufgeforstet. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Waldflächen (Rodung) beschränkt sich auf vergleichsweise kleine Teile im Bereich des Mastfußes, den Kranstellflächen sowie der Zuwegung. Der genaue Umfang der erforderlichen Rodungsmaßnahmen wird im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren konkretisiert. Geeignete Ausgleichsflächen werden im weiteren Verfahren aufgezeigt.
Im Süden und Norden des Standortes ist die Landschaft geprägt von landwirtschaftlichen
Acker- und Grünlandflächen. Zwischen Traxl und Rinding befinden sich entlang der Landstraße Kiesabbaustellen. Die Topographie kann als flachwellig betrachtet werden, wobei sich der geplante Standort auf einer leichten Anhöhe befindet. In Hinblick auf das Landschaftsbild (Einsehbarkeit bzw. Fernsicht) kann aus landesplanerischer Sicht keine abschließende Bewertung vorgenommen werden. Die Wirkung einer einzelnen Windkraftanlage dürfte sich aufgrund der Lage im Wald (Bergholz) erst aus größerer Entfernung offenbaren.
Immissionsschutz
Laut Umweltbericht befindet sich die nächstgelegene Wohnbebauung zum Ortsteil Pollmoos, welcher sich etwa 600 m südöstlich des geplanten WEA-Standorts befindet. In ungefähr 1 km Entfernung lägen die Dörfer Englmeng im Norden und Traxl im Süden. Im gültigen Flächennutzungsplan seien beide als Dorfgebiet (MD) ausgewiesen. Im Zuge des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens werde anhand des konkreten Anlagentyps und Anlagenstandorts ein Schallschutzgutachten erstellt und die zu erwartenden Lärmemissionen detailliert geprüft. Weiterhin werde ein Gutachten zum Schattenwurf erstellt. Die Ergebnisse der Fachgutachten würden im weiteren Verfahren ergänzt.
Denkmalschutz
Gemäß vorgelegter Begründung/Umweltbericht befinden sich laut Bayerischem Landesamt für Denkmalpflege keine Bau- oder Bodendenkmäler innerhalb des Plangebiets. Im Süden von Pollmoos in etwa 600 m vom geplanten Standort der WEA entfernt befände sich ein Baudenkmal (Hofkapelle, Aktennummer D-1-75-115-88). Darüber hinaus seien keine besonders landschaftsprägenden Denkmäler im Änderungsbereich oder in dessen Umfeld. Die nächsten besonders landschaftsprägenden Denkmäler befänden sich erst in einem Abstand von rund 15 km um die geplante WEA. Hierbei handelt es sich um die Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt bei Tuntenhausen im Süden, die Wasserburger Altstadt im Osten sowie das Schloss Haag im Nordosten.
Flugsicherung
Um eine Störung des zivilen und militärischen Luftverkehrs (insbesondere von Radaranlagen der Flugsicherung) grundsätzlich zu vermeiden, wird eine Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden empfohlen. Ergänzend weisen wir darauf hin, dass gem. § 14 Abs. 1 LuftVG Bauwerke über 100 m der Zustimmung der Luftfahrtbehörde bedürfen. Laut vorgelegter Begründung wurde am Landratsamt Ebersberg bereits ein immissionsschutzrechtliches Vorbescheidsverfahren am 13.01.2023 eingeleitet. Mit Bescheid vom 01.08.2023 erging seitens des Landratsamtes die Entscheidung, dass die Windkraftanlage mit einer Gesamthöhe von 246,6 m an der beantragten Stelle im Hinblick auf die Belange des zivilen und militärischen Luftverkehrs grundsätzlich genehmigungsfähig ist.
Naturschutz
Um sicherzustellen, dass die Windkraftanlage keine Störung des Naturhaushaltes bewirkt und die Belange des Artenschutzes hinreichend berücksichtigt werden, kommt den Ausführungen der höheren Naturschutzbehörde eine besondere Bedeutung zu:
Die höhere Naturschutzbehörde (SG 51 der Regierung von Oberbayern) wird voraussichtlich in gesonderter Mitteilung zu den vorliegenden Planungen Stellung nehmen.
Gesamtergebnis:
Aus Sicht der höheren Landesplanungsbehörde steht die Darstellung eines Sondergebietes SO„Windenergie den Erfordernissen der Raumordnung grundsätzlich nicht entgegen, sofern die Hinweise zu den o.g. Zielen und Grundsätzen der Raumordnung beachtet bzw. berücksichtigt werden.
Neue Planunterlagen vom 20.08.2024:
Da sich der Sachverhalt in landesplanerisch relevanten Aspekten nicht geändert
hat, ist eine erneute Bewertung aus fachlicher Sicht nicht veranlasst.
Behandlungsvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die im Schreiben vom 28.06.2024 angesprochenen Punkte wurden bzw. werden wie folgt berücksichtigt:
Natur, Landschaft Freiraumstruktur:
Berücksichtigung im Umweltbericht bzw. auf der Ebene des Genehmigungsverfahrens im landschaftspflegerischen Begleitplan. Für die Auswirkungen auf die Landschaft wurde festgestellt, dass diese nicht kompensierbar sind. Es wird deshalb gem. § 15 Abs. 6 Satz 1 BNatSchG eine Ersatzzahlung geleistet.
Immissionsschutz:
Die Belange des Immissionsschutzes werden auf der Ebene des Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. Hierzu liegt bereits ein entsprechendes schalltechnisches Gutachten vor. Die untere Immissionsschutzbehörde hat im Rahmen des FNP-Verfahrens keine Anregungen mehr vorgetragen.
Denkmalschutz:
Belange des Denkmalschutzes sind durch die Planung nicht betroffen. Sollten wieder erwarten Bodendenkmäler zu Tage treten, wird dies im Rahmen der Genehmigungsplanung behandelt.
Flugsicherung:
Die Belange der Flugsicherung wurden auf der Ebene des Vorbescheidsverfahren berücksichtigt bzw. sind im weiteren immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu beachten.
Auf Ebene des Flächennutzungsplanes stehen Belange der Flugsicherung nicht entgegen. Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung hat mit Schreiben vom 18.09.2024 mitgeteilt, dass aufgrund § 18a LuftVG das Vorhaben im Einklang mit diesen Vorschriften steht. Ebenso bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben sowie die 17. FNP-Änderung.
Naturschutz:
Die Belange des Naturschutzes werden im Umweltbericht behandelt und im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens geprüft.
Eine Planänderung ist daher nicht erforderlich.
Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung ist nicht erforderlich.
3.2 Stadt Ebersberg Tiefbau:
Es wird auf die Stellungnahme vom 22.05.2024 verwiesen.
Diese lautete:
Kanalisation
Das Gebiet nordwestlich der Ortschaft Pollmoos, südlich der Ortschaft Englmeng, grenzt an keine Bebauung an. Eine öffentliche Kanalisation ist hier nicht vorhanden.
Anfallendes Regenwasser aus befestigten Flächen ist flächig auf dem jeweiligen Grundstück zu versickern.
Wasserversorgung
Das Gebiet nordwestlich der Ortschaft Pollmoos, südlich der Ortschaft Englmeng, grenzt an keine Bebauung an. Eine öffentliche Wasserversorgung ist hier nicht vorhanden. Eine Löschwasserversorgung aus der öffentlichen Wasserversorgung besteht daher für dieses Gebiet nicht.
Straßenbau
Die verkehrliche Anbindung des Gebietes nordwestlich der Ortschaft Pollmoos, südlich der Ortschaft Englmeng, ist über die angrenzende Gemeindeverbindungsstraße gewährleistet.
Aufgrund der Ausmaße von Windrädern, vor allem der Rotorflügel, muss überprüft werden, ob Ausbaumaßnahmen an Straßen, vor allem im Kurvenbereich, notwendig werden. Etwaige Ausbaumaßnahmen sind mit den jeweiligen Grundstückseigentümern abzustimmen und von deren Seite genehmigen zu lassen. Notwendiger Grundstücksbedarf ist vorab abzuklären und mittels einer Planung nachzuweisen.
Die Kosten für die Planung, den Bau, eventuell notwendigen Grundstückserwerb sowie notwendige Erschließungsmaßnahmen trägt der Bauwerber.
Allgemein
Um das geplante Projekt reibungslos durchführen zu können, ist aus Sicht der Tiefbauabteilung eine enge Abstimmung zwischen dem Bauwerber, den zuständigen Behörden und der Stadtverwaltung notwendig. Die notwendigen Anträge auf die erforderlichen Genehmigungen sollten daher unbedingt rechtzeitig zur Prüfung vorgelegt werden.
Behandlungsvorschlag:
Es wird auf die Behandlung in der Ferienausschusssitzung vom 20.08.2024 verwiesen. Neue Punkte wurden nicht vorgetragen.
Die Fragen der Löschwasserversorgung werden auf der Ebene der Genehmigungsplanung bearbeitet. Hierfür liegt den Antragsunterlagen ein Brandschutzgutachten des Büros Steinhöfer Ingenieure vom 19.02.2024 bei; hierauf wird verwiesen.
Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung ist nicht erforderlich.
3.3 Regierung von Oberbayern, Luftamt Südbayern, Schreiben vom 27.08.2024
Verwiesen wird auf die Stellungnahme vom 03.06.2024
Diese lautete:
1. Bauschutzbereich und ziviler Flugbetrieb:
Das Sondergebiet für Windenergie befindet sich außerhalb von Bauschutzbereichen von zivilen Flugplätzen und außerhalb von zivilen Kontrollzonen.
Ohne eine Überprüfung und Stellungnahme durch die Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS, Adresse: DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, SIS/ND, Am DFS-Campus 10, 63225 Langen), die bei Bauwerken ab einer Höhe von 100 m ü. Grund (Regelfall bei Windkraftanlagen) im Genehmigungsverfahren verpflichtend zu beteiligen ist, kann vom Luftamt Südbayern zu den Auswirkungen auf den zivilen Flugbetrieb keine abschließende Bewertung vorgenommen werden.
Wir empfehlen Ihnen deshalb dringend die Beteiligung der DFS als Träger öffentlicher Belange, da das Luftamt Südbayern etwaige Belange der DFS (z. B. Höhenbeschränkungen für Windkraftanlagen aufgrund festgelegter Flugverfahren, Meldepunkte, An- und Abflugflächen, etc.) nicht wahrnehmen kann.
2. Schutz von Flugsicherungseinrichtungen (§ 18a LuftVG):
Vom Bauschutzbereich eines Flugplatzes zu unterscheiden sind die Anlagenschutzbereiche der Flugsicherungseinrichtungen. Flugsicherungseinrichtungen befinden sich nicht nur in der Nähe von Flugplätzen, sondern verteilen sich auf dem gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Flugsicherungseinrichtungen sind z.B. UKW-Drehfunkfeuer (VOR), Entfernungsmessgeräte (DME) oder Radaranlagen. Bauwerke und Gelände in ihrer Umgebung können Störungen verursachen. Zum Schutz vor etwaigen Störungen sind um diese Flugsicherungseinrichtungen Schutzbereiche, sogenannte "Anlagenschutzbereiche" eingerichtet. Bauwerke, die innerhalb dieser Bereiche errichtet werden sollen, werden daraufhin geprüft, ob sie bei Flugsicherungseinrichtungen Störungen verursachen können. Nur weil ein Bauwerk innerhalb eines Anlagenschutzbereichs liegt, ist dessen Bau nicht per se ausgeschlossen, erfordert aber eine Prüfung und Entscheidung/Genehmigung durch das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) nach § 18a LuftVG.
Ob ein Bauwerk innerhalb eines Anlagenschutzbereichs liegt, kann mit der interaktiven 2D-Karte und noch exakter mit der 3D-Vorprüfung auf der Homepage des BAF geprüft werden. Demnach befinden sich das Sondergebiet für Windenergie vollständig innerhalb eines zivilen Anlagenschutzbereichs für Flugnavigationsanlagen und die obigen Ausführungen sind zu beachten.
Wir empfehlen deshalb dringend das BAF (Adresse: Monzastr. 1 in 63325 Langen) als Träger öffentlicher Belange zur Stellungnahme aufzufordern, da etwaige Interessen des BAF vom Luftamt Südbayern nicht wahrgenommen werden und eine Entscheidung nach § 18a LuftVG allein das BAF trifft.
3. Modelfluggelände:
Für Modelfluggelände liegt die Zuständigkeit ausschließlich bei zwei Verbänden, sodass wir dringend empfehlen, sie als Träger öffentlicher Belange zu beteiligen.
4. Bauwerke außerhalb des BSB (§ 14 LuftVG):
Jeder Standort unterliegt zudem allgemein den Anforderungen, die sich aus § 14 LuftVG ergeben. Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 LuftVG darf die für die Erteilung einer Genehmigung zuständige Behörde die Errichtung von Bauwerken außerhalb des Bauschutzbereiches, die eine Höhe von 100 m über der Erdoberfläche überschreiten, nur mit Zustimmung der Luftfahrtbehörde (Luftamt Südbayern) genehmigen. Die Windkraftanlagen bedürfen im Verfahren nach § 14 LuftVG stets einer Begutachtung durch die DFS gemäß § 31 Abs. 3 LuftVG. Diese gibt Auskunft darüber, ob aus zivilen und militärischen Flugbetriebsgründen i. S. d. § 14 LuftVG Einwendungen bestehen.
5. Militärische Belange:
Für die aus militärisch-flugsicherungstechnischen Gründen erforderliche gutachtliche Stellungnahme gemäß § 18a LuftVG (Schutz der militärischen Flugsicherungseinrichtungen) und für die militärischen Belange in den Bereichen der Flugsicherung, des Flugbetriebs und der Freiheit von Luftfahrthindernissen in den Bauschutzbereichen der Militärflugplätze liegt die Zuständigkeit gemäß § 30 Abs. 2 Satz 4 LuftVG ausschließlich bei der militärischen Luftfahrtbehörde (Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr – Referat Infra I 3, Fontainengraben 200 in 53123 Bonn). Sie ist zudem zu beteiligen hinsichtlich der militärischen Schutzbereiche, der Infrastruktur und der Liegenschaften der Bundeswehr. Wir regen daher auch dringend deren Beteiligung an.
Behandlungsvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Neue Belange wurden nicht mehr vorgetragen. Es wird auf die Behandlung der Stellungnahme in der Ferienausschusssitzung vom 20.08.2024 verwiesen.
Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung hat mit Schreiben vom 18.09.2024 mitgeteilt, dass sowohl die 17. Flächennutzungsplanänderung als auch das Vorhaben „Windkraftanlage Föhrenpold im Einklang mit § 18a LuftVG steht.
Die weiteren Belange werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens behandelt. Die angesprochenen Träger öffentlicher Belange wurden auch im Rahmen der förmlichen Beteiligung um Stellungnahme gebeten. Es wurde keine Anregungen bzw. Stellungnahme vorgetragen.
Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung ist nicht erforderlich.
3.4 Deutsche Flugsicherung GmbH, Schreiben vom 13.09.2024
Die Stellungnahme vom 06.06.2024, V202401365 gilt weiterhin.
Diese lautete:
Vortrag:
Durch oben genanntes Plangebiet ist der Anlagenschutzbereich gem. §18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG) der folgenden Flugsicherungseinrichtung betroffen:
- Radaranlage Großhaager Forst [GHF] - Geogr. Koordinaten (ETRS89): 48° 19‘ 30,22" N / 11° 46‘
07,64‘‘ E; Höhe des Geländes 456,5 m ü. NN; lateraler Radius 15 km
Für den aktuellen Planungsstand können aufgrund der vorliegenden Detaillierung keine weitergehenden Aussagen getroffen werden.
Wir empfehlen, innerhalb von Anlagenschutzbereichen keine Vorrang- und Eignungsgebiete zur Windenergienutzung auszuweisen, da die im Genehmigungsverfahren gem. §18a LuftVG möglichen Einschränkungen bezüglich Anzahl und Höhe der geplanten Windenergieanlagen dem eigentlichen Ziel von Vorrang- und Eignungsgebieten entgegenstehen. Dennoch könnte sich aufgrund örtlicher Gegebenheiten ein Potential für die Vereinbarkeit des Windenergievorhabens mit den Belangen des Anlagenschutzes ergeben. Um dies zu eruieren, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einer unverbindlichen Vorprüfung an. Details können Sie dem Anhang entnehmen.
Unabhängig davon weisen wir darauf hin, dass konkrete Windenergievorhaben in
Anlagenschutzbereichen bei der zuständigen Luftfahrtbehörde zur Prüfung gem. §18a LuftVG einzureichen sind.
Bei der Beurteilung des Vorhabens bezüglich der Betroffenheit von Anlagen der DFS wurden die uns zur Verfügung gestellten Unterlagen berücksichtigt. Diese Beurteilung beruht auf den Anlagenstandorten und -schutzbereichen Stand Juni 2024. Momentan beabsichtigen wir im Plangebiet keine Änderungen, diese sind jedoch aufgrund betrieblicher Anforderungen nicht auszuschließen.
Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) über unsere Stellungnahme informiert.
Hinweis: Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung stellt unter dem nachfolgenden Link eine interaktive Karte mit den aktuell gültigen Anlagenschutzbereichen verschiedener Flugsicherungsorganisationen gem. §18a LuftVG zur Verfügung.
Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufgaben der Länder gemäß § 31 LuftVG unberührt.
Zusätzliche Hinweise zur Hindernisfreiheit:
Aufgrund einer Höhe von mehr als 100,00 m über Grund ist das Einzelvorhaben von § 14 LuftVG betroffen und bedarf stets einer luftrechtlichen Zustimmung. Die konkreten Planungen sind im Rahmen des Genehmigungsverfahrens der zuständigen Landesluftfahrtbehörde vorzulegen. Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens wird gemäß § 31 Abs. 3 LuftVG die DFS durch die Luftfahrtbehörde beteiligtund zur gutachtlichen Stellungnahme aufgefordert. Die DFS prüft die Einhaltung der Hindernisfreiflächen sowie die An- und Abflugverfahren an betroffenen Flugplätzen (Flughäfen, Landeplätze, Segelfluggelände, Hubschraubersonderlandeplätze).
Auskünfte zu den Hindernisfreiflächen und zu den Anforderungen an die Hindernisfreiheit erteilt die Landesluftfahrtbehörde als Genehmigungsbehörde für die Flugplätze in ihrem Zuständigkeitsbereich.
Folgende Abstandsregelungen sind bei den Planungen bereits im jetzigen Stadium zu berücksichtigen:
- Gemeinsame Grundsätze des Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im Sichtflugbetrieb, veröffentlicht als NfL I 92/13, dort: Gefahren für den Flugplatzverkehr in der Platzrunde;
- Festlegung von Mindestabständen von Hindernissen zu festgelegten Sichtflugverfahren, veröffentlicht als NfL 1-847-16.
Behandlungsvorschlag:
Es wird auf die Behandlung der Stellungnahme in der Ferienausschusssitzung vom 20.08.2024 verwiesen. Neue Punkte wurden nicht mehr vorgetragen.
Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung hat mit Schreiben vom 18.09.2024 mitgeteilt, dass sowohl die 17. Flächennutzungsplanänderung als auch das Vorhaben „Windkraftanlage Föhrenpold im Einklang mit § 18a LuftVG steht.
Die weiteren Belange werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens behandelt.
Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung ist nicht erforderlich.
Hinweis:
Zum Zeitpunkt der Ladung (26.09.2024) lagen die Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde vom LRA Ebersberg sowie die Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding (AELF) noch nicht vor. Das AELF erhielt Fristverlängerung bis 04.10.2024.
Der Punkt ist vorberatend und wird abschließend voraussichtlich am 05.11.2024 im Stadtrat behandelt.
Aus diesem Grund ergeht die nachfolgende Gesamtbeschlussempfehlung unter dem Vorbehalt, dass aufgrund der fehlenden Stellungnahmen eine weitere Planauslegung nicht mehr erforderlich wird.
3.5 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding, Schreiben vom 30.09.2024.
Für die Beteiligung an o.g. Planungsvorhaben bedanken wir uns. Das Amt für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Ebersberg-Erding gibt eine
gemeinsame Stellungnahme der Bereiche Landwirtschaft (Frau Petra Fest-
ner) und Forsten (Frau Fischer, Herr Bachmann) ab.
Die Sachverhalte, welche in unserer Stellungnahme vom 20.06.2024 (Az.:
AELF-EE-F2-4611-37-8-5) festgehalten wurden, haben weiterhin Gültigkeit.
Ausführlichere Stellungnahmen erfolgen im Rahmen des ebenfalls vorlie-
genden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
Wir stehen für Rückfragen zur Verfügung. Bitte nutzen Sie dafür unsere
Poststelle < poststelle@aelf-ee.bayern.de >, da ansonsten eine Bearbeitung
in Abwesenheit nicht gewährleistet ist bzw. die formale und erforderliche Be-
teiligung aller hiesigen Ressorts nicht zeitgerecht erfolgen kann.
Behandlungsvorschlag:
Seitens des AELF wurden zur frühzeitigen Beteiligung keine neuen Gesichtspunkte vorgetragen. Offen blieb jedoch die Äußerung, ob der Waldbereich, in dem die WKA errichtet werden sollte, eine Sturmschutzfunktion einnimmt und daher einer Rodungserlaubnis nach Art. 10 BayWaldG nicht zugänglich ist.
Auf Nachfrage durch die Verwaltung teilte das AELF mit Schreiben vom 30.09.2024 folgendes mit:
„für die Beteiligung an o.a. Planungsverfahren bedanken wir uns und beantworten wunschgemäß noch nachträglich Ihre Frage zur „Sturmschutzfunktion“.
Dies erfolgt im Anhalt an unsere noch ausstehende Stellungnahme im Zuge des laufenden immissionsschutzrechtlichen Verfahrens, da erst in letzterem die kleinräumigen Planungsbedingungen konkret abgebildet sind.
So, wie das Windrad gemäß der übermittelten Unterlage zum Liegen kommt, ist ein kleines Stück Altbestand (ca. 20 m x 20 m) von der Fällung betroffen. Dieser homogene Fichtenbestand ist bereits aufgelockert und zeigt am Westrand nur mäßige Vitalität. Im östlichen Anschluss an den südlichsten zu entnehmendem Abschnitt, findet sich ein strukturreicher Bereich mit Buche, der den neuen Waldrand bilden und die einhergehende Schutzfunktion übernehmen kann. Weiter nach Norden befindet sich in ca. 20 Metern Bestandstiefe eine alte Rückegasse, durch die der hinterliegende Bestand bereits abgerückt ist.
Zwar ist die Entnahme der Altbestandsbäume im Westen nicht optimal und birgt somit ein nicht gänzlich auszuschließendes Restrisiko. Aufgrund der bereits vorhandenen Struktur und der Tatsache, dass der Bestand selbst geschwächt und hiebsreif ist, gehen wir aber nicht von einer Schutzwaldfunktion aus. Dies setzt jedoch voraus, dass nicht in den geschlossenen Bestandesteil östlich der bereits vorhandenen Rückegasse eingegriffen wird.“
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung ist nicht erforderlich. Die detaillierten Auflagen zum Eingriff in den Waldbestand werden auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens geklärt.
Beschlussempfehlung:
Der Stadtrat nimmt Kenntnis von der Stellungnahme des AELF. Eine Planänderung ist nicht erforderlich.
Der Technische Ausschuss hat sich der Sache in seiner Sitzung am 08.10.2024 angenommen.
Diskussionsverlauf
StR Ried spricht sich weiterhin gegen Windräder aus, denn man wisse nicht was man tue. Es würde eine bedenkliche Sache forciert mit der die Landschaft amputiert und kaputt gemacht wird.
StR Mühlfenzl stellte fest, dass keine Einsprüche aus der Bevölkerung vorliegen würden und lobte die durchgeführte Bürgerbeteiligung. Man soll den Schritt wagen; wesentliche Einschränkungen sind nicht zu erwarten.
StR Otter stimmte seinem Vorredner zu. Man habe sich die Sache nicht leicht gemacht und stets kritisch und offen diskutiert. Veränderungen sollten kritisch begleitet werden. Sie sind nur sinnvoll wenn sich daraus Verbesserungen ergeben.
StR Friedrichs fand die Windenergie richtig. Es würde das Klimaschutzkonzept der Stadt umgesetzt. Er lobte die vorbildliche Bürgerbeteiligung.
Beschluss
- Der Stadtrat nimmt von der Beteiligung der Öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB Kenntnis.
- Der Stadtrat macht sich die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung des 17. Flächennutzungsplanänderung vom 20.08.2024 zu Eigen und stimmt den erläuterten Beschlussvorschlägen zu.
- Der Stadtrat billigt die 17. Flächennutzungsplanänderung Sondergebiet Windenergie Föhrenpold mit Begründung und Umweltbericht ohne Änderungen in der Fassung vom 08.10.2024.
- Der Stadtrat fasst den Feststellungsbeschluss und beauftragt die Verwaltung, die Genehmigung für die 17. Änderung des Flächennutzungsplans einzuholen.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 22, Dagegen: 0
Dokumente
Download 17.FNPÄ Wind_Begründung_240826 (1).pdf
Download 17.FNPÄ Wind_Planzeichnung_240826 (2).pdf
Download 17.FNPÄ Wind_Umweltbericht_240826 (3).pdf
Download 17.FNPÄ Wind_Umweltbericht_Anhang_240826 (4).pdf
zum Seitenanfang
8. 19. Änderung des Flächennutzungsplanes-Bereich westlich der Hohenlindener Straße, östlich der Schwabener Straße;
Behandlung der Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB);
Empfehlung des Feststellungsbeschlusses
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
05.11.2024
|
ö
|
beschließend
|
8 |
Sachverhalt
A. Vorgeschichte:
Der Stadtrat der Stadt Ebersberg fasst am 19.03.2024 den Einleitungsbeschluss für die 19. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich westlich der Hohenlindener Straße.
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung sowie die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 22.04.2024 bis 23.05.2024.
Die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 BauGB wurde vom 29.07.2024 bis 02.09.2024 durchgeführt.
B. Stellungnahmen:
1. Keine Rückmeldung haben abgegeben.
1.1 Landratsamt Ebersberg, Bauleitplanung
1.2 Landratsamt Ebersberg, Wasserrecht
1.3 Landratsamt Ebersberg, Untere Immissionsschutzbehörde
1.4 Landratsamt Ebersberg, Gesundheitsamt
1.5 Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
1.6 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
1.7 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
1.8 Brandschutzdienststelle Ebersberg
1.9 Polizeiinspektion Ebersberg
1.10 Kreisjugendring
1.11 Evang.-Luther. Pfarramt
1.12 Katholisches Pfarramt
1.13 Deutsche Telekom AG
1.14 Energienetze Bayern GmbH & Co.KG
1.15 Stadt Grafing
1.16 Markt Kirchseeon
1.17 Gemeinde Forstinning
1.18 Gemeinde Anzing
1.19 Gemeinde Frauenneuharting
1.20 Bund Naturschutz Ebersberg
1.21 Landesbund für Vogelschutz, Markt Schwaben
1.22 Stadt Ebersberg, Ausgleichsflächen, Abfallwirtschaft
1.23 Stadt Ebersberg, Klimamanager
1.24 Stadt Ebersberg, Tiefbauamt
1.25 Staatliches Bauamt Rosenheim
2. Keine Einwände / Bedenken haben vorgetragen:
2.1 Regierung von Oberbayern, Schreiben vom 05.08.2024
2.2 Regionaler Planungsverband, Schreiben vom 08.08.2024
2.3 Landratsamt Ebersberg, staatl. Abfallrecht, Altlasten, Schreiben vom29.07.2024
2.4 Erzbischöfliches Ordinariat München, Schreiben vom 31.07.2024
2.5 Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Schreiben vom 28.08.2024
2.6 Gemeinde Hohenlinden, Schreiben vom 07.08.2024
2.7 Gemeinde Steinhöring, Schreiben vom 19.04.2024
3. Es wurden keine Stellungnahmen mit Anregungen oder Bedenken vorgetragen
3.1 Landratsamt Ebersberg, Untere Naturschutzbehörde, Schreiben vom 26.08.2024
3.2 Bayernwerk Netzcenter Ampfing, Schreiben vom 22.04.2024
3.1 Landratsamt Ebersberg, Untere Naturschutzbehörde, Schreiben vom 26.08.2024
Vortrag:
die verbale Beschreibung der Ausgleichsfläche B (Textliche Festsetzungen 4.11 & Umweltbericht S. 29) enthält irrtümlicherweise einen Teil der Maßnahmenbeschreibung von Ausgleichsfläche A („Erhaltungspflege nach erfolgreicher Entwicklung“, „Stehenlassen über Winter als Überwinterungsquartier f. Insekten, 1 Reinigungsschnitt im Frühjahr“). Um Missverständnissen vorzubeugen empfehlen wir eine Korrektur.
Darüber hinaus bestehen zur Aufstellung des Bebauungsplans i. d. Fassung vom 09.07.2024 mit Änderung des Flächennutzungsplans mit Parallelverfahren keine Einwände oder Bedenken.
Behandlungsvorschlag:
Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen.
Die Stellungnahme bezieht sich nicht auf den Darstellungsinhalt des Flächennutzungsplans, sondern sich nur auf das Bebauungsplanverfahren. Für die Flächennutzungsplanänderung werden keine Anregungen vorgetragen.
Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung des Flächennutzungsplans Bebauungsplans ist nicht veranlasst.
3.2 Bayernwerk Netz GmbH, Schreiben vom 22.04.2024
Vorbemerkung:
Es wurde ohne weiteren Kommentar das Schreiben vom 22.04.2024, das im Rahmen der
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB bereits vorgelegt wurde, nochmals vorgetragen. Auf die bereits erfolgte Behandlung und Abwägung (TA: 09.07.2024 / SR: 23.07.2024) wird hingewiesen:
Vortrag:
gegen das o. g. Planungsvorhaben bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen,
wenn dadurch der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht beeinträchtigt werden.
In dem von Ihnen überplanten Bereich befinden sich von uns betriebene Versorgungseinrichtungen.
Kabel
Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links
zur Trassenachse. Wir weisen darauf hin, dass die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen von Bepflanzung freizuhalten sind, da sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeit eingeschränkt werden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus Gründen des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit uns geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen.
Auskünfte zur Lage der von uns betriebenen Versorgungsanlagen können Sie online
über unser Planauskunftsportal einholen. Das Portal erreichen Sie unter:
www.bayernwerk-netz.de/de/energie-service/kundenservice/planauskunftsportal.html
Wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren und stehen Ihnen für Rückfragen
jederzeit gerne zur Verfügung. Wir bitten Sie, uns bei weiteren Verfahrensschritten zu
beteiligen.
Behandlungsvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme bezieht sich nicht auf den Darstellungsinhalt des Flächennutzungsplans, sondern nur auf den Regelungsinhalt des Bebauungsplans Nr. 211.Änderung oder Ergänzungen des Flächennutzungsplans sind nicht erforderlich.
Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung des Flächennutzungsplans ist nicht veranlasst.
Von Seiten der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen.
Der Technische Ausschuss hat sich der Sache in seiner Sitzung am 08.10.2024 angenommen.
Beschlussvorschlag - Stadtrat:
Der Stadtrat nimmt von der Beteiligung der Öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB Kenntnis. Der Stadtrat macht sich die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung des Bebauungsplanentwurfs vom 09.07.2024 zu Eigen und stimmt den erläuterten Beschlussvorschlägen zu.
Der Stadtrat billigt die 19. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich westlich der Hohenlindener Straße mit Begründung und Umweltbericht ohne Änderungen in der Fassung vom 08.10.2024.
Der Stadtrat fasst den Feststellungsbeschluss und beauftragt die Verwaltung, die Genehmigung für die 19. Änderung des Flächennutzungsplans einzuholen.
Beschluss
- Der Stadtrat nimmt von der Beteiligung der Öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB Kenntnis.
- Der Stadtrat macht sich die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung des Bebauungsplanentwurfs vom 09.07.2024 zu Eigen und stimmt den erläuterten Beschlussvorschlägen zu.
- Der Stadtrat billigt die 19. Flächennutzungsplanänderung für den Bereich westlich der Hohenlindener Straße mit Begründung und Umweltbericht ohne Änderungen in der Fassung vom 08.10.2024.
- Der Stadtrat fasst den Feststellungsbeschluss und beauftragt die Verwaltung, die Genehmigung für die 19. Änderung des Flächennutzungsplans einzuholen.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 22, Dagegen: 0
Dokumente
Download FNP_19.Änderung_BEGRÜNDUNG-240709 Auslegung.pdf
Download FNP_19.Änderung_ENTWURF_240709-Auslegung.pdf
zum Seitenanfang
9. Verordnung über die verkaufsoffenen Sonntage im Jahr 2025
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Finanzen, Wirtschaft und Digitales
|
Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Digitales
|
15.10.2024
|
ö
|
vorberatend
|
6 |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
05.11.2024
|
ö
|
beschließend
|
9 |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
17.12.2024
|
ö
|
beschließend
|
13 |
Sachverhalt
Gemeinsam mit dem Bund der Selbstständigen (BdS), dem Vertreter des Einkaufszentrums e-EinZ und dem Marktorganisator der Stadt sind die Markttermine und die von den Gewerbebetrieben gewünschten verkaufsoffenen Sonntage besprochen worden.
Der Frühjahrsmarkt soll im Jahr 2025 am 06.04., der Herbstmarkt am 03.10. (auch Tag der Deutschen Einheit, aber ohne verkaufsoffenen Tag) stattfinden.
Am Tag der Ehrenamtlichen am 05.10. ist ein verkaufsoffener Sonntag vorgesehen.
Der Christkindlmarkt soll im Jahr 2025 am Wochenende des 1. Advent, also am 29.11. und am 30.11., durchgeführt werden.
Für die Sonntage 06.04., 05.10. und 30.11.2025 wird je ein verkaufsoffener Sonntag beantragt, so dass Verkaufsstellen in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein dürfen.
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Digitales hat sich der Sache in seiner Sitzung am 15.10.2024 und die verkaufsoffenen Sonntage wie vorgeschlagen empfohlen.
Diskussionsverlauf
Stadtrat Riedl regt an, die Märkte im Sinne der Bewahrung von Tradition wieder Ulrichsmarkt und Martinimarkt zu nennen.
Beschluss
Der Stadtrat beschließt, wie vom Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Digitales empfohlen, an den Sonntagen 06.04., am 05.10. und 30.11.2025 je einen verkaufsoffenen Sonntag zuzulassen. Die entsprechende Verordnung wäre dann auszufertigen und bekannt zu machen.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 22, Dagegen: 0
zum Seitenanfang
10. Antrag der Frauenunion Ortsverband Ebersberg auf Aufstellung einer weiteren Beerdigungsmöglichkeit in Ebersberg
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
05.11.2024
|
ö
|
beschließend
|
10 |
Sachverhalt
Der Antrag der Frauenunion Ortsverband Ebersberg auf Aufstellung einer weiteren Beerdigungsmöglichkeit in Ebersberg wird von Stadträtin Matjanovski vorgetragen.
Diskussionsverlauf
Stadtrat Riedl berichtet über die Vorgehensweise der Stadt Amberg.
Beschluss
Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, den Sachverhalt wie beantragt zu prüfen und diese dem zuständigen Fachausschuss zur Beratung vorzulegen.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 22, Dagegen: 0
Dokumente
Download Antrag auf die Schaffung von zusätzlichen Beerdigungsmöglichkeiten.pdf
zum Seitenanfang
11. Ausfallbürgschaft Gautrachtenfest 2027
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
05.11.2024
|
ö
|
beschließend
|
11 |
Sachverhalt
Der Trachtenverein Ebersberg hat sich um die Ausrichtung des Gautrachtenfestes 2027 in Ebersberg beworben. Damit dieses Fest in Ebersberg ausgerichtet werden kann und die Veranstalter Planungssicherheit haben, ist seitens der Stadt bereits jetzt die Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 30.000 Euro nötig.
Beschluss
Der Stadtrat stimmt der Übernahme der Ausfallbürgschaft für das Gautrachtenfest 2027 in Höhe von 30.000,00 EUR zu, sollte Ebersberg als Austragungsort auserwählt werden.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 22, Dagegen: 0
zum Seitenanfang
12. Verschiedenes
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
05.11.2024
|
ö
|
informativ
|
12 |
Sachverhalt
Es gibt keine Mitteilungen.
zum Seitenanfang
13. Wünsche und Anfragen
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
05.11.2024
|
ö
|
informativ
|
13 |
Sachverhalt
- Stadträtin Matjanovski weist darauf hin, dass eine Kinderbetreuung durchaus auch in aufgestellten Containern stattfinden kann, das würde beim Waldkindergarten mit einem Bauwagen auch gut funktionieren.
- Stadtrat Riedl bietet an, eine Spendenaktion für eine holzgesicherte Unterführung in der Lehrer-Schwab-Gasse durchzuführen. Er hätte eine Kostenschätzung von der Zimmerei Fritsch über etwa 4.000 € vorliegen.
- Stadtrat Gressierer bittet um eine schriftliche Stellungnahme, warum die im Jahr 2021 beauftragte Organisationsuntersuchung für die Stadtverwaltung noch nicht vorliegt.
Datenstand vom 11.11.2024 07:38 Uhr