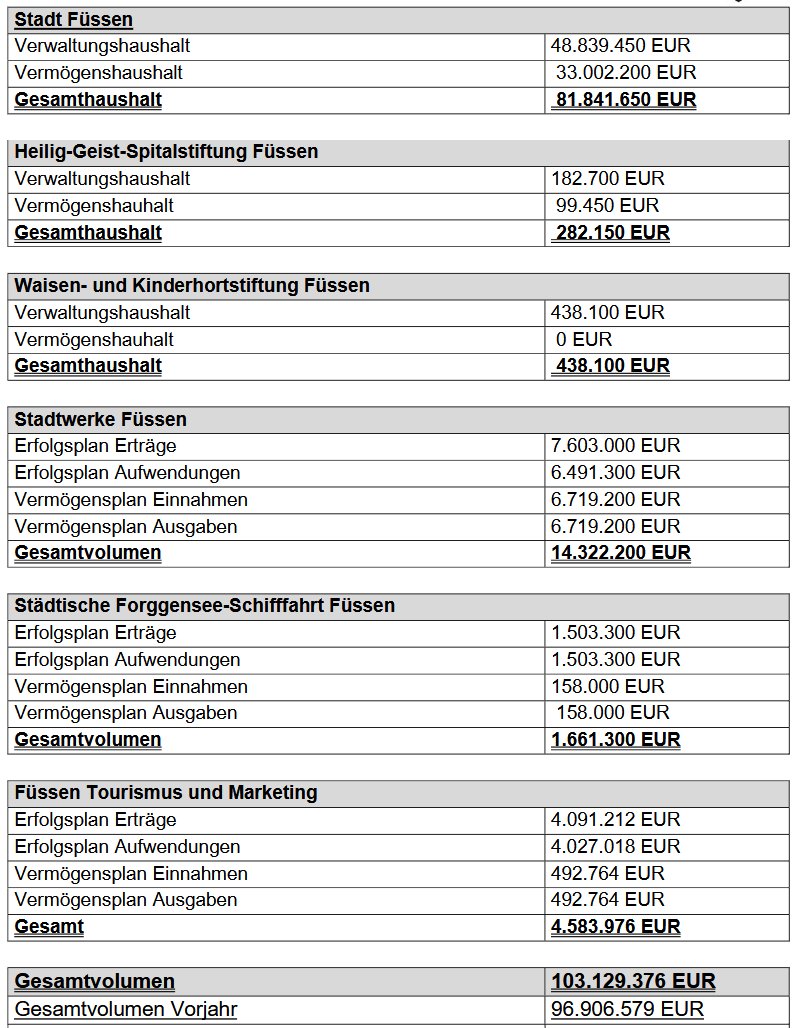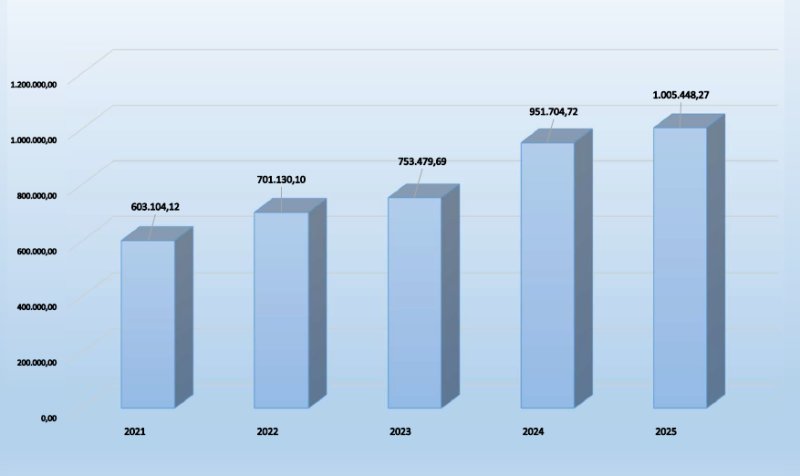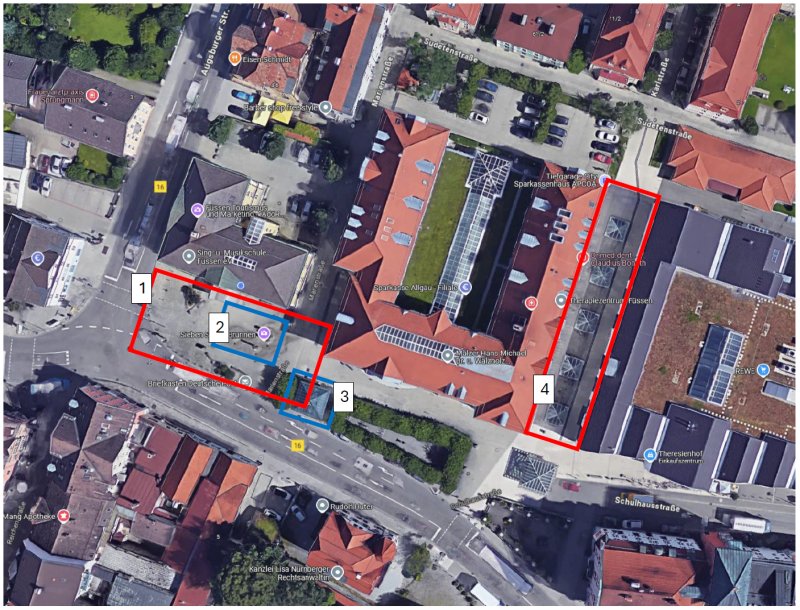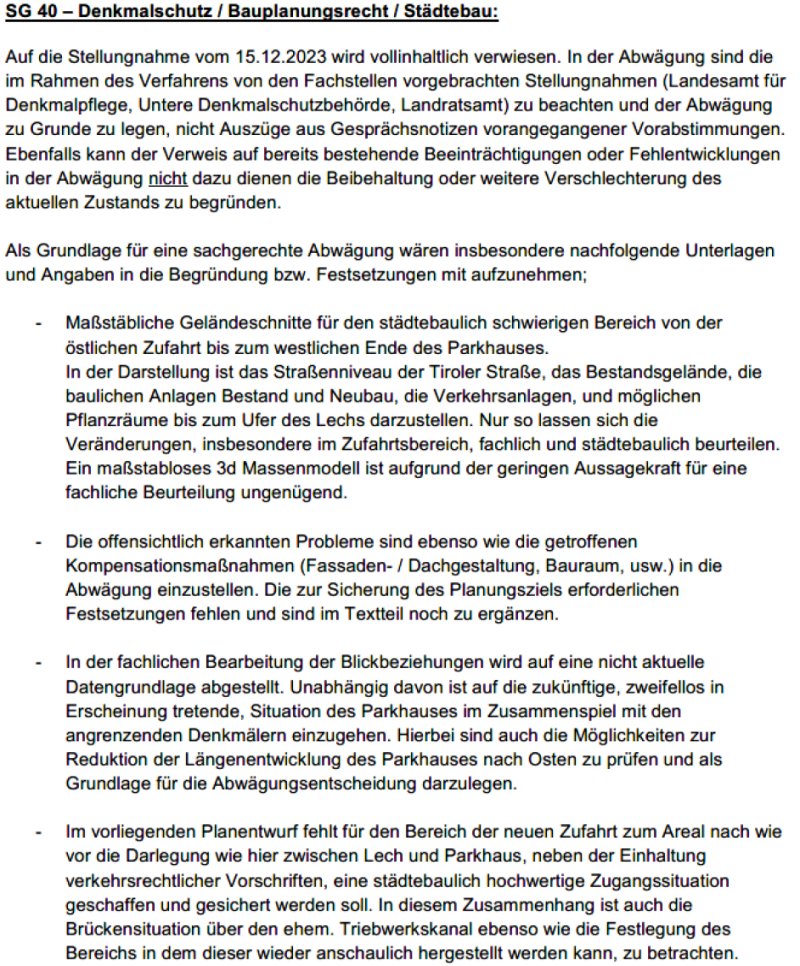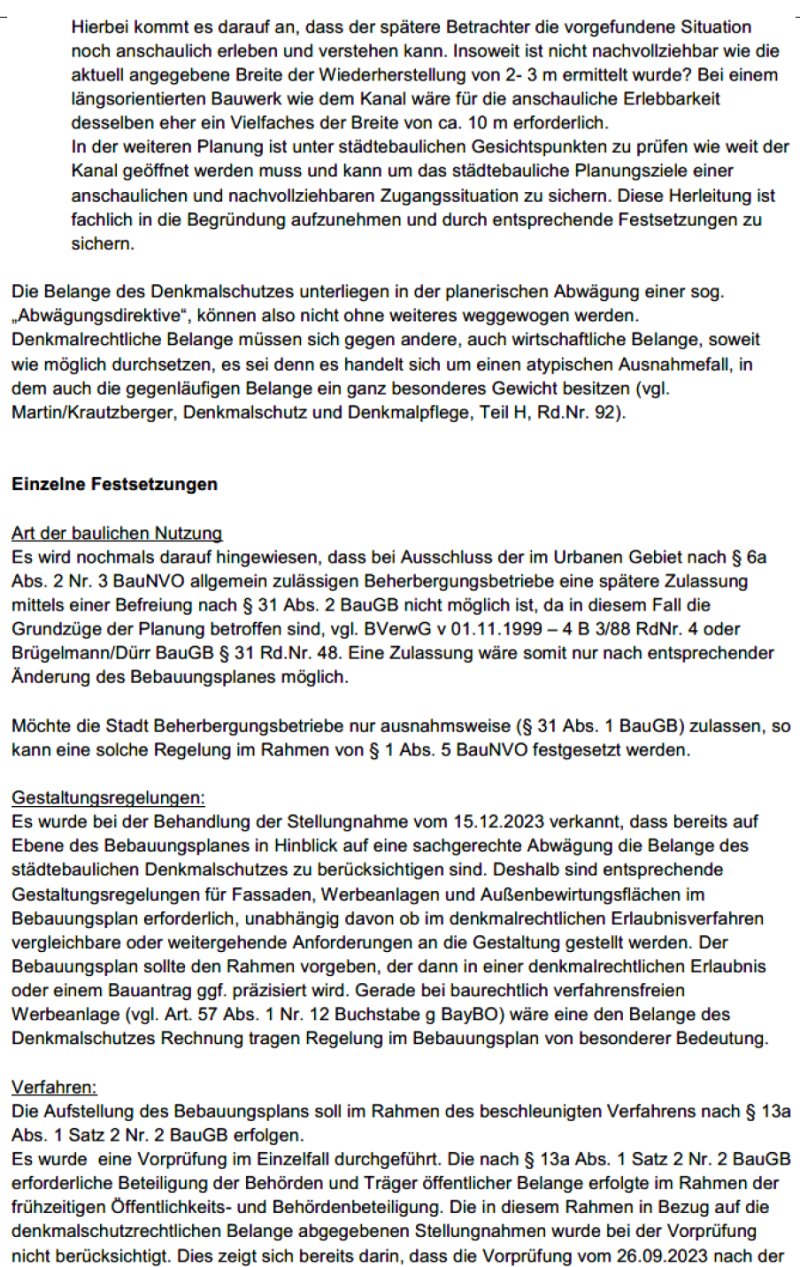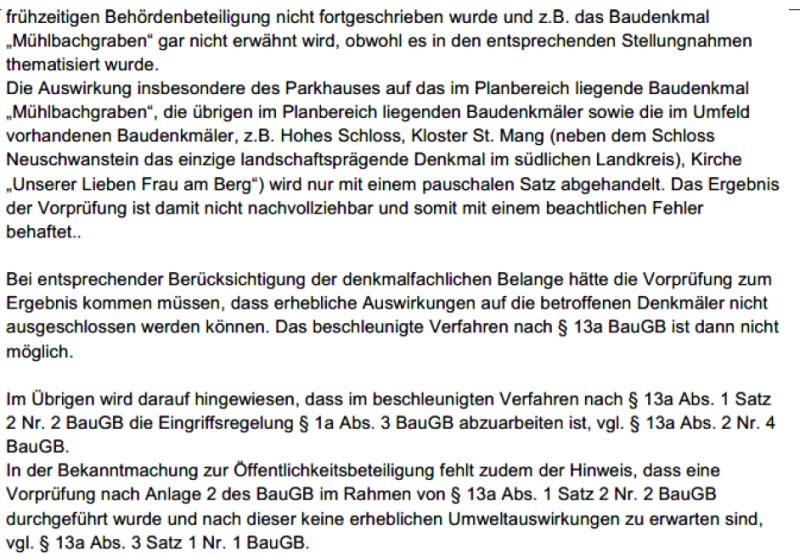Datum: 28.01.2025
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Großer Sitzungssaal des Rathauses Füssen
Gremium: Stadtrat
Öffentliche Sitzung, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Nichtöffentliche Sitzung, 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Öffentliche Sitzung
Sitzungsdokumente öffentlich
Download Niederschrift öffentlich.pdf
zum Seitenanfang
1. Bürgerfragestunde
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
28.01.2025
|
ö
|
Bekanntgabe
|
1 |
Sachverhalt
Herr Vauk sieht bundesweit die Vertrauenspolitik in Gefahr in Bezug auf KI, Algorithmen und weiterer Einflüsse und möchte wissen, wie die Stadt Füssen dem entgegentritt.
Herr Eichstetter betont, dass dies eine weitläufige Frage sei und nicht in kurzen Worten zu beantworten ist. Er appelliert aber an alle Bürgerinnen und Bürger das Wahlrecht auch auszuüben. Wählen ist ein wichtiger Part der Demokratie. Die Stadt Füssen ist den Bürgern gegenüber sehr transparent und steht durch die App´s wie z. B. Meldoo im ständigen Austausch mit den Bürgern. Zudem bietet die Stadt Bürgerworkshops zu bestimmten Themen an und die Mitglieder des Stadtrats stehen im ständigen Austausch mit den Einwohnern.
zum Seitenanfang
2. Bekanntgaben
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
28.01.2025
|
ö
|
beschliessend
|
2 |
zum Seitenanfang
2.1. Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
28.01.2025
|
ö
|
|
2.1 |
Sachverhalt
Der Stadtrat hat in seiner letzten nichtöffentlichen Sitzung am 17.12.2024 bei folgendem nichtöffentlichen Beschluss den Wegfall der Geheimhaltung beschlossen (Art. 52 Abs. 3 GO):
Vollzug des Personenstandsgesetzes (PStG) und der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (AVPStG); Bestellung von Frau Tanja Hofmann zur Standesbeamtin im Standesamt Füssen (Standesamtsbezirk Füssen, Schwangau, Lechbruck am See)
Beschluss:
Der Stadtrat bestellt Frau Tanja Hofmann ab dem 1. Januar 2025 auf Widerruf zur Standesbeamtin.
zum Seitenanfang
2.2. Hinweise zur Änderung des BayVwVfG, des VwZVG und des BayDiG
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
28.01.2025
|
ö
|
beschliessend
|
2.2 |
Sachverhalt
Am 1. Januar 2025 ist das Gesetz zur Änderung des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften vom 23. Dezember 2024
(GVBl. S. 599) in Kraft getreten. Das Gesetz enthält verschiedene Änderungen des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG), des Bayerischen Verwaltungszustellungs-und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) sowie des Bayerischen Digitalgesetzes (BayDiG). Darüber hinaus trat zum 17. Dezember 2024 das Gesetz zur Erleichterung des Ehrenamtes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 570) in Kraft, mit dem u. a. das BayVwVfG geändert worden ist (vgl. hierzu die amtliche Begründung des Gesetzentwurfs der Staatsregierung, LT-Drs. 19/3022).
Das beiliegende Schreiben des Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration vom 30.12.2024 enthält hierzu entsprechende Hinweise. Zu beachten sind insbesondere die verlängerten Laufzeitvorgaben für die Post, die aufgrund des Postrechtsmodernisierungsgesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236; Berichtigung vom 23. Oktober 2024, BGBl. 2024 I Nr. 331) angepasst werden mussten. Danach gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt, der im Inland durch die Post übermittelt wird, nun erst am vierten Tag nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben und nicht mehr am dritten Tag.
Dokumente
Download IMS-BayVwVfG u.a.-301224-R.pdf
zum Seitenanfang
2.3. Jahresbericht zur Wirtschaftsförderung Füssen 2024
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
28.01.2025
|
ö
|
beschliessend
|
2.3 |
Sachverhalt
Jahresbericht zur Wirtschaftsförderung Füssen:
Bei uns ist Wirtschaftsförderung eine Gemeinschaftsaufgabe und nicht nur Chefsache. Wir bieten ein wirtschaftsfreundliches Klima als Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Auch verfügen wir über sehr gute Breitbandanbindung im gesamten Stadtgebiet. Die Stadt Füssen hat knapp 16.300 Bürger, mit den angrenzenden und umliegenden Gemeinden haben wir ein direktes Einzugsgebiet von knapp 50.000 Bürgerinnen und Bürgern.
Wie bereits erwähnt, ist die Wirtschaftsförderung in Füssen ist keine „One-Man-Show“ sondern findet gemeinsam mit verschiedenen Ämtern und externen Partnern statt, dazu in Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung Ostallgäu. Hierzu finden diverse Abstimmungen und Termine statt. Der Fachbereich (Z3) Wirtschaftsförderung Ostallgäu sitzt im Landratsamt Ostallgäu und nimmt die Termine in den jeweiligen Gemeinden vor Ort wahr.
Diese Wirtschaftsförderung ist im Landkreis eingerichtet, da sich Kommunen selbst solche zusätzlichen Fachstellen nicht leisten können und eine Auslastung nur über mehrere Gemeinden stattfinden kann.
Folgende Maßnahmen hat die Stadtverwaltung „Wirtschaftsförderung“ im Jahr 2024 umgesetzt, mit ergänzender Unterstützung der Wirtschaftsförderung OAL:
Unternehmen/Bestandspflege:
- Diverse Betriebsbesuche/Unternehmergespräche mit & ohne WiFö Ostallgäu geführt
6 Betriebseröffnungen begleitet
28 Unternehmensbefragungen durchgeführt und Maßnahmen abgeleitet. (2021: 42; 2020: 60)
Diverse Unternehmergespräche mit Betriebserweiterungen geführt und mit der Planung im Bauamt Füssen unterstützt
Datenpflege IHK-Standortportal bzgl. Gewerbeflächen
Organisation der Platzierung von Gewerbeimmobilien auf IHK-Standortportal
Regelmäßig Vermittlung/Weiterleitung und interner Aufarbeitung von SO-Anfragen (z.B. Invest-in-Bavaria, IHK-Schwaben, Direktanfragen)
Überregionales Standortmarketing für das neue Gewerbegebiet W80 durchgeführt
Direkte Grundstücksvermittlungen durch Kontaktvermittlung Eigentümer (z.B.
Moosangerweg, Kemptener Str., usw…)
- Seit 2024 Gründerstammtisch OAL-KF im Café Werksgeplauder (1xp.a.)
- WiFö OAL bietet monatliches Beratungsangebot für alle Gründer/Jungunternehmer (kostenlos)
- WiFö Füssen (BGM, FTM, Bauamt) steht Investoren/Projektentwicklern beratend zur Seite, diverse Entwicklungstermine auch im Jahr 2024
- Zusätzlich steht WiFö OAL allen Füssener Betrieben für Erstberatungen zur Verfügung
- Innenstadtsortiment – Datenpflege im Jahr 2024 aktualisiert und in RIWA GIS eingepflegt (147 Betriebe)
- KWIS.net: Umfangreiche Datenbank mit zahlreichen Datensätzen Füssener Betriebe und
Institutionen zur Abwicklung einer professionellen Bestandspflege
Unternehmernetzwerk:
- Teilnahme an Netzwerktreffen/Businessfrühstück „Gemeinsam-Wir“, Werbegemeinschaft
- Teilnahme an Ausbildungsmesse Mittelschule (Netzwerktreffen)
- Teilnahme an Azubi-Ehrungsveranstaltung in Kaufbeuren mit Unternehmen aus Füssen (Netzwerk/Austausch)
- Teilnahme an Füssener Gesellenzeugnisübergabe Handwerk in Kaufbeuren (Netzwerk/Austausch)
- Teilnahme an Ehrungsabenden in Reutte, inkl. Füssener Unternehmen (Netzwerk/Austausch)
- Marketingausschuss mit FTM, Stadt und Unternehmern
- Workshop zu nachhaltiger und gemeinwohlorientierter Tourismusentwicklung am 25. April 2024
- Jährlich finden in Kooperation mit Kaufbeuren 1-2 Unternehmerabende statt bei dem auch Füssener Unternehmen eingeladen werden und teilnehmen.
- Vereine können sich seit 2024 bei der Neubürgerveranstaltung kostenfrei platzieren und vorstellen.
- Intensive Bürgerbeteiligung zur Strategie Demografiefeste Kommune mit diversen Workshops
- Die Allgäu GmbH & Wirtschaftsförderung OAL platzieren in den gemeinsamen Beiräten und Arbeitsgruppen im Allgäu alle aktuellen Wirtschaftsthemen auch aus Füssen.
- Carsharing Angebot mit Platzierung lokaler Unternehmer auf dem Fahrzeug
Wirtschaftsbeirat Ostallgäu:
- Bürgermeister Eichstetter, sowie ein Füssener Unternehmer sind Teil des Ostallgäuer Wirtschaftsbeirat.
- WB erarbeitet Zukunftsvision 2036 ist Strategiepapier für gesamten Landkreis inkl. Füssen
- Zu den Dialogempfängen 1-2 wurden Bgm. und alle Stadträte/innen eingeladen
- Folgeprojekt „Ostallgäuer Kommunaldialog“ (10.3.25)
- Zu dem Dialogempfang 3 wurden bereits Füssener Betriebe eingeladen
Innenstadt/Kernstadt:
Im Winter 2024 wurde eine Aktualisierung der Bestandsaufnahme aller Unternehmen in der Kernstadt/Innenstadt vorgenommen.
Es befinden sich rund 150 Betriebe in der Kernstadt/Innenstadt, diese wie folgt aufgeteilt sind:
|
Bezeichnung
|
Anzahl
|
In %
|
|
Leerstand
|
6
|
3,90%
|
|
Bekleidung
|
32
|
20,78%
|
|
Schmuck, Souvenirs, Accessoires
|
14
|
9,09%
|
|
Dienstleister
|
14
|
9,09%
|
|
Einzelhändler
|
27
|
17,53%
|
|
Gastronomie
|
47
|
30,52%
|
|
Bank
|
1
|
0,65%
|
|
Hotel, gewerbliche Ferienwohnungen
|
13
|
8,44%
|
|
|
154
|
100,00%
|
Derzeit ist das Konsumverhalten im Einzelhandel sehr zurückhaltend und wir können nur daran appellieren, weniger Online einzukaufen und wieder in den Einzelhandel zu gehen.
Was steht für 2025/2026 an:
- Diverse Betriebsbesuche/Unternehmergespräche mit & ohne WiFö Ostallgäu geführt
- Beratende Begleitung von (aktuell 6) Betriebserweiterungen
- Beratende Begleitung von (aktuell 3) Betriebsneuentwicklungen/Bauvorhaben
- Dialogempfang Ostallgäu
- Ostallgäuer Kommunaldialog Wirtschaft (10.03.2025)
- Weiterentwicklung „Zukunftsvision 2036“ im OAL und Füssen
- Vorbereitung für Magazin „mach Füssen 2026“ – Wirtschaftsmagazin Füssen
Fazit Wirtschaftsförderung Füssen 2024:
Es war wieder ein ereignisreiches Jahr im Bereich der Wirtschaftsförderung Füssen. Gemeinsam haben wir viel erreicht und einige Unternehmen in der Entwicklung unterstützen können.
Die aktuelle Bundespolitische Lage ist für all unsere Unternehmen eine große Herausforderung. Unsere Unternehmen benötigen Stabilität, Verlässlichkeit und zukunftsweisende Entscheidungen, die dann auch zuverlässig umgesetzt werden.
Umso mehr sind unsere Unternehmen, Einzelhändler und Dienstleister darauf angewiesen, dass wir, die Füssener Bürgerinnen und Bürger vor Ort einkaufen und Dienstleistungen beziehen.
Das beginnt damit, den Online-Handel so weit wie möglich zu unterlassen und regional im Geschäft vor Ort einzukaufen.
Beschlussvorschlag
Bekanntgabe.
zum Seitenanfang
2.4. Neubau Kita St. Gabriel - Baustelleneinrichtung
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
28.01.2025
|
ö
|
Bekanntgabe
|
2.4 |
Dokumente
Download KITA St. Gabrie_Baustelleneinrichtung.pdf
zum Seitenanfang
2.5. Sammelpetition Ausweichverkehr entlang der Bundesautobahn 7
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
28.01.2025
|
ö
|
beschliessend
|
2.5 |
Sachverhalt
Im Zusammenhang mit den Blockabfertigungen und dem Ausweichverkehr A7 und den daraus resultierenden Konsequenzen für alle Anrainerkommunen, haben die vier Bürgermeister der Gemeinden Pfronten, Nesselwang, Oy-Mittelberg und Füssen eine Sammelpetition eingereicht.
Mit Schreiben vom 20.01.2025 hat Bürgermeister Eichstetter Herrn Staatsminister Eric Beißwenger darüber hinaus um Koordination eines grenzüberschreitenden Termins gebeten.
Ein Termin zwischen den Behörden/Bürgermeistern aus dem Ostallgäu und den Kollegen aus dem angrenzenden Österreich wäre von großer Bedeutung, um eine koordinierte Lösung zu finden, die sowohl auf der deutschen als auch auf der österreichischen Seite funktioniert.
Die Stadt Füssen wird in Kürze ein Gespräch mit dem Staatlichen Bauamt und der Polizei Füssen führen, um die Details zu besprechen und eine Strategie zur Umsetzung der Sperrung von Innenstadtstraßen an den Wochenenden zu entwickeln.
Ein gemeinsamer Termin mit Herrn Staatsminister Beißwenger und den österreichischen Kollegen würde uns helfen, alle relevanten Aspekte grenzüberschreitend abzustimmen.
Dokumente
Download Petition Ausweichverkehr entlang der Bundesautobahn 7.pdf
zum Seitenanfang
3. Aktueller Sachstand zur Haushaltsgenehmigung & Anpassung Beschluss: Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Stadt Füssen und der von ihr verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2025 sowie Finanzplanung für die Jahre 2026 - 2028
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Haupt-, Finanz-, Sozial- und Kulturausschusses
|
Sitzung des Haupt-, Finanz-, Sozial- und Kulturausschusses
|
19.11.2024
|
ö
|
beschliessend
|
2 |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
17.12.2024
|
ö
|
beschliessend
|
13.1 |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
17.12.2024
|
ö
|
beschliessend
|
13.2 |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
28.01.2025
|
ö
|
beschliessend
|
3 |
Sachverhalt
Aktueller Sachstand zur Haushaltsgenehmigung:
Das Genehmigungsverfahren für den Haushalt sieht momentan sehr positiv aus, und wir können optimistisch sein, dass eine Genehmigung voraussichtlich Anfang Februar erteilt wird.
Allerdings hat sich herausgestellt, dass wir die Verpflichtungsermächtigung aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 100.000 € formell streichen müssen.
§ 3 der Satzung ist entsprechend zu ändern.
Im Vorbericht des Haushalts 2025 wurde die Änderung ebenfalls berücksichtigt.
Die geänderte Satzung, der geänderte Vorbericht sowie die Haushaltsunterlagen sind der Rechtsaufsichtsbehörde (LRA) zu übermitteln.
Dies bedeutet, dass ein erneuter Beschluss des Stadtrats erforderlich ist, da der bisherige Beschluss leider nicht ausreicht, um die Änderung ohne diese formale Anpassung vorzunehmen.
Die angepassten Haushaltsunterlagen befinden sich vollständig im Anhang.
Wir halten Sie weiterhin über die Entwicklungen auf dem Laufenden und danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
Beschlussvorschlag
Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt nochmals die Haushaltssatzung, den Vorbericht sowie die Haushaltspläne der Stadt Füssen und der von ihr verwalteten Stiftungen (Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen und Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen) für das Haushaltsjahr 2025 als Satzungen mit den angepassten Verpflichtungsermächtigungen.
Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt die vorgelegte Finanzplanung der Stadt Füssen und der von ihr verwalteten Stiftungen (Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen und Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen) für die Jahre 2026 – 2028 als Grundlage für die Finanzwirtschaft.
Die Verwaltung wird ermächtigt Unstimmigkeiten im Wortlaut oder bei Zahlen zu bereinigen und sonstige Mängel im Endausdruck des Haushaltsplans zu beseitigen sowie ggf. redaktionelle Änderungen und Anpassungen vorzunehmen.
Diskussionsverlauf
Stadtrat Waldmann ist nicht schlüssig warum im Areal Füssen-Nord (welches zum Thema Haushaltsgenehmigung ebenfalls Bestandteil ist) kein Wohnbau betrieben wird.
Es gab einige Gründe für die Zurückweisung des Baugebietes. Die Regierung von Schwaben forderte ein Grünflächenkataster. Die Infrastruktur müsste in Füssen in allen Bereichen erweitert werden. Tourismusentwicklungskonzepte und Statistiken erstellt werden. Außerdem hatte ein Immissionsgutachten ergeben, dass hier kein Wohngebiet möglich wäre. Der Flugbetrieb in diesem Bereich war ein weiteres Argument gegen eine Erschließung, erläuterte der Rathauschef.
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt nochmals die Haushaltssatzung, den Vorbericht sowie die Haushaltspläne der Stadt Füssen und der von ihr verwalteten Stiftungen (Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen und Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen) für das Haushaltsjahr 2025 als Satzungen mit den angepassten Verpflichtungsermächtigungen.
Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt die vorgelegte Finanzplanung der Stadt Füssen und der von ihr verwalteten Stiftungen (Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen und Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen) für die Jahre 2026 – 2028 als Grundlage für die Finanzwirtschaft.
Die Verwaltung wird ermächtigt Unstimmigkeiten im Wortlaut oder bei Zahlen zu bereinigen und sonstige Mängel im Endausdruck des Haushaltsplans zu beseitigen sowie ggf. redaktionelle Änderungen und Anpassungen vorzunehmen.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 1
zum Seitenanfang
4. Haushaltskonsolidierungskonzept 2025 - 3. Fortschreibung
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
28.01.2025
|
ö
|
beschliessend
|
4 |
Sachverhalt
Die Stadt Füssen stellte erstmalig am 14.04.2022 den Antrag auf die Gewährung von Bedarfszuweisungen nach Art. 11 BayFAG.
Aufgrund des Haushaltskonsolidierungskonzept und den deutlichen Willen der Konsolidierung, hat die Stadt Füssen auch Stabilisierungshilfen zugewiesen bekommen. Nun folgt die 3. Fortschreibung zum Haushaltskonsolidierungskonzept.
2022 = 2,0 Millionen Euro
2023 = 5,3 Millionen Euro
2024 = 4,0 Millionen Euro
11,3 Millionen Euro
Diese 11,3 Millionen Euro konnten „Alt-Darlehen“ ablösen, welche jeweils neu hätten verlängert werden müssen. Der kommunale Zinssatz für die letzten 24 Monate lag im Durchschnitt bei 3,5-4,0% für weitere 10 Jahre. Somit verfügen wir über eine Zinseinsparung und Entlastung des Haushaltes von weiteren rund 4.5 Millionen Euro.
Gesamtentlastung für den Haushalt auf 10 Jahre somit bei 15,8 Millionen Euro.
Um weiterhin die Auflagen zu erfüllen, wurde die 3. Fortschreibung 2025 erstellt und muss nun bei der Kommunalaufsicht des LK OAL, der Regierung von Schwaben und dem Finanzministerium Bayern eingereicht werden.
Es folgt eine Kurzzusammenfassung mit den wichtigsten Eckpunkten, den Auflagen zur Stabilisierungshilfe und den entsprechenden Stellungnahmen zu den Auflagen.
Jahresausblick 2025
Die Haushaltsberatungen für die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe erfolgten vorberatend im
Werkausschuss am 20. November 2024 sowie abschließend im Stadtrat am 17. Dezember
2024.
Die Haushaltspläne der Stadt Füssen und der von ihr verwalteten Stiftungen wurden 3-mal
beraten, am 24. September 2024 im Stadtrat, sowie am 19. November 2024 im Haupt-, Finanz-
, Sozial- und Kulturausschuss und in der Sitzung des Stadtrats vom 17. Dezember 2024.
Anschließend erfolgte die Verabschiedung des Haushalts.
Die Gesamtpläne der Stadt Füssen und der von ihren verwalteten Stiftungen bzw. die
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und des Kommunalunternehmens betragen im Einzelnen:
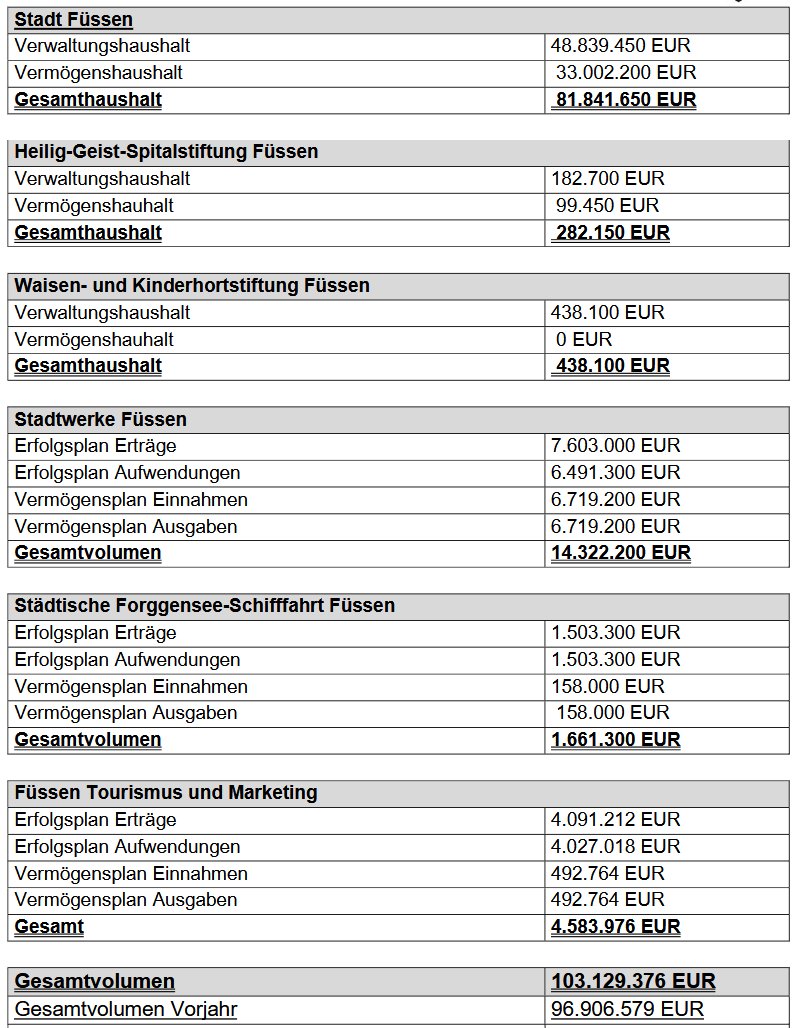
Der am 17.12.2024 im Stadtrat beschlossene Haushalt wurde umgehend der Rechtaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Das Gesamthaushaltsvolumen der Stadt Füssen liegt bei 81.841.650 Euro (Vorjahr 80.794.000 Euro). Der Verwaltungshaushalt liegt mit 48.839.450 Euro um ca. 2,3 Millionen Euro über dem Wert des Jahres 2024 (46.526.700 Euro). Der Vermögenshaushalt schließt mit 33.002.200 Euro ca. 1,3 Millionen Euro geringer als im Vorjahr (34.267.300 Euro). Der Haushalt 2025 steht weiter unter dem Zeichen der Haushaltskonsolidierung. Der Konsolidierungsprozess wird maßgeblich durch die Auflagen der Haushaltsgenehmigungen sowie der hohen Auflagen im Rahmen der Stabilisierungshilfen begleitet, in welchen der Stadt eindeutige Aufgabestellungen und Vorgaben mit auf den Weg gegeben werden. Auf der Einnahmenseite wurde in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an Steuer- und Gebührenerhöhungen vollzogen. Hier sollten weiter auch regelmäßig Anpassungen
stattfinden, da inflationsbedingt der Ausgabenbereich erfahrungsgemäß eine entsprechende
Steigerung aufweist bei welchem im kommunalen Sektor die Anpassungen auf der Einnahmenseite zeitlich oft hinterherhinken.
Im Jahr 2024 wurde die detaillierte Aufarbeitung einzelner Haushaltsbereiche in den politischen Gremien weiter fortgesetzt. Diese Arbeit wird auch weiter einen Schwerpunkt im Jahr 2025 und die Jahre darüber hinaus einnehmen müssen. Gemäß Auflage der Stabilisierungshilfe 2024 ist die dritte Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts bis zum 31.03.2025 der Regierung vorzulegen. Festzustellen ist, dass die Stadt in der Regel politische Mehrheiten für Entscheidungen findet. Die geforderten Steigerungen der Kostendeckungsgrade erfordern von der Verwaltung die Erstellung von qualifizierten Konzepten, die einen politischen Konsens finden können. Die Umsetzung benötigt stets Durchhaltevermögen und hohen persönlichen Einsatz, unter der Beachtung der erforderlichen Qualifikation des Projektteams. Besonders im Jahr 2025 werden erneut Beschlüsse zu treffen sein, die unter anderem auch soziale Einrichtungen betreffen. Insbesondere sind hier die Kindertageseinrichtungen zu nennen. Von Erhöhung der Elternbeiträge bis hin zu politischen Gesprächen zur Erhöhung der Finanzierungsanteile durch den Landkreis werden erforderlich sein, um die geforderten Verbesserungen der Kostendeckungsgrade in diesem Bereich zu erzielen. Die anstehenden Baumaßnahmen, wie die Sanierung des denkmalgeschützten Lorch Hauses bei der Heilig-Geist-Spital-Stiftung Füssen oder die Dachsanierung in der Kindertageseinrichtung der Waisen- und Kinderhortstiftung benötigen neben der Beachtung der Verwaltungsrichtlinien zusätzlich die Beachtung des Stiftungsrechts. Die Gründung des neuen Kommunalunternehmens „Stadtwerke“ zum 01.01.2026 wird auch die städtische Verwaltung im Jahr 2025 organisatorisch herausfordern. Die buchhalterischen Arbeiten, die heute noch von den städtischen Mitarbeitern in der Kasse, im Steueramt und in der Kämmerei ausgeführt werden, sollen bereits ab 01.01.2025 mit Einführung von DATEV durch Mitarbeiter in den Stadtwerken ausgeführt werden. Diese Organisationsveränderung sowie die Vorbereitung auf die finanzielle Selbständigkeit der Stadtwerke im Kommunalunternehmen wird im Jahr 2025 besonders bedeutsam. Der angestoßene Prozess der Haushaltskonsolidierung wird und muss dabei eine Daueraufgabe der Stadt Füssen sein, um sich über Jahre wieder einen Finanzspielraum erwirtschaften zu können. Der Verwaltungshaushalt ist deutlich zu entschlacken, um für die anstehenden Investitionen, aber auch zum Abbau der Überschuldung die notwendigen Finanzmittel bereitstellen zu können. Insbesondere ist hier auch weiter ein Augenmerk auf freiwillige Leistungen sowie kostenrechnende Einrichtungen zu werfen. Hier muss das Ziel sein, die freiwilligen Leistungen zurückzufahren und kostenrechnende Einrichtungen wirtschaftlich zu betreiben. Auch sind organisatorische Abläufe auf den Prüfstand zu stellen, Verwaltungsabläufe zu straffen und die verwaltungsökonomische Modernisierung voranzutreiben.
Fazit zur Haushaltsplanung 2025 der Stadt Füssen
Der am 17. Dezember 2024 vom Stadtrat beschlossene Haushalt der Stadt Füssen markiert einen weiteren Schritt im langfristigen Prozess der Haushaltskonsolidierung. Mit einem Gesamthaushaltsvolumen von 81.841.650 Euro spiegelt der Haushalt eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr wider, wobei der Verwaltungshaushalt deutlich zulegte, während der Vermögenshaushalt leicht sank.
Die Stadt bleibt weiterhin unter strengen Vorgaben der Rechtaufsichtsbehörde und den Bedingungen der Stabilisierungshilfen, die eine klare und nachhaltige Ausrichtung der städtischen Finanzen fordern.
Besonders hervorzuheben ist die Notwendigkeit, die dritte Fortschreibung dieses Haushaltskonsolidierungskonzepts fristgerecht vorzulegen und dessen Umsetzung mit politischer und administrativer Konsequenz voranzutreiben.
Zentrale Herausforderungen im Jahr 2025:
Steuer- und Gebührenanpassungen: Um den inflationsbedingten Kostensteigerungen zu begegnen, sind regelmäßige Anpassungen notwendig, da Einnahmen in der Vergangenheit oft den Ausgaben hinterherhinkten.
Soziale Einrichtungen: Maßnahmen zur Verbesserung der Kostendeckungsgrade, insbesondere in Kindertageseinrichtungen, wie die Erhöhung der Elternbeiträge oder die Verhandlung über höhere Finanzierungsanteile durch den Landkreis, stehen im Fokus.
Investitionsprojekte: Die Sanierung des Kaiser-Maximilian-Platzes und Neubau der beiden Kindertageseinrichtung erfordern nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern auch personelle.
Gründung der Stadtwerke: Die organisatorische und buchhalterische Vorbereitung auf die finanzielle Selbstständigkeit des neuen Kommunalunternehmens stellt eine bedeutende Herausforderung dar.
Effizienzsteigerungen: Der Verwaltungshaushalt muss verschlankt werden. Dies erfordert die Reduktion freiwilliger Leistungen, die wirtschaftliche Optimierung kostenrechnender Einrichtungen und die Straffung organisatorischer Abläufe.
Die Stadt Füssen steht vor anspruchsvollen Aufgaben, die nicht nur finanzielle, sondern auch strukturelle und organisatorische Veränderungen erfordern. Der eingeschlagene Weg der Haushaltskonsolidierung ist zwingend weiterzuführen, um mittelfristig finanziellen Spielraum für zukünftige Investitionen und den Abbau der Überschuldung zu schaffen. Nur durch einen nachhaltigen und entschlossenen Umgang mit den Ressourcen kann die Stadt langfristig wirtschaftlich stabil aufgestellt werden.
- Stabilisierungshilfebescheid 2024 inkl. Auflagen (Punkte a-h)
Hier erfolgt der Auszug des Stabilisierungshilfebescheids 2024:
Die Stadt Füssen erhält nach den bereits in 2022 bewilligten Mitteln auch im Jahr 2023 und 2024 Bedarfszuweisungen nach Art. 11 BayFAG in Form von Stabilisierungshilfen. Auf Grundlage des Antrags der Stadt vom April 2024 entschied der Verteilerausschuss des Landtags in seiner Novembersitzung 2024 der Stadt Füssen Mittel i. H. v. 4,0 Mio. EURO zukommen zu lassen. Mit Schreiben vom 05.12.2024 ging der Förderbescheid mit umfangreichen Auflagen bei der Stadt Füssen ein. Alle Stadträte erhielten den Bescheid umgehend per Ratsinformationssystem übermittelt.
Der Förderbescheid enthält wie bereits auch schon im Jahr 2022 und 2023 etliche Auflagen, welche an die Gewährung der Stabilisierungshilfezahlung geknüpft sind. Die Auflagen müssen bis spätestens 31. März 2025 erfüllt sein. Im Förderbescheid ist auch ein Widerrufsvorbehalt enthalten. Dieser weist explizit auf die Rückforderung der Stabilisierungshilfe hin, sollte gegen Auflagen verstoßen werden. In den Ausführungen zum Widerrufsvorbehalt spricht die Regierung von Schwaben auch den fortwährenden Bestand des Konsolidierungswillens an. Läge kein Konsolidierungswille mehr vor, so wäre die Bewilligungsbehörde gezwungen, die Gewährung der Stabilisierungshilfe abzulehnen.
Der Bescheid lautet wie folgt:
1. Antrag auf Gewährung einer Stabilisierungshilfe der Säule 1
Auf Grundlage der zur Sitzung am 8. November 2024 vorgelegten Unterlagen wird wie folgt über den Antrag entschieden:
- Es wird eine Stabilisierungshilfe nach Art. 11 BayFAG in Höhe von 4.000.000 € zur Schuldentilgung (Säule 1) unter
nachfolgenden Auflagen (siehe 1. 2. und 3.) bewilligt.
Auflagen zur Bewilligung einer Stabilisierungshilfe der Säule 1
Die Stabilisierungshilfe (Säule 1) wird unter folgenden Auflagen bewilligt, die von der Kommune bis spätestens zum 31. März 2025 erfüllt und nachgewiesen werden müssen:
- Die von der Stadt begonnene Aufgabenkritik ist bei den Pflichtaufgaben und insbesondere bei den Aufgaben, die nicht den originären Pflichtaufgabenbereich zuzuordnen sind konsequent fortzuführen. Hierzu ist eine dezidierte Stellungnahme sowie sofern bereits vorhanden entsprechende Beschlüsse vorzulegen.
- Die gemäß dem vorgelegten Haushaltskonsolidierungskonzept angestoßenen und angedachten Konsolidierungsmaßnahmen sind weiterhin konsequent umzusetzen,
- Mitteilung des aktuellen Sachstands zur Konsolidierung des Bereichs Gebäudemanagement. Zudem ist das weitere Vorgehen für die Gebäude in der Ziegelwiesstraße (Hausnummern 2 bis 16) sowie deren finanzielle Auswirkung mitzuteilen.
- Mitteilung über den Ausgang bzw. den aktuellen Stand zum Verfahren der Stadt Füssen gegen das Bankhaus Hauck & Aufhäuser in Sachen Zinsderivate bzw. SWAP-Geschäfte.
- Fortschreibung und Umsetzung des vorgelegten Haushaltskonsolidie-rungskonzepts bis spätestens zum 31. März 2025 im Benehmen mit dem zuständigen Landratsamt gemäß den Vorgaben der Anlage zum Schreiben des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat vom 19. Februar 2024, Az. 62 -- FV 6520.9-3/10.
Neuerungen und Ergänzungen im Haushaltskonsolidierungskonzept sind hervorzuheben.
- Aktualisierung der tabellarischen Übersicht zum Haushaltskonsolidierungskonzept entsprechend dem Anlagendokument zum FMS vom 19. Februar 2024, Az. 62 — FV 6520.9-3/10.
- Beschluss des fortgeschriebenen Haushaltskonsolidierungskonzepts einschließlich der aktualisierten tabellarischen Übersicht durch den Stadtrat mit dem Ziel, mittelfristig wieder die finanzielle Leistungsfähigkeit zu erreichen.
- Prüfhinweise und allgemeine Hinweise:
Bei der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts sind insbesondere folgende Punkte umfassend zu prüfen:
- Von einer Kommune, die Stabilisierungshilfen zur Besserung ihrer finanziellen Lage erhält, wird erwartet, dass sie alle eigenen Einnahmemöglichkeiten ausschöpft. Hierzu gehört u. a. auch, dass die Hebesätze bei der Grundsteuer A und B mit Wirkung ab 1. Januar 2025 dergestalt angepasst werden, dass sich das jeweilige Grundsteueraufkommen im Jahr 2025 mindestens auf dem jeweiligen Niveau des Jahres 2024 bewegt, das sich bei einem Hebesatz mindestens im Größenklassendurchschnitt der Kassenstatistik 20231 ergeben hätte.
- Prüfung, inwieweit im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Verbesserungsbeiträge erhoben werden
Das Ergebnis der Überprüfung ist im fortzuschreibenden Haushaltskonsolidierungskonzept anschaulich darzustellen.
Die FachbereichsleiterInnen der Stadt Füssen sowie Verantwortlichen der Eigenbetriebe und Kommunalunternehmen wurden hierüber (erneut) ausführlich informiert.
Auch für das Jahr 2025 wird der Antrag auf Stabilisierungshilfe und ab 2025 auch Säule II -Investitionshilfen für Pflichtaufgaben gestellt worden. Nicht außeracht gelassen werden darf dabei der hohe zusätzliche Personalaufwand innerhalb der Verwaltung.
- Stellungnahmen zur Auflagenerfüllung (Punkte a-h)
Die Stabilisierungshilfe (Säule 1) wird unter folgenden Auflagen bewilligt, die von der Kommune bis spätestens zum 31. März 2025 erfüllt und nachgewiesen werden müssen:
- Die von der Stadt begonnene Aufgabenkritik ist bei den Pflichtaufgaben und insbesondere bei den Aufgaben, die nicht den originären Pflichtaufgabenbereich zuzuordnen sind konsequent fortzuführen. Hierzu ist eine dezidierte Stellungnahme sowie sofern bereits vorhanden entsprechende Beschlüsse vorzulegen.
Stellungnahmen:
Die Stadt Füssen verfolgt bereits seit geraumer Zeit eine umfassende Aufgabenkritik, die sowohl die Pflichtaufgaben als auch die freiwilligen Aufgaben der Stadt betrifft. Im Jahr 2024/2025 wird diese Aufgabenkritik weiter konsequent fortgeführt, um eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung zu erreichen und gleichzeitig die Effizienz der Verwaltung zu steigern.
Im Rahmen der Stabilisierungshilfeauflage 2024 Punkt a) nehmen wir dazu eine dezidierte Stellungnahme zu den durchgeführten Maßnahmen und zukünftigen Vorhaben vor:
Fortführung der Aufgabenkritik bei den Pflichtaufgaben
A. Zielsetzung der Aufgabenkritik
Die Pflichtaufgaben der Stadt Füssen sind gesetzlich vorgegeben und können grundsätzlich nicht reduziert oder gestrichen werden. Dennoch wird jede dieser Aufgaben regelmäßig auf ihre Effizienz und Wirtschaftlichkeit geprüft. Hierbei geht es nicht darum, diese Aufgaben zu hinterfragen, sondern sicherzustellen, dass sie optimal und mit möglichst geringem Ressourceneinsatz erfüllt werden.
B. Beispiel einer Pflichtaufgabe: Kindergärten
Ein konkretes Beispiel für die laufende Aufgabenkritik im Bereich der Pflichtaufgaben stellen die Kindergärten dar.
Die Bereitstellung von Kindergärten und frühkindlicher Bildung gehört zu den zentralen Pflichtaufgaben der Stadt Füssen, da sie durch das Achte Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) geregelt ist. Gemäß der gesetzlichen Vorgabe ist die Stadt verpflichtet, für den Bedarf an Kindertagesstätten und Plätzen für die frühkindliche Betreuung zu sorgen. Allerdings bedeutet dies nicht, dass die Ausführung dieser Aufgabe nicht auf ihre Effizienz und Wirtschaftlichkeit hin überprüft werden kann. Die Stadt Füssen nimmt daher auch im Bereich der Kindergärten eine fortlaufende Aufgabenkritik vor, um die Qualität der Betreuung bei gleichzeitiger Kostenkontrolle zu sichern.
Zielsetzung der Aufgabenkritik im Bereich Kindergärten
Die Zielsetzung der Aufgabenkritik im Bereich der Kindergärten ist es, die erforderliche Anzahl an Betreuungsplätzen bereitzustellen, gleichzeitig aber auch die Struktur und die Finanzierbarkeit der Einrichtungen kontinuierlich zu hinterfragen und zu optimieren. Dabei sollen sowohl die Qualität der frühkindlichen Bildung und Betreuung als auch die Kosteneffizienz gewährleistet werden.
C. Effizienzsteigerung durch Digitalisierung
Auch die Digitalisierung wird als wichtiges Instrument zur Verbesserung der Effizienz bei der Erfüllung der Pflichtaufgaben genutzt. Die Stadt Füssen prüft, wie durch den Einsatz von IT-gestützten Lösungen Verwaltungsprozesse schneller und kostengünstiger gestaltet werden können. Ein Beispiel ist die Digitalisierung der Kämmerei.
Die Digitalisierung bietet auch im Bereich der Kämmerei der Stadt Füssen enormes Potenzial zur Effizienzsteigerung. Die Einführung digitaler Prozesse und Systeme kann dazu beitragen, den Verwaltungsaufwand zu verringern, die Fehlerquote zu reduzieren und den gesamten Finanzprozess transparenter und effektiver zu gestalten.
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2025 wird die Digitalisierung auch in der Kämmerei weiter vorangetrieben, um den Verwaltungsaufwand zu senken und eine bessere Nutzung der Ressourcen zu ermöglichen.
Zielsetzung der Digitalisierung im Bereich Kämmerei
Die Digitalisierung in der Kämmerei verfolgt mehrere Ziele:
- Reduzierung des manuellen Aufwands durch Automatisierung von Routineprozessen.
- Erhöhung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Finanztransaktionen und Haushaltsbewegungen.
- Schnellere Bereitstellung von Finanzdaten für die Verwaltung und den Stadtrat.
- Optimierung der internen Arbeitsabläufe und Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung.
Konkrete Maßnahmen zur Digitalisierung der Kämmerei
Einführung eines elektronischen Haushalts- und Finanzmanagementsystems.
Die Stadt Füssen plant die Einführung oder Weiterentwicklung eines modernen elektronischen Systems für das Haushalts- und Finanzmanagement. Dieses System ermöglicht die vollständige Digitalisierung des Haushaltsplans, der Buchführung sowie der Überwachung von Ausgaben und Einnahmen.
Vorteile:
Automatisierte Berichterstattung und Haushaltsüberwachung.
Geringere Fehlerquote und höhere Genauigkeit bei der Finanzverwaltung.
Direkte Einbindung aller relevanten Fachabteilungen zur schnelleren Entscheidungsfindung.
Auch wird ein Dokumentenmanagement zum 01.05.2025 eingeführt, mit dem die Dokumentierung- und Ablage/Archivierung vollständig digitalisiert und professionalisiert wird.
Fortführung der Aufgabenkritik bei den freiwilligen Aufgaben
A. Zielsetzung und Vorgehensweise
Im Bereich der freiwilligen Aufgaben verfolgt die Stadt Füssen das Ziel, das Angebot weiterhin bedarfsgerecht und finanziell tragfähig zu gestalten. Durch die regelmäßige Überprüfung der freiwilligen Aufgaben wird sicherstellt, dass diese weiterhin den Bedürfnissen der Bürgerschaft entsprechen, ohne das Haushaltsgleichgewicht zu gefährden.
B. Beispiel einer freiwilligen Aufgabe: Kulturförderung
Im Bereich der Kulturförderung wurden bereits verschiedene Maßnahmen zur Optimierung ergriffen:
Zusammenarbeit mit externen Partnern: Anstatt alle kulturellen Veranstaltungen in städtischer Verantwortung zu halten, wurden Partnerschaften mit lokalen Kulturvereinen etabliert. (Bsp. Förderverein Festival „vielsaitig“)
Dies sorgt für eine breitere Basis der kulturellen Angebote und entlastet den städtischen Haushalt.
Förderung von Eigeninitiativen: Das Engagement von Vereinen in der Kulturarbeit wird gezielt unterstützt, beispielsweise durch reduzierte Mietpreise für städtische Einrichtungen, wodurch städtische Ausgaben reduziert werden.
3. Maßnahme: Auflösung der Stadtgärtnerei ab 01.01.2025
A. Zielsetzung und Auswirkungen
Mit Beschluss vom 16.07.2024 und 23.07.2024 wir die Stadteigene Gärtnerei zum 01.01.2025 aufgelöst.
Diese Entscheidung ist ein zentraler Bestandteil der laufenden Haushaltskonsolidierung 2024/2025 und stellt eine bedeutende Maßnahme zur Entlastung des Verwaltungshaushalts dar.
Die Auflösung der Stadtgärtnerei führt zu einer jährlichen Entlastung von rund 300.000 Euro im Verwaltungshaushalt (bei gleichem Personalstand) da folgende Kosten entfallen:
Betriebskosten: Dies umfasst u.a. Kosten für Betriebsmittel, Geräte und Infrastruktur der Gärtnerei.
Beschaffung: Die Pflanzen werden nicht mehr selbst gezüchtet, sondern werden nach Auftrag angeliefert.
B. Ersatzmodell
Nach der Auflösung der Stadtgärtnerei wird die Stadt Füssen weiterhin auf eine gepflegte und attraktive Stadtgestaltung angewiesen sein. Um dies sicherzustellen, wechseln die Mitarbeiter der Gärtnerei in den Bauhof und sind künftig der Gärtnertrupp. Eine Stelle im Personal „Leitung Gärtnerei“ konnte dadurch eingespart werden.
C. Langfristige Perspektive
Die Auflösung der Stadtgärtnerei ist eine Maßnahme, die im Einklang mit der allgemeinen Strategie zur Haushaltskonsolidierung steht. Auf lange Sicht wird dies nicht nur zu einer Entlastung des Verwaltungshaushalts führen, sondern auch den Fokus auf eine Professionalisierung der gärtnerischen Aufgaben legen, was eine nachhaltigere und flexiblere Lösung darstellt.
4. Zusammenfassung und Ausblick
Die Stadt Füssen führt die Aufgabenkritik konsequent fort, sowohl im Bereich der Pflichtaufgaben als auch der freiwilligen Aufgaben. Die Evaluierung und Optimierung der Aufgabenerfüllung erfolgt fortlaufend, um die Effizienz zu steigern und den Haushalt nachhaltig zu konsolidieren.
Die Auflösung der Stadtgärtnerei ab dem 01.01.2025 stellt eine bedeutende Maßnahme dar, die zu einer jährlichen Entlastung von rund 300.000 Euro führen wird. Gleichzeitig wird die Stadt sicherstellen, dass die gärtnerische Pflege weiterhin in hoher Qualität gewährleistet wird.
Zukünftig wird die Stadt Füssen weiterhin alle Aufgaben, sowohl Pflicht- als auch freiwillige Aufgaben, regelmäßig auf ihre Notwendigkeit und Effizienz hin überprüfen, um die Finanzlage der Stadt langfristig zu stabilisieren und die Daseinsvorsorge optimal sicherzustellen.
- Die gemäß dem vorgelegten Haushaltskonsolidierungskonzept angestoßenen und angedachten Konsolidierungsmaßnahmen sind weiterhin konsequent umzusetzen,
Die Stadt Füssen bestätigt, dass die im vorgelegten Haushaltskonsolidierungskonzept festgelegten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung konsequent umgesetzt werden. Dabei wird die bereits begonnene Umsetzung fortgeführt, um eine nachhaltige und stabile finanzielle Grundlage für die Stadt zu schaffen. Nachfolgend geben wir einen Überblick über die bereits umgesetzten sowie die noch geplanten Konsolidierungsmaßnahmen, die im Rahmen der Stabilisierungshilfeauflage 2024 weiterhin verfolgt werden.
Durch die kontinuierliche Überprüfung von Ausgaben, Einnahmen und Verwaltungsstrukturen sowie die Implementierung von Digitalisierung und Kooperationen wird die Stadt auch 2025 auf einem soliden Kurs bleiben, um die finanziellen Herausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig die Daseinsvorsorge in allen relevanten Bereichen zu sichern.
Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen wird regelmäßig evaluiert und gegebenenfalls angepasst, um sicherzustellen, dass die angestrebte Haushaltsstabilisierung nachhaltig erreicht wird.
- Mitteilung des aktuellen Sachstands zur Konsolidierung des Bereichs Gebäudemanagement. Zudem ist das weitere Vorgehen für die Gebäude in der Ziegelwiesstraße (Hausnummern 2 bis 16) sowie deren finanzielle Auswirkung mitzuteilen.
Die Stadt Füssen hat im Bereich Gebäudemanagement eine erhebliche Verbesserung erzielt, insbesondere bei den Kaltmieteinnahmen. Von Gesamt über alle Liegenschaften hinweg 603.104 Euro im Jahr 2021 konnten die Einnahmen bis 2025 auf 1.005.448 Euro gesteigert werden. Dies bedeutet, dass die Stadt erstmals die 1-Millionen-Euro-Grenze überschreiten wird – ein klarer Erfolg. Diese Steigerung zeigt die positive Entwicklung im Bereich der Vermietung städtischer Liegenschaften und unterstützt die Konsolidierungsziele des Haushalts. Die kontinuierliche Steigerung der Kaltmieteinnahmen um mehr als 66 % innerhalb von nur 39 Monaten deutet auf eine erfolgreiche Strategie zur effizienten Nutzung und Verwaltung der städtischen Immobilien hin. (Details ab Seite 55)
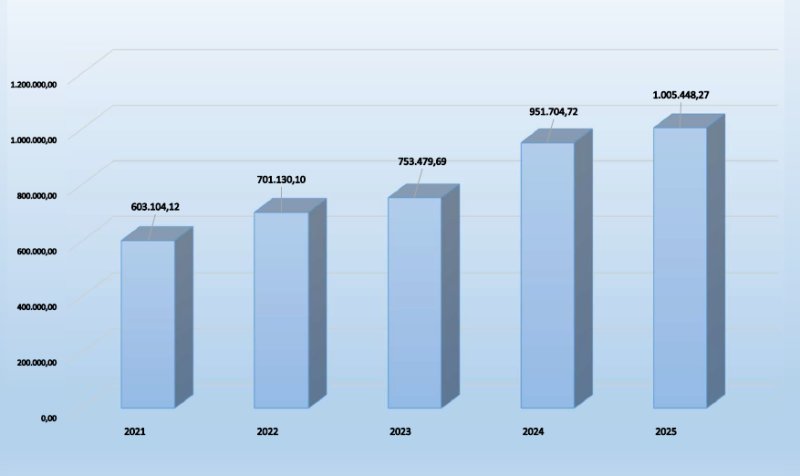
Dieser Fortschritt ist besonders bedeutend im Hinblick auf die geplanten Investitionen und Modernisierungen, wie sie beispielsweise im Projekt zur Entwicklung von bezahlbarem Wohnraum in der Ziegelwiesstraße vorgesehen sind. Die Stadt Füssen hat es somit geschafft, eine stabile Einnahmequelle zu etablieren, die zur Finanzierung von Zukunftsprojekten beiträgt und zur Konsolidierung des städtischen Haushalts beiträgt.
Die Liegenschaften in der Ziegelwiesstraße umfassen mehrere Mehrfamilienhäuser, die allesamt sanierungsbedürftig sind und aus den Jahren 1919 bis 1926 stammen. Die Gebäude weisen verschiedene strukturelle und energetische Mängel auf, insbesondere fehlen zentrale Heizungen sowie eine Dachdämmung und Dachschalung.
Objekte im Überblick:
Ziegelwiesstraße 2, 4, 6
Baujahr: 1919 - 1926
Art: Mehrfamilienhaus
Nutzung: 9 Wohnungen
Zustand: Sanierungsbedürftig, ohne zentrale Heizung, keine Dachdämmung
Grundstücksfläche: 1.110 m²; 940 m²; 630 m²
Wohnfläche: 745,5 m²
Jahresüberschuss 2025: 24.719 Euro
Ziegelwiesstraße 8, 10
Baujahr: 1919 - 1926
Art: Mehrfamilienhaus
Nutzung: 6 Wohnungen
Zustand: Sanierungsbedürftig, ohne zentrale Heizung, keine Dachdämmung
Grundstücksfläche: 630 m²; 490 m²
Wohnfläche: 474,18 m²
Jahresüberschuss 2025:-1.261 Euro (aufgrund Renovierung einer Wohnung zur Neuvermietung)
Ziegelwiesstraße 12, 14
Baujahr: 1919 - 1926
Art: Mehrfamilienhaus
Nutzung: 6 Wohnungen
Zustand: Sanierungsbedürftig, ohne zentrale Heizung, keine Dachdämmung
Grundstücksfläche: 580 m²; 633 m²
Wohnfläche: 476,79 m²
Jahresüberschuss 2025: 13.154 Euro
Ziegelwiesstraße 16
Baujahr: 1919 - 1926
Art: Mehrfamilienhaus
Nutzung: 6 Wohnungen
Zustand: Sanierungsbedürftig, ohne zentrale Heizung, keine Dachdämmung
Grundstücksfläche: 820 m²
Wohnfläche: 360 m²
Jahresüberschuss 2025: 14.360 Euro
Fazit zu den Liegenschaften Ziegelwies:
Die Liegenschaften in der Ziegelwiesstraße erwirtschaften derzeit Gewinne, wenn auch die Überschüsse noch gering sind. Die Mieten werden gemäß den gesetzlichen Fristen angepasst, um die Rentabilität zu steigern. Eine Kernsanierung der Gebäude wird für das Jahr 2029-2032 in Erwägung gezogen, um die Energieeffizienz zu verbessern und den Zustand der Liegenschaften langfristig zu sichern.
Die Planungen und finanziellen Überschüsse aus den Immobilien zeigen eine positive Entwicklung, jedoch könnte eine umfassendere Sanierung die wirtschaftliche Rentabilität weiter steigern und gleichzeitig zur Verbesserung der Wohnqualität beitragen. Zugleich wird die Stadtverwaltung die Bauentwicklungen im Jahr 2025 und 2026 beobachten und es besteht die Möglichkeit zur Veräußerung des gesamten Areals an einen Bauträger, um hier eine Nachverdichtung anzustreben und ggf. das komplette Areal neu zu überbauen.
Fokus für 2025 und 2026 liegt darin, das Areal Ziegelwies im Bereich der Rendite zu steigern, um zukünftige Maßnahmen finanzieren zu können und zugleich ein Szenario B (Verkauf) weiterzuentwickeln.
- Mitteilung über den Ausgang bzw. den aktuellen Stand zum Verfahren der Stadt Füssen gegen das Bankhaus Hauck & Aufhäuser in Sachen Zinsderivate bzw. SWAP-Geschäfte.
Der Rechtsstreit der Stadt Füssen gegen das Bankhaus Hauck & Aufhäuser bezüglich der Swap-Geschäfte setzt sich fort. Es gab einen Hinweisbeschluss des OLG München vom 15.11.2023, in welchem den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme bis 15.02.2024 zu den Hinweisen des Senats gegeben wurde. Wir haben mit unserer Anwaltskanzlei fristgemäß eine 15-seitige Stellungnahme ausgearbeitet und eingereicht.
Der nächste Gerichtstermin ist nun für den 10. Februar 2025 in München angesetzt. Das Ergebnis wird anschließend zeitnah an unsere Aufsichtsbehörde, dem LRA OAL übermittelt.
- Fortschreibung und Umsetzung des vorgelegten Haushaltskonsolidierungskonzepts bis spätestens zum 31. März 2025 im Benehmen mit dem zuständigen Landratsamt gemäß den Vorgaben der Anlage zum Schreiben des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat vom 19. Februar 2024, Az. 62 – FV 6520.9-3/10. Neuerungen und Ergänzungen im Haushaltskonsolidierungskonzept sind hervorzuheben.
Die 3. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts der Stadt Füssen wird am 28. Januar 2025 in einer Sitzung des Stadtrats beschlossen. Anschließend wird das Konzept beim zuständigen Landratsamt eingereicht. In dieser Fortschreibung werden alle relevanten Neuerungen und Ergänzungen hervorgehoben, um den Haushaltsplan weiter zu optimieren und den Vorgaben des Staatsministeriums der Finanzen zu entsprechen.
- Aktualisierung der tabellarischen Übersicht zum Haushaltskonsolidierungskonzept entsprechend dem Anlagendokument zum FMS vom 19. Februar 2024, Az. 62 — FV 6520.9-3/10.
Aktualisiert im Anhang.
- Beschluss des fortgeschriebenen Haushaltskonsolidierungskonzepts einschließlich der aktualisierten tabellarischen Übersicht durch den Stadtrat mit dem Ziel, mittelfristig wieder die finanzielle Leistungsfähigkeit zu erreichen.
Die 3. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts der Stadt Füssen wird voraussichtlich am 28. Januar 2025 in einer Sitzung des Stadtrats beschlossen. Anschließend wird das Konzept beim zuständigen Landratsamt eingereicht. In dieser Fortschreibung werden alle relevanten Neuerungen und Ergänzungen hervorgehoben, um den Haushaltsplan weiter zu optimieren und den Vorgaben des Staatsministeriums der Finanzen zu entsprechen.
h) Prüfhinweise und allgemeine Hinweise:
Bei der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts sind insbesondere folgende Punkte umfassend zu prüfen:
· Von einer Kommune, die Stabilisierungshilfen zur Besserung ihrer finanziellen Lage erhält, wird erwartet, dass sie alle eigenen Einnahmemöglichkeiten ausschöpft. Hierzu gehört u. a. auch, dass die Hebesätze bei der Grundsteuer A und B mit Wirkung ab 1. Januar 2025 dergestalt angepasst werden, dass sich das jeweilige Grundsteueraufkommen im Jahr 2025 mindestens auf dem jeweiligen Niveau des Jahres 2024 bewegt, das sich bei einem Hebesatz mindestens im Größenklassendurchschnitt der Kassenstatistik 20231 ergeben hätte.
· Prüfung, inwieweit im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Verbesserungsbeiträge erhoben werden
Beiträge Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:
Die Stadt Füssen hat die Wasser- und Abwassergebühren zum 17. Dezember 2024 angepasst. Die Wassergebühr wurde auf 2,01 € pro m³ erhöht, die Abwasser-Einleitungsgebühr auf 3,56 € pro m³. Zudem wurden Grundgebühren eingeführt, um Zweitwohnungsbesitzer stärker zu belasten. Die Kalkulation nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) wird von 4 auf 2 Jahre reduziert, um aktuellere Marktpreise zu bieten.
Die Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren zum 01.01.2025 stellt sich wie folgt dar:
- Die Wassergebühr wurde von 1,39 € auf 2,01 € pro m³ erhöht.
Das entspricht einer Erhöhung von etwa 44,6%.
- Die Abwasser-Einleitungsgebühr wurde von 2,52 € auf 3,56 € pro m³ erhöht, was eine Erhöhung von etwa 41,3% bedeutet.
Beiträge Grundsteuer A und B:
Die Grundsteuerreform 2025 wird durch das Bayerische Grundsteuergesetz umgesetzt, wobei ein wertunabhängiges Modell für die Grundsteuer B eingeführt wird.
Zum 1. Januar 2025 müssen die Hebesätze angepasst werden.
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 26.11.2024 folgendes beschlossen:
Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt bei 415%.
Während der Hebesatz für die Grundsteuer B von 435% auf 475% steigt.
Dies führt voraussichtlich zu Mehreinnahmen von etwa 38.313,27 Euro.
Beschlussvorschlag
Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt die beiliegende 3. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für die Stadt Füssen. Dieses bildet auch weiterhin die Grundlage für die künftige Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt und setzt die Leitlinien des künftigen Handels der Stadt mit dem Ziel, mittelfristig wieder finanziell handlungsfähig zu werden. Das Konzept dient dazu als eine politische Grundsatzerklärung mit Selbstverpflichtung sowohl für die Politik und Verwaltung für die bevorstehenden finanzpolitischen Herausforderungen zu verstehen.
Spätestens zur Haushaltsaufstellung und Haushaltsberatung 2026 ist dieses Konzept den aktuellen Entwicklungen zur 4. Fortschreibung anzupassen und fortzuschreiben.
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt die beiliegende 3. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für die Stadt Füssen. Dieses bildet auch weiterhin die Grundlage für die künftige Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt und setzt die Leitlinien des künftigen Handels der Stadt mit dem Ziel, mittelfristig wieder finanziell handlungsfähig zu werden. Das Konzept dient dazu als eine politische Grundsatzerklärung mit Selbstverpflichtung sowohl für die Politik und Verwaltung für die bevorstehenden finanzpolitischen Herausforderungen zu verstehen.
Spätestens zur Haushaltsaufstellung und Haushaltsberatung 2026 ist dieses Konzept den aktuellen Entwicklungen zur 4. Fortschreibung anzupassen und fortzuschreiben.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 1
zum Seitenanfang
5. Stadtbibliothek Füssen: Open Library
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
28.01.2025
|
ö
|
beschliessend
|
5 |
Sachverhalt
Die Einführung von Open Library in der Stadtbibliothek Füssen ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern einen flexibleren Zugang zu Medien und digitalen Ressourcen, was die Attraktivität und Nutzung der Bibliothek erhöht.
Durch erweiterte Öffnungszeiten wird das Bildungs- und Kulturangebot der Stadt gestärkt und besser an die Bedürfnisse der Bevölkerung angepasst. Zudem fördert die Open Library eine effiziente Ressourcennutzung, was zur Haushaltskonsolidierung beiträgt, indem Betriebskosten optimiert und Personalressourcen entlastet werden.
Der Haupt-, Finanz-, Sozial- und Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 18.07.2023 beschlossen, das Projekt Open Library in der Stadtbibliothek Füssen zeitnah umzusetzen und die Verwaltung beauftragt, die dazu erforderlichen Schritte vorzubereiten, um eine Entscheidungsreife im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2024 herzustellen.
Bei den Haushaltsberatungen für das Jahr 2024 wurde das Projekt verschoben, um Finanzierung und Förderungen sicherstellen zu können.
Durch die in Aussicht gestellte Förderung von 30 bis 40 % der förderfähigen Kosten kann das Open Library-Projekt in der Bibliothek Füssen nun umgesetzt werden, was den Zugang zu Bildungs- und Kulturangeboten deutlich verbessert. Die finanzielle Unterstützung entlastet den städtischen Haushalt und ermöglicht eine kosteneffiziente Realisierung des Projekts. Dies stärkt die Bibliothek als modernen Begegnungs- und Lernort für alle Bürgerinnen und Bürger.
Die Open Library wird derzeit als einzige Möglichkeit zur Erweiterung der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek gesehen. Die Einrichtung kann durch die Aufsplittung sowohl haushaltstechnisch wie auch personell mit einer vertretbaren Belastung umgesetzt werden.
Die Open Library wird in zwei Stufen ausgerollt:
- Jahr 2025:
Die mit der Open Library kompatible RFID-Ausstattung wird angeschafft und kann sofort für den normalen Bibliotheksbetrieb genutzt werden.
- Jahr 2026
Umsetzung der Open Library Installation und Implementierung
Bei den Haushaltsberatungen für 2025 wurden 25.000 Euro für RFID-Komponenten in den Haushaltsplan 2025 und 85.000 Euro für Open-Library-Technik, Elektroinstallation etc. in den Finanzplan für 2026 aufgenommen.
Insgesamt ist mit ca. 23.000 Euro Förderung zu rechnen. Somit würden sich die Kosten für die gesamte Umsetzung der Open Library auf rund 87.000 Euro reduzieren.
Beschlussvorschlag
Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts die Umsetzung des Projekts Open Library in der Stadtbibliothek Füssen.
Die Verwaltung wird beauftragt, die zweckgebundenen Fördermittel zu beantragen, die erforderlichen Maßnahmen zur technischen Umsetzung, zur Anpassung des Sicherheitskonzepts sowie zur Öffentlichkeitsarbeit zeitnah vorzubereiten und durchzuführen.
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts die Umsetzung des Projekts Open Library in der Stadtbibliothek Füssen.
Die Verwaltung wird beauftragt, die zweckgebundenen Fördermittel zu beantragen, die erforderlichen Maßnahmen zur technischen Umsetzung, zur Anpassung des Sicherheitskonzepts sowie zur Öffentlichkeitsarbeit zeitnah vorzubereiten und durchzuführen.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 20, Dagegen: 0
zum Seitenanfang
6. Vorberatung: (FTM/INTERREG) Gestaltung Kaiser-Maximilian-Platz
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
28.01.2025
|
ö
|
beschliessend
|
6 |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
25.02.2025
|
ö
|
beschliessend
|
9 |
Sachverhalt
Einführung:
Kurzbeschreibung
INTERREG Klimaanpassungsprojekt Reutte –
Füssen für Entsiegelung und Ressourcensparsamkeit
Kurzbeschreibung
INTERREG Klimaanpassungsprojekt Reutte –
Füssen für Entsiegelung und Ressourcensparsamkeit
Hintergrund:
Füssen Tourismus und Marketing engagiert sich zunehmend bei Infrastrukturprojekten im öffentlichen Raum. Das Unternehmen nimmt damit den Auftrag an, Beiträge für eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung zu leisten und damit die Aufenthalts- und Lebensqualität gleichermaßen für Einheimische und Gäste zu steigern. Das Engagement beschränkt sich satzungsgemäß auf Projekte nachweisbarer touristischer Relevanz mit dem Fokus auf Maßnahmen, bei denen ein Handlungsbedarf auch aus Sicht der übergeordneten Stadtentwicklung offensichtlich ist.
Über die aktuelle Diskussion zur Sanierung des Sieben-Stein-Brunnens wurde auf Arbeitsebene (Bauamt, Stadtwerke, FTM; teilweise unter Einbeziehung von Herrn Bürgermeister Eichstetter) der Blick geweitet: Welchen Beitrag leistet der Brunnen für die Bedeutung und Funktion des Kaiser-Maximilian-Platzes? Welche Funktion hat der Kaiser-Maximilian-Platz mit seinen verschiedenen „Bausteinen“ in der bzw. für die Kernstadt? Dabei spielen u.a. die folgenden Konzepte bzw. Handlungsbedarfe eine Rolle:
- Innenstadtentwicklung, u.a. Innenstadt- und Tunnelprojekt
Klimaanpassung, u.a. Entsiegelung, Versickerung, öffentliches Angebot an Trinkwasser, gleichzeitig Ressourcensparsamkeit z.B. bei Trinkwasser
Mobilität, u.a. Altstadt-nahe Radabstellanlagen
Zielsetzung:
Die Stadt Füssen verfügt bisher über kein Klimaanpassungskonzept. Ein grenzüberschreitendes Kooperationsprojekt mit der Stadtgemeinde Reutte kann als Starterprojekt eine Klimaanpassungsentwicklung einleiten sowie die Perspektive auf Synergien aus der gemeinsamen Entwicklung und auf eine attraktive Förderkulisse aus dem Programm INTERREG VI-A Bayern – Österreich 2021-2027 eröffnen.
Der Kaiser-Maximilian-Platz soll auf Füssener Seite der Kernbaustein des Projektes werden, für Klimaanpassung sensibilisieren und gleichzeitig wichtige städtebauliche Aufgaben lösen:
- Lösung der Frage nach Status und Standort des Sieben-Stein-Brunnens
- Schaffung weiterer, hochwertiger und altstadtnaher Radabstellanlagen (voraussichtlich außerhalb des Interreg-Projektes!)
- Aufwertung oder Deinstallation des Info-Pavillons
- Entsiegelung und Erhöhung der Versickerungsfähigkeit der Oberfläche
- Begrünung und Beschattung zur Reduzierung der Überhitzung
- KMP vor der TI
- Sieben-Stein-Brunnen
- Pavillon
- „Pyramidengasse“
Maßnahmen:
Sieben-Stein-Brunnen:
- Themen im Rahmen der Klimaanpassung: Ressourcensparsamkeit (Trinkwasser), Mikroklima (Befeuchtung)
- Aufwand für die Sanierung der Technik steht noch nicht fest.
- Eine Sanierung am bisherigen Standort würde neben der Erneuerung der Technik auch eine neue Modellierung der Pflasterung im Umgriff bedeuten. Zu prüfen wäre, ob dadurch sichergestellt werden kann, dass zukünftig kein Wasser ungewollt versickert und ggf. die Parkgarage weiter beschädigt.
- Alternative 1: Zwecks Sicherstellung eines optimalen Betriebes inklusive Nutzung von Regenwasser, das über eine Zisterne aufgefangen werden soll, käme als Alternative die Verlegung des 7SB an einen anderen Standort in Frage. Zur Diskussion kam der Freyberg Park. Der Brunnen würde das Umfeld des Bahnhofs deutlich aufwerten und entspräche der Zielsetzung aus dem ISEK. Die Kalkulation der Verlegung kann gemeinsam mit dem Bauamt stattfinden.
- Alternative 2: Dritte Option wäre die Stilllegung des 7SB und künstlerische Gestaltung am bisherigen Standort KMP. Der Künstler Christian Tobin hält einen Teilbetrieb für die schlechteste Lösung.
- Ziel: Entweder Sanierung am KMP mit Vollbetrieb oder Prüfung der Verlegung des Sieben-Stein-Brunnens an einen alternativen Standort, vorzugsweise in den Freyberg-Park, und Optimierung auf die Nutzung von Naturwasser (Regenwasser).
- Bei der Abwägung sollten die Kosten ebenso einfließen wie die städtebaulich optimale Platzierung im Hinblick auf die aktuelle Stadtentwicklung.
Pavillon:
- Themen im Rahmen der Klimaanpassung: Reduzierung der Bebauung, Entsiegelung, evtl. Begrünung
- Der Pavillon enthält umfangreiche Technik zur Belüftung der Tiefgarage, kann daher nicht komplett abgebaut werden.
- Lediglich eine Reduzierung des Baukörpers um ca. die Hälfte oder komplette Umgestaltung unter der Voraussetzung der weiterhin gesicherten Unterbringung der Technik wäre denkbar.
- Optionen:
- Umgestaltung in eine „Laube“?
- Begrünung?
- Nutzung des Daches für PV zur Speisung der Technik mit Strom?
- Bei ganzer oder teilweiser Beibehaltung des Pavillons sollten auch die bisherigen Infobausteine (Informator, Tafeln, Prospektauslage…) weiterhin dort untergebracht bleiben, evtl. in modifizierter Form.
- Ziel: Der Pavillon wird auf ein Minimum reduziert.
Oberfläche:
- Themen im Rahmen der Klimaanpassung: Entsiegelung, Versickerungsfähigkeit, Begrünung, Beschattung
- Auf die Belange der Platzpflege (u.a. Schneeräumung) und der Barrierefreiheit ist Rücksicht zu nehmen.
- Eine kurzfristige Prüfung hinsichtlich Baudenkmäler ist nicht zu leisten. Es besteht die Hoffnung, dass entsprechende Untersuchungen bei der Anlage der bisherigen Infrastruktur ausreichend vorgenommen wurden. Die meisten Maßnahmen dürften sich an der Oberfläche bewegen. Ausnahme: Baumpflanzungen.
- Bzgl. Brandschutz, Rettungswegen, Zufahrten etc. ist der aktuelle Stand zugrunde zu legen.
- Gespräche mit Eigentümern müssen in der weiteren Folge geführt werden, bis Einreichfrist des Förderantrags voraussichtlich nicht leistbar.
- Eventuell Verlegung der Großveranstaltung „Rutsch Party“ an einen anderen Standort.
- Ziel: Die klimaangepasste Weiterentwicklung der Oberfläche des KMP wird unter Beibehaltung der bisherigen Rahmenbedingungen, aber unter der Prämisse der Beibehaltung des Pavillons oder alternativen Baukörpers geplant.
Weitere Bausteine mit dem Ziel einer klimaangepassten Stadtentwicklung außerhalb des Interreg-Projektes:
- Klimaangepasste Umgestaltung des Platzes „Magnusblick“ zum Kreuzungspunkt der touristischen Straßen Entsiegelung, versickerungsfähige Oberfläche, Begrünung, Beschattung
- In Prüfung: Umstellung der Versorgung des Kneippbeckens in Bad Faulenbach von Trinkwasser auf Naturwasser (Notburgaquelle oder Alatseeleitung) Ressourcensparsamkeit
- Entwicklung der „Pyramidengasse“ zu einem „Rad-Hub“ / zentralen und attraktiven Rad-Parkplatz nachhaltige Mobilität
- Interreg-people2people-Projekt zur Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit
Zeitplanung:
- Präsentation des Projektgedankens und der Zielsetzungen in der Stadtratssitzung am 28.01.2025 zur Erreichung einer grundsätzlichen Zustimmung zu:
- Klimapartnerschaft mit der Stadtgemeinde Reutte mit dem Interreg-Projekt als Starter-Projekt
- Beauftragung der Detailausarbeitung der o.g. Entwicklungsbausteine
- Stadtratssitzung am 25.02.2025:
- Beratung und Verabschiedung der Detailausarbeitung
- Beauftragung der Förderantragstellung durch FTM
- Anschließend:
- Sicherstellung der Zustimmung des Verwaltungsrates von FTM
- Weitere Ausarbeitung
- Förderantragstellung; Frist: 31.03.2025
Zur ergänzenden Information: Der Wasserverbrauch des Sieben-Stein-Brunnens mit nur 3 von 7 Steinen hat im Jahr 2024 einen Frischwasserverbrauch von 803.000 Liter Wasser ergeben. Hier ist dringender Handlungsbedarf.
Beschlussvorschlag
- Der Stadtrat befürwortet ausdrücklich eine Klimapartnerschaft mit der Stadtgemeinde Reutte/Tirol
- generell zum Erfahrungsaustausch und gemeinsamen Lösen von Aufgaben in den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung
- speziell zur Entwicklung und Umsetzung eines Förderprojektes zu Klimaanpassung mit den Schwerpunkten Entsiegelung, Energieeffizienz und Ressourcensparsamkeit
- Der Stadtrat befürwortet eine klimaangepasste Entwicklung des Kaiser-Maximilian-Platzes als Beitrag zu einer verantwortungsvollen und zukunftsgerichteten Stadtentwicklung sowie zur Behebung städtebaulicher Defizite und von Sanierungsbedarf. Dieses Projekt soll Füssens Kernbaustein für das grenzüberschreitende Förderprojekt mit der Stadtgemeinde Reutte werden.
- Der Stadtrat beauftragt die Stadtverwaltung mit der Ausarbeitung eines ersten Konzeptes zur Umsetzung der beschriebenen Projektbausteine am Kaiser-Maximilian-Platz.
Das Konzept wird in der Februar-Sitzung des Stadtrates zur Beratung vorgelegt.
Diskussionsverlauf
Dr. Metzger befürwortet die Idee Klimastadt zu werden. Für die Klimaanpassung müsse die Stadt ohnehin mehr grüne Bereiche entwickeln. In der Vergangenheit wurde viel zerstört, eine Begrünung im Stadtgebiet wäre sicherlich umsetzbar. Er hält auch weiterhin an einer bereits angeregten Baumschutzsatzung fest, damit im privaten Bereich die Begrünung geschützt wird.
Stadtrat Doser schlägt vor, besser mit einem Starterpaket anzufangen. Eine Baumschutzsatzung schreibt vielleicht zu stark die Persönlichkeitsrechte der Bürger vor.
Stadtrat Waldmann erkundigt sich beim Tourismusdirektor, welche Voraussetzungen bis März dieses Jahres erfüllt werden müssen, um den Förderantrag fristgerecht einzureichen.
Herr Fredlmeier teilt mit, dass es in der Kürze der Zeit nicht möglich sein wird eine Bürgerbeteiligung anzukurbeln. Es benötigt eine konkrete Vorstellung, was entwickelt werden sollte. Begleitet wird das Konzept von Frau Dietz-Hofmann und den Kompetenzen der Stadträte. Der Versuch eine Kooperation mit Reutte einzugehen wäre es wert. Sollten binnen 4 Wochen die wichtigsten Eckpunkte nicht zusammengestellt werden, war der Versuch der Klimastadt und der interkommunalen Zusammenarbeit mit Reutte zumindest gegeben.
Einigkeit gab es bei den Mitgliedern des Stadtrates zum geplanten Projekt und möchten dieses auch unterstützen immer mit dem Augenmerk auf die finanzielle Situation.
Stadtrat Peresson appelliert an die Stadtverwaltung und Stadtratsmitgliedern einen Städteplaner zu beauftragen.
Der Zweite Bürgermeister Schneider lobt die Zusammenarbeiten zwischen Reutte und Füssen und befürwortet die „Interreg Kooperation“.
Beschluss
- Der Stadtrat befürwortet ausdrücklich eine Klimapartnerschaft mit der Stadtgemeinde Reutte/Tirol
- generell zum Erfahrungsaustausch und gemeinsamen Lösen von Aufgaben in den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung
- speziell zur Entwicklung und Umsetzung eines Förderprojektes zu Klimaanpassung mit den Schwerpunkten Entsiegelung, Energieeffizienz und Ressourcensparsamkeit
- Der Stadtrat befürwortet eine klimaangepasste Entwicklung des Kaiser-Maximilian-Platzes als Beitrag zu einer verantwortungsvollen und zukunftsgerichteten Stadtentwicklung sowie zur Behebung städtebaulicher Defizite und von Sanierungsbedarf. Dieses Projekt soll Füssens Kernbaustein für das grenzüberschreitende Förderprojekt mit der Stadtgemeinde Reutte werden.
- Der Stadtrat beauftragt die Stadtverwaltung mit der Ausarbeitung eines ersten Konzeptes zur Umsetzung der beschriebenen Projektbausteine am Kaiser-Maximilian-Platz.
Das Konzept wird in der Februar-Sitzung des Stadtrates zur Beratung vorgelegt.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 19, Dagegen: 1
Dokumente
Download INTERREG Projekt.pdf
zum Seitenanfang
7. Bebauungsplan S 55 - Mühlbachgasse;
Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange; Verfahrensbeschluss
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
28.01.2025
|
ö
|
beschliessend
|
7 |
Sachverhalt
Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans bestehend aus den textlichen Festsetzungen (Teil A), der Planzeichnung (Teil B), der Begründung (Teil C) und der Vorprüfung des Einzelfalls (Teil D) sowie den wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen konnte gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 31.07.2024 bis einschließlich 16.09.2024 im Internet auf der Homepage der Stadt Füssen unter https://www.stadt-fuessen.de/Bebauungsplan-S-55-Muehlbachgasse eingesehen werden. Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet lagen die voran genannten Unterlagen im Rathaus der Stadt Füssen (Flur des ersten Obergeschosses, Lechhalde 3, 87629 Füssen) während der allgemeinen Öffnungszeiten aus.
Da der Ort der Auslegung nicht barrierefrei erreichbar ist, bestand die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Papierunterlagen oder zur eventuellen Niederschrift einer Stellungnahme unter Telefon 08362/903-151 einen Termin zu vereinbaren. Der Inhalt der Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 BauGB ausliegenden Unterlagen waren auch über das zentrale Internetportal des Freistaats Bayern (https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal/ bzw. https://v.bayern.de/LTMqh) zugänglich gemacht.
Parallel mit der Veröffentlichung fand die Einholung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB auf Grund von § 4a Abs. 2 BauGB statt.
Hinsichtlich der Stellungnahmen des Landratsamts Ostallgäu und zum Denkmalschutz fand am 10.01.2025 eine Besprechung mit den Behördenvertretern statt. Wesentliche Ergebnisse:
- Der Mobilitätshub (Parkhaus) wird in seiner Grundfläche reduziert, so dass der Abstand zur Einfahrt in das Gelände vergrößert wird.
Die oberste Ebene (Dachfläche) soll von Fahrzeugen freigehalten werden, da diese die Ansichten beeinträchtigen. Die Höhe muss unter der Tiroler Straße liegen.
Die Gestaltung soll über einen Architektenwettbewerb gelöst werden.
Der Mühlkanal wird über ein Maßnahmenkonzept dokumentiert; ein Rückbau der Verfüllung ist nicht mehr erforderlich.
Unter diesen Voraussetzungen wird der Planung zugestimmt.
Ergebnisse und Planentwurf siehe Anlagen im Ratsinformationssystem. Abwägung mit Einzelbeschlüssen siehe nachstehend.
Stellungnahmen von Seiten der Öffentlichkeit gingen nicht ein.
Keine Stellungnahmen haben abgegeben:
01 Abwasserzweckverband Füssen
02 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Marktoberdorf
04 Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
05 Bayerische Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen (BSV)
07 Bayer. Landesamt für Umwelt
08 Bund Naturschutz Bayern e.V.
11 Erdgas Allgäu Ost GmbH & Co. KG
12 Feuerwehrkommandant Füssen
14 Gemeinde Eisenberg
15 Gemeinde Hopferau
17 Gemeinde Rieden am Forggensee
22 Kreisbrandrat
23 Kreisfischereiverein Füssen e.V.
27 Landesbund für Vogelschutz
28 Landesverband des bayerischen Einzelhandels
31 Regionalverkehr Allgäu GmbH (RVA)
35 Stadtwerke Füssen
36 Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben e. V.
Stellungnahmen ohne Bedenken oder Anregungen haben abgegeben:
13 Füssen Tourismus und Marketing vom 30.07.2024
16 Gemeinde Pfronten vom 09.08.2024
18 Gemeinde Schwangau vom 09.09.2024
19 Handelsverband Bayern e.V. vom 06.08.2024
20 Handwerkskammer vom 29.08.2024
21 Industrie- und Handelskammer Schwaben vom 06.09.2024
24 Kreishandwerkerschaft vom 29.08.2024
25 Kreisheimatpfleger - Bodendenkmalpflege vom 16.09.2024
Stellungnahmen mit Bedenken oder Anregungen haben vorgebracht:
03 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 06.08.2024
06 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege vom 20.08.2024
26 Kreisheimatpfleger – Baudenkmalpflege, Planungs- und Bauwesen vom 10.09.2024
29 Landratsamt Ostallgäu vom 16.09.2024
32 Regionaler Planungsverband vom 10.09.2024
34 Staatliches Bauamt Kempten vom 19.08.2024
37 Wasserwirtschaftsamt Kempten vom 05.09.2024
Stellungnahmen mit Hinweisen
09 Deutsche Telekom AG vom 05.09.2024
10 Elektrizitätswerk Reutte GmbH & Co.KG vom 06.08.2024
30 Regierung von Schwaben vom 17.09.2024
33 Schwaben Netz GmbH vom 07.08.2024
Planer- und Verwaltungsanregungen
Im Zuge der weiteren Planungen und Abstimmungen haben sich folgende Änderungen ergeben:
Überarbeitung des Baufenster 5 „Mobilitätshub“
Im Rahmen der Überarbeitung des Bebauungsplans S 55 wurde das Baufenster 5, vorgesehen für den Mobilitätshub, angepasst. Die Änderungen basieren auf Abstimmungen zwischen, Vertreter des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege (BLfD), Vertreter des Landratsamts Ostallgäu (LRA), Bürgermeister und Stadtverwaltung sowie dem Eigentümer mit seinen Planern. Die Abstimmung fand am 10.01.2025 statt.
Um den Anforderungen des Orts- und Landschaftsbildes sowie den verkehrstechnischen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, wurde die ursprünglich geplante Ausdehnung des Mobilitätshubs gekürzt und in der Breite angepasst. Zudem wurde festgelegt, dass die maximale Gebäudehöhe die Bundesstraße B17 weiterhin nicht überschreiten darf und stattdessen deren Höhenlage unterschreiten soll. Diese Änderungen sichern eine bessere Einbindung in das bestehende Umfeld und berücksichtigen die Interessen aller beteiligten Akteure. Ergänzend wird in einem städtebaulichen Vertrag sichergestellt, dass das Dach des Parkdecks nicht zum Abstellen von PKW genutzt werden darf.
Einer Überbauung des früheren Mühlgrabens im Bereich des BF 5 wird seitens des BLfD und des LRA Ostallgäu zugestimmt.
Überarbeitung der Freiflächen
Die Überarbeitung der Freiflächen wurde maßgeblich durch die Anpassung des Baufelds 5 und die damit einhergehenden Anforderungen an Stellplatzkapazitäten beeinflusst. Hierbei wurde der bestehende Stellplatz westlich des Baufelds 6 in die Planung integriert. Zusätzlich wurde die Möglichkeit weitere Stellplatzmöglichkeiten entlang der Nord- und Südpassage sowie im Bereich des Eingangsplatzes geschaffen.
Diese Anpassungen gewährleisten eine bedarfsgerechte und funktionale Nutzung der Freiflächen in Verbindung mit dem gekürzten Mobilitätshub, die sowohl den verkehrlichen Anforderungen als auch der Aufenthaltsqualität im Plangebiet gerecht werden.
Anpassung Baugrenze von Baufeld 9
Zwischen dem BF 2.1 und BF 9 befindet sich eine Verbindungsbrücke im Bestand, welche durch die Erweiterung der Baugrenzen von BF 9 eingefangen wurden. Dies gewährleistet eine zugefügte Verbindung der zwei Gebäude.
Zahl der notwendigen Stellplätze
Im Rahmen der Novellierung der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der im ersten Modernisierungsgesetz vorgesehenen Anpassungen im Stellplatzrecht wurden die Anforderungen an die notwendige Anzahl an Stellplätzen überprüft und entsprechend überarbeitet. Das Ziel ist es, im Einklang mit der novellierten GaStellV eine zeitgemäße, rechtssichere und bedarfsgerechte Regelung zu gewährleisten, die sicherstellt, dass die im Landesrecht vorgesehene Anzahl an Stellplätzen (Anhang zur GaStellV) nicht überschritten werden. Die erforderliche Anzahl an Stellplätze wurden in Anlehnung an die GaStellV überarbeitet und an den absehbaren Bedarf angepasst.
Zulässige Gebäudehöhen
Die zulässigen Gebäudehöhen wurden im Zuge einer umfassenden Überprüfung im Planungsverlauf angepasst. Grundlage hierfür waren ein Abgleich mit historischen Plänen, den Daten der Bayerischen Landesvermessung sowie einem präzisen digitalen Aufmaß.
Durch diese Aktualisierung soll sichergestellt werden, dass die Höhenentwicklung der baulichen Anlagen den tatsächlichen Gegebenheiten sowie den historischen und städtebaulichen Rahmenbedingungen entspricht. Die überarbeiteten Gebäudehöhen ermöglichen eine klare und praxisgerechte Festsetzung, die den aktuellen Planungsstand widerspiegelt und eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung unterstützt.
Stellungnahmen mit Bedenken oder Anregungen
Träger öffentlicher Belange
- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - Kaufbeuren vom 06.08.2024
Az.: F2/L2-4612-10-36
|
Stellungnahme
|
Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Bereich Forsten:
Wald i.S.d. § 2 Bundeswaldgesetz (BWaldG) i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG) ist durch den Satzungsbereich des o.g. Bebauungsplans nicht betroffen.
Da sich die neu zu pflanzenden Baumarten im genetischen Austausch mit benachbarten Individuen befinden werden, ist beim Pflanzen von Waldbaumarten das Forstvermehrungsgutgesetz zu beachten. Im § 8 Grünordnung sind die Baumarten, die dem Forstvermehrungsgutgesetz unterliegen mit einem * zu kennzeichnen. Zudem ist auf die Beachtung des Forstvermehrungsgutgesetzes hinzuweisen.
Die Erlaubnispflicht im Sinne von Art. 17 BayWaldG wurde aufgenommen.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die Hinweise zum Forstvermehrungsgutgesetz und wird nachrichtlich in § 8 „Grünordnung“ der Satzung die Baumarten als Hinweis kennzeichnen, welche dem Forstvermehrungsgutgesetz unterliegen. Zudem wird ein Passus in den textlichen Hinweisen mit aufgenommen.
|
|
Bereich Landwirtschaft:
Es bestehen keine Einwände.
|
|
|
Beschlussvorschlag
|
|
Die Hinweise zum Bebauungsplan werden entsprechend der fachlichen Würdigung/ Abwägung redaktionell um einen Passus zum Forstvermehrungsgutgesetz ergänzt. Ebenso wird in der festgesetzten Artenliste auf die Baumarten, welche dem Forstvermehrungsgutgesetz unterliegen, hingewiesen.
|
|
Beschluss: _20_:_0__
|
- Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege vom 20.08.2024
Az.: P-2023-5293-1_S6
|
Stellungnahme
|
Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, wie folgt Stellung:
|
|
|
Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange:
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege bedankt sich für die erneute Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und hat Kenntnis von den im Anschreiben vom 30.07.2024 mitgeteilten Ergebnissen genommen.
Als Träger des öffentlichen Belangs Denkmalschutz weist das Landesamt auf den bereits im Schreiben vom 22.05.2024 mitgeteilten Änderungsbedarf hin und bekräftigt diesen nochmals.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme und nimmt diese zur Kenntnis. Die Stadt Füssen verweist in Bezug auf den im Schreiben des BLfD vom 22.05.2024 mitgeteilten Änderungsbedarf auf die fachliche Würdigung und Abwägung sowie Beschlussvorlage vom 25.06.2024, welche weiterhin Gültigkeit behält.
|
|
Aus baudenkmalfachlicher Sicht gilt daher weiterhin, den Baukörper des sog. Mobilitätshubs in Richtung der Altstadt von Füssen merklich einzukürzen, um die drohende Beeinträchtigung der prägenden Stadtansicht auf der gegenüberliegenden Flussseite und auf die darin zentral gelegene Klosteranlage St. Mang – eine Denkmalanlage von nationaler Bedeutung – zu minimieren. Auch die bereits vorgebrachten Bedenken gegen eine zusätzliche Nutzung der Dachebenen des sog. Mobilitätshubs als Parkflächen werden nochmals bekräftigt. Dies gilt auch für die stadtbildprägende barocke Filialkirche Unserer Lieben Frau mit der zugehörigen historischen Zeilenbebauung. Das Landesamt für Denkmalpflege weist daher nunmehr abschließend nochmals darauf hin: Auch eine zusätzliche Nutzung der Dachflächen des sog. Mobilitätshubs als Parkplatzzone würde die zum Lech abfallende Geländetopografie stark verändern und die Erlebbarkeit der städtebaulichen Denkmalwerte der historischen Stadttopografie empfindlich beeinträchtigen.
|
Der Wunsch des LfD, den Baukörper des Mobilitätshubs merklich einzukürzen, wurde abschließend nochmals durch eine Machbarkeitsstudie für einen Mobilitätshub geprüft. Im Rahmen des gemeinsamen Abstimmungstermins (Teilnehmer: Vertreter BLfD, Vertreter LRA, Bürgermeister, Vertreter Stadtverwaltung, Eigentümer und Planern) am 10.01.2025 einigten sich die Beteiligten auf eine kürzere Ausführung des Mobilitätshubs. Stattdessen wird der Baukörper in der Breite angepasst, um die notwendigen Stellplätze zu integrieren. Dabei wurde festgelegt, dass die maximale Gesamthöhe des Mobilitätshubs unterhalb der Höhenlage der Bundesstraße B17 bleiben muss und die oberste Parkebene nicht zum Abstellen von PKW genutzt werden darf, um die Blickbeziehungen zur Altstadt Füssen und zum ehemaligen Hanfwerkeareal nicht zu beeinträchtigen.
Der Mobilitätshub bleibt für die Verwirklichung des Urbanes Quartiers mit hoher Aufenthaltsqualität unverzichtbar. Diese Ziele fördern auch das Erscheinungsbild der historischen Baudenkmäler. Das durch den Entfall der obersten Parkebene sowie durch die Reduktion in der Länge entstehende Parkraumdefizit, kann nicht alleine durch eine optimierte Breite kompensiert werden.
Die Überarbeitung der Freiflächen wurde daher maßgeblich durch die Anpassung des Baufelds 5 und die damit einhergehenden Anforderungen an Stellplatzkapazitäten beeinflusst. Hierbei wurde der bestehende Stellplatz westlich des Baufelds 6 in die Planung integriert. Zusätzlich wurden weitere Stellplatzmöglichkeiten entlang der Nord- und Südpassage sowie im Bereich des Eingangsplatzes geschaffen. Diese Anpassungen gewährleisten eine bedarfsgerechte und funktionale Nutzung der Freiflächen in Verbindung mit dem gekürzten Mobilitätshub, die sowohl den verkehrlichen Anforderungen als auch der Aufenthaltsqualität im Plangebiet gerecht werden und stellt den mit BLfD und LRA abgestimmten Kompromiss zwischen dem erforderlichen Parkraum und dem Denkmalschutz dar.
Die Anzahl der notwendigen Stellplätze wurde mit einer von der Stellplatzsatzung der Stadt Füssen abweichenden Festsetzung bereits auf ein vertretbares Minimum reduziert. Weiterhin verpflichtet der städtebauliche Vertrag den Eigentümer zu einem Architektenwettbewerb des Mobilitätshubs, um eine hohe und denkmalgerechte Qualität der Gestaltung zu erreichen. Die Sichtbeziehungen auch von der gegenüberliegenden Lechseite und Brücke nach Füssen sind dadurch sicherzustellen. Eine mögliche Förderung des Wettbewerbs aus Mitteln der Städtebauförderung soll vorab mit der Regierung von Schwaben abgestimmt werden; falls diese keine Förderung in Aussichten stellen kann, kann sich das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) eine Unterstützung vorstellen.
Das ehemalige Hanfwerke Areal hat aktuell die Chance, als Magnus Park eine erhebliche städtebauliche und auch denkmalfachliche Aufwertung zu erfahren, indem die historischen Zeilenbauten wieder freigestellt und mit erheblichem Aufwand saniert und entwickelt werden. Der Magnus Park mit seiner erhaltenswerten Substanz muss ein lebendiger Organismus bleiben. Wenn sich dieser nicht entwickelt, stirbt er.
Die bisherigen Abwägungen beanspruchen weiterhin Gültigkeit:
Die Konsequenz aus den oben genannten städtebaulichen Zielen ist die Bündelung der Stellplätze in einem Mobilitätshub. Für diesen wurden unter Berücksichtigung der oben angeführten städtebaulichen, landschaftlichen und denkmalschutzfachlichen Leitziele verschiedene Standortvarianten untersucht.
Bei dieser Alternativenprüfung wurden folgende Kriterien beachtet:
- denkmalgeschützte Gebäude mit vorgegebenem Raster und beschränkter Statik
- Sicherung von bestehendem Gewerbe (Faserzentrum als Ankermieter des Magnus Parks)
- Einbindung in das historische Ensemble und Landschaft
- hohe Grundwasserstände und schwierige Bodenbeschaffenheit.
Eine Integration des Mobilitätshubs in die historischen Gebäude scheidet aus mehreren Gründen aus. Die historische Bausubstanz weist keine hinreichende Tragkraft auf. Eine statische Ertüchtigung lässt sich weder wirtschaftlich noch denkmalschutzrechtlich darstellen. Darüber hinaus lässt die baukonstruktive Rasterung keine effiziente Parkraumverteilung zu. Die erforderlichen Erschließungsanlagen würden grob verunstaltend wirken und dem Leitziel eines autofreien Quartiers widersprechen.
Konsequenz hieraus ist, dass nur der Neubau eines Mobilitätshubs diesen städtebaulichen Zielen Rechnung tragen kann. Für den Neubau wurden verschiedene Varianten geprüft.
Eine Verortung an der Stelle der südlichen Gewerbehalle scheidet aus. Das ehem. Faserzentrum ist Ende der 1980er Jahre aus Mitteln der Wirtschaftsförderung von Bund und Länder unter Einsatz des damaligen bayrischen Ministerpräsidenten gefördert worden und war Bestandteil einer Kooperation des Freistaats Bayern mit dem Land Baden-Württemberg. Das Faserzentrum sollte in Kooperation mit dem wissenschaftlichen Transferzentrum für nachwachsende Faserrohstoffe in Reutlingen Prozesse der Aufbereitung, der Spinnerei, des Webens, des Färbens und der Ausstattung untersuchen sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit praktischem Bezug für die industrielle Weiterverarbeitung der Flachsfaser im textilen und nichttextilen Bereich leisten (siehe etwa LT-Drs. Baden-Württemberg 10/2488, S. 7). Das Faserzentrum ist damit – wie der Magnus-Park insgesamt – ein Zeugnis bayrischer und baden-württembergischer Industriepolitik und des Niedergangs der deutschen Textilindustrie. Zugleich ist das ehem. Faserzentrum auch heute noch mit dem wichtigsten Ankermieter (Erhart GmbH, Werkzeug- und Gerätebau) des Magnus Park belegt. Eine nachhaltige und wirtschaftlich darstellbare Entwicklung des Quartiers kann nur mit Rücksicht auf die bestehenden Mieter gelingen. Ein Bestandschutz der bestehenden Mieter ist für den Stadtrat neben der Revitalisierung des Gesamtquartiers vorrangiges Planungsziel.
Eine Überbauung der Halle wurde vom Eigentümer geprüft, ist aber aus bautechnischen und statischen Gründen nicht wirtschaftlich darstellbar und wäre auch denkmalfachlich nicht adäquat. Die Anregung, den Mobilitätshub weitestgehend als Verlängerung an die südliche Gewerbehalle zu rücken, nähme der Gewerbehalle ihre zentrale Zufahrt sowie Aufstell- und Wendeflächen, die auch weiterhin jedenfalls für LKW von 7,5 bis jedenfalls 40 t gewährleistet bleiben müssen. Die vorgeschlagene Verortung würden zwar denkmalfachliche Belange noch weiter stärken, zugleich jedoch die Existenz bestandsgeschützter gewerblicher Nutzungen und einen Gewerbebetrieb mit über 50 Arbeitsplätzen, der aktuell Investitionen in Millionenhöhe tätigt, gefährden. Sie scheidet vor diesem Hintergrund aus.
Ergebnis dieser städtebaulichen Ziele und Variantenuntersuchung ist, dass eine Neuerrichtung eines Mobilitätshubs nur an der geplanten Stelle städtebaulich sinnvoll ist und den denkmalschutzfachlichen Ansprüchen des Industrieareals Rechnung trägt.
Die denkmalfachlichen Erwägungen des Landesamtes werden von der Stadt Füssen ernst genommen. Die nun vorliegende Variante spiegelt den mit dem BLfD und LRA abgestimmten Kompromiss der Belange einer städtebaulichen geordneten Revitalisierung des Magnus Parks und den denkmalschutzfachlichen Belangen wieder. Im Übrigen wird darauf verwiesen, dass die denkmalschutzfachlichen Belange auf Ebene der Baugenehmigung noch Berücksichtigung finden werden.
|
|
In Bezug auf den ohne eine seinerzeitige denkmalpflegerische Zustimmung verfüllten denkmalgeschützten Mühlbachgraben wird in den mitgeteilten Ergebnissen positiv erkannt, dass der historische Einlaufbereich zwischen Lechufer und der neuen Straßenzuwegung nun wieder geöffnet werden soll. Im Sinne einer verständlicheren räumlichen Erlebbarkeit des Mühlbachgrabens als ein integraler technischer Bestandteil des ehemaligen Hanfwerkeareals ist es denkmalpflegerisch weiterhin notwendig, zumindest auch den Bereich zwischen der neuen Straßenzuführung und dem sog. Mobilitätshub wieder zu öffnen und in das Freiflächenkonzept aktiv miteinzubeziehen. Eine dauerhafte Teilüberbauung des Mühlbachgrabens durch den sog. Mobilitätshub kann nur dadurch angemessen kompensiert werden.
|
Die Stadt Füssen weist darauf hin, dass die neue Zufahrt im südlichen Bereich der Einmündungstrompete (Höhe Mühlgraben) eine Breite von ca. 28 m hat. Diese zu überbrücken, ist insbesondere angesichts des nachfolgenden Mobilitätshubs weder wirtschaftlich noch planerisch oder städtebaulich sinnvoll. Bei einem Brückenbauwerk würde dies bedeuten, dass eine Fläche von ca. 1060 m² auf einer Tiefe von 72 m (zur derzeit bestehenden B17) überbrückt werden müsste, damit der Mühlgraben in seinem historischen Verlauf wieder hergestellt werden könnte. Die ist zum einen wirtschaftlich nicht darstellbar, zum anderem würde das Brückenbauwerk einen wesentlichen Teil des ehemaligen Mühlgrabens überbrücken und somit nicht erlebbar machen. Letztendlich wären auch bei einem Brückenbauwerk nur zwei marginale Öffnungen erlebbar. Einmal direkt an der Lechseite, wie bisher vorgesehen, und zum anderen östlich des Mobilitätshubs. Der Zwischenbereich „Mobilitätshub und Einmündungstrompete“ wird bautechnisch abgeböscht, da sonst weitere große Betonstützwände sichtbar würden. Innerhalb dieser Grünfläche ist eine Rotbuche als zu erhalten festgesetzt. Hinzu kommen weitere Pflanzbindungen, die zum einem als Alleecharakter den Verlauf des ehemaligen Mühlgrabens wiederspiegeln und zum anderen eine landschaftsbildverträgliche Integration des Mobilitätshubs sicherstellen
Aufgrund dieser Fakten sieht die Stadt Füssen weiterhin von einer Überbrückung ab und wird die Einmündungstrompete als klassisches Bauwerk mit Aufschüttungen und Böschungen herstellen. Die im Bebauungsplan festgesetzte neue Erschließung des Magnus Parks beruht auf einer Vorentwurfsingenieurplanung der Steinbacher Consult. Diese wurde wie bereits öfter angeführt, nicht nur mit dem staatlichen Bauamt, sondern auch mit Vertretern vom LRA und BLfD abgestimmt und aufgrund der topografischen und verkehrsfunktionalen Anforderungen weiter nach Nordosten verlegt worden. Dieses Bauwerk hat zur Folge, dass eine Wiederherstellung des historischen Mühlbachgrabens nur noch im Nordosten der Lechseite wie bisher angedacht möglich ist, da die Einmündungstrompete zum Mobilitätshub abgeböscht werden muss.
Wie bereits mit der Beschlussvoralge vom 25.06.2024 mitgeteilt, wird der Anregung dahingehend Rechnung getragen, dass der Triebwerkskanal im Nordwesten des Plangebiets teilweise topografisch sichtbar gemacht wird und an weiteren fünf Erinnerungspunkten in einer nachfolgenden Freianlagengestaltung eingebunden wird. Dafür wird zwischen Lechbau und Mittelbau die Baugrenze westlich der historischen Verbindungsbrücke erweitert. Die Umsetzung wird in einem städtebaulichen Vertrag geregelt. Hierdurch kann den berechtigten Belangen des Denkmalschutzes Rechnung getragen werden, ohne die bauliche Nutzung und den erschließungsfachlich kritischen Einmündungsbereich zur B17 funktional einzuschränken.
Weiterhin geplant ist die denkmalrechtliche Würdigung des südlichen Mühlgrabens durch den Erhalt von Teilen des historischen Mühlgrabens, welche im östlichen Plangebiet ebenso weiterhin in die Freiflächengestaltung eingebunden und für die Öffentlichkeit erlebbar gemacht werden. Ergänzend werden entsprechende Infotafeln im Westen und Osten aufgestellt.
Die denkmalfachlichen Erwägungen des Landesamtes werden von der Stadt Füssen ernst genommen, haben aber im Rahmen der Abwägung hinter die Belange einer städtebaulichen geordneten Revitalisierung des Magnus Parks zurückzutreten.
Weiterhin wurde beim Arbeitsgespräch am 10.01.2025 von den Vertretern des BLfD und des LRA entschieden, dass der Mühlgraben nachrangig betrachtet werden kann, da eine städtebaulich überzeugende Lösung auf der Bebauungsplanebene gefunden ist. Insbesondere wird hervorgehoben, dass ein Wettbewerb für von großer Bedeutung wäre und der Mühlgraben keine Priorität für eine gute städtebauliche Lösung habe und diese nicht verhindern werde.
|
|
Seitens der Baudenkmalpflege wird folglich nochmals dringend angeregt, auf den genannten Änderungsbedarf planerisch substanziell einzugehen, um den noch bestehenden denkmalpflegerischen Bedenken angemessen Rechnung zu tragen und diese schlussendlich auszuräumen.
|
Die Stadt Füssen betont, dass der Bebauungsplan zur Revitalisierung des Industriegebiets beiträgt, welches derzeit von zunehmend verfallenden und einsturzgefährdeten Baudenkmälern geprägt ist. Durch die geplanten Maßnahmen sollen sowohl der Erhalt als auch die Erlebbarkeit dieser historischen Bauten gesichert werden. Eine grundlegende Umplanung stellt nicht nur die Realisierung des Quartiers in Frage, sondern gefährdet allein durch den Zeitablauf die bedrohte historische Denkmalsubstanz. Eine erfolgreiche wirtschaftliche Wiederbelebung des Areals ist jedoch nur möglich, wenn die verkehrstechnische Erschließung gewährleistet ist und ausreichend Flächen für notwendige Stellplätze zur Verfügung stehen, ohne dass zugleich eines der wesentlichen städtebaulichen Ziele eines autofreien Quartiers mit anspruchsvoller Gestaltung der Freianlagen aufgegeben wird. Durch die überarbeitete und nun vorliegende Planung wurde nun mit dem BLfD und dem LRA ein Konsens gefunden, welcher die Belange des Verkehrs wie auch des Denkmalschutzes vereint.
Angesichts der wiederholt vorgebrachten städtebaulichen Ziele und darauf abgestimmten Maßnahmen, wie aber auch mit den Regelungen des städtebaulichen Vertrags zu ergänzenden denkmalfachlichen Maßnahmen und zum Architektenwettbewerb für das Mobilitätshub sieht die Stadt Füssen die Anforderungen des Denkmalschutzes bestens berücksichtigt.
|
|
Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de).
|
|
|
Auszug aus der Stellungnahme vom 22.05.2024:
|
Auszug aus der Fachlichen Würdigung und Abwägung vom 25.06.2024:
|
|
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, wie folgt Stellung:
|
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
|
|
Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange:
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege hat von den im Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB übermittelten Erläuterungen Kenntnis genommen.
Wir bedanken uns für die Behandlung der in der vorangegangenen Stellungnahme vom 12.12.2023 vorgebrachten Einwendungen. Die vorliegende Entwurfsplanung (Büro Opla, 26.09.2023) zeigt aus Sicht der Denkmalpflege jedoch weiterhin – in zwei Themenfeldern – planerischen Überarbeitungsbedarf.
|
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
|
|
Wenngleich das Erfordernis eines großvolumigen Parkhauses (sog. Mobilitätshub) aus denkmalpflegerischer Sicht vom Grundsatz her seit Beginn der planerischen Überlegungen für das Hanfwerkeareal mitgetragen wurde, bedingt der starke räumliche Wirkungszusammenhang zum Ensemble „Altstadt Füssen“ wie auch zur denkmalgeschützten Barockkirche „Unserer lieben Frau“ weiterhin eine sensiblere Positionierung und Einbettung in die vorhandene Geländetopografie.
Das Landesamt regt daher weiterhin dringend an, den nordöstlichen Trakt des zweigliedrig gehaltenen Parkhauses merklich einzukürzen, und damit die historische Geländetopografie an diesem für das historische Stadtbild so bedeutsamen Bereich weniger zu beeinträchtigen. Diesbezüglich wird angeregt, etwa den südwestlichen Gebäudetrakt mit einem zusätzlichen Untergeschoß auszubilden, um das sichtbare Gebäudevolumen des Parkhauses, ohne zwingende Reduktion der Stellplatzanzahl, in seiner Massivität optisch zu reduzieren.
|
Es wird begrüßt, dass das Landesamt das Erfordernis eines Mobilitätshubs für den Stellplatznachweis anerkennt. Der Vorschlag eines zusätzlichen Untergeschosses scheidet leider aus, da hierdurch die Statik der Stützwand zur B17 beeinträchtigt würde und zum anderen der Unterwasserkanal, der zwingend für den Retentionsraumausgleich erforderlich ist, entgegensteht.
Der Wunsch des LfD, den Baukörper des Parkhauses merklich einzukürzen, wurde wiederholt geprüft. Soll das Konzept eines weitgehend autofreien Quartiers mit hoher Aufenthaltsqualität (die letztlich auch die Baudenkmäler in ihrem Erscheinungsbild stärkt) verwirklicht werden, ist das Mobilitätshub in seinen aktuellen Ausmaßen zwingend erforderlich.
Die bisherigen Abwägungen beanspruchen weiterhin Gültigkeit:
Die Konsequenz aus den oben genannten städtebaulichen Zielen ist die Bündelung der Stellplätze in einem Mobilitätshub. Für diesen wurden unter Berücksichtigung der oben angeführten städtebaulichen, landschaftlichen und denkmalschutzfachlichen Leitziele verschiedene Standortvarianten untersucht.
Bei dieser Alternativenprüfung wurden folgende Kriterien beachtet:
- denkmalgeschützte Gebäude mit vorgegebenem Raster und beschränkter Statik
- Sicherung von bestehendem Gewerbe (Faserzentrum als Ankermieter des Magnus Parks)
- Einbindung in das historische Ensemble und Landschaft
- hohe Grundwasserstände und schwierige Bodenbeschaffenheit.
Eine Integration des Mobilitätshubs in die historischen Gebäude scheidet aus mehreren Gründen aus. Die historische Bausubstanz weist keine hinreichende Tragkraft auf. Eine statische Ertüchtigung lässt sich weder wirtschaftlich noch denkmalschutzrechtlich darstellen. Darüber hinaus lässt die baukonstruktive Rasterung keine effiziente Parkraumverteilung zu. Die erforderlichen Erschließungsanlagen würden grob verunstaltend wirken und dem Leitziel eines autofreien Quartiers widersprechen.
Konsequenz hieraus ist, dass nur der Neubau eines Mobilitätshubs diesen städtebaulichen Zielen Rechnung tragen kann. Für den Neubau wurden verschiedene Varianten geprüft.
Eine Verortung an der Stelle der südlichen Gewerbehalle scheidet aus. Das ehem. Faserzentrum ist Ende der 1980er Jahre aus Mitteln der Wirtschaftsförderung von Bund und Länder unter Einsatz des damaligen bayrischen Ministerpräsidenten gefördert worden und war Bestandteil einer Kooperation des Freistaats Bayern mit dem Land Baden-Württemberg. Das Faserzentrum sollte in Kooperation mit dem wissenschaftlichen Transferzentrum für nachwachsende Faserrohstoffe in Reutlingen Prozesse der Aufbereitung, der Spinnerei, des Webens, des Färbens und der Ausstattung untersuchen sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit praktischem Bezug für die industrielle Weiterverarbeitung der Flachsfaser im textilen und nichttextilen Bereich leisten (siehe etwa LT-Drs. Baden-Württemberg 10/2488, S. 7). Das Faserzentrum ist damit – wie der Magnus-Park insgesamt – ein Zeugnis bayrischer und baden-württembergischer Industriepolitik und des Niedergangs der deutschen Textilindustrie. Zugleich ist das ehem. Faserzentrum auch heute noch mit dem wichtigsten Ankermieter (Erhart GmbH, Werkzeug- und Gerätebau) des Magnus Park belegt. Eine nachhaltige und wirtschaftlich darstellbare Entwicklung des Quartiers kann nur mit Rücksicht auf die bestehenden Mieter gelingen. Ein Bestandschutz der bestehenden Mieter ist für den Stadtrat neben der Revitalisierung des Gesamtquartiers vorrangiges Planungsziel.
Eine Überbauung der Halle wurde vom Eigentümer geprüft, ist aber aus bautechnischen und statischen Gründen nicht wirtschaftlich darstellbar und wäre auch denkmalfachlich nicht adäquat. Die Anregung, den Mobilitätshub weitestgehend als Verlängerung an die südliche Gewerbehalle zu rücken, nähme der Gewerbehalle ihre zentrale Zufahrt sowie Aufstell- und Wendeflächen, die auch weiterhin jedenfalls für LKW von 7,5 bis jedenfalls 40 t gewährleistet bleiben müssen. Die vorgeschlagene Verortung würden zwar denkmalfachliche Belange noch weiter stärken, zugleich jedoch die Existenz bestandsgeschützter gewerblicher Nutzungen und einen Gewerbebetrieb mit über 50 Arbeitsplätzen, der aktuell Investitionen in Millionenhöhe tätigt, gefährden. Sie scheidet vor diesem Hintergrund aus.
Ergebnis dieser städtebaulichen Ziele und Variantenuntersuchung ist, dass eine Neuerrichtung eines Mobilitätshubs nur an der geplanten Stelle städtebaulich sinnvoll ist und den denkmalschutzfachlichen Ansprüchen des Industrieareals Rechnung trägt.
|
|
In gleicher Weise ist es aus Sicht der Denkmalpflege geboten, die Dachflächen des Parkhauses, der bewachsenen Geländetopografie angelehnt, vollflächig zu begrünen. Auszuschließen ist jedenfalls, dass auch die Dachflächen des Parkhauses als Stellplatzflächen verwendet werden, da die vielfältigen Blickbeziehungen im denkmalgeschützten Stadtbild dadurch stark beeinträchtigt werden würden.
|
Die Anregung die Dachflächen zu begrünen, wurde geprüft. Die Begrünung führt ggf. dazu, dass durch einen begrünten Dachaufbau die Blickachse zum Baudenkmal der Filialkirche „Unserer Frau am Berg“ unterbrochen würde.
|
|
Das zweite, aus Sicht der Denkmalpflege im Wortsinn noch offene Themenfeld betrifft den planerischen sowie auch den baulichen Umgang mit dem denkmalgeschützten Mühlbachgraben.
Auch hier regt die Denkmalpflege weiterhin dringend an, zumindest den Abschnitt zwischen Lechmündung und nördlichen Fassadenabschluss des Parkhauses freizulegen und in das Freiflächenkonzept einzubeziehen. Ein Band von lediglich 2-3 Meter würde einem angemessenen wie auch kompromissfähigen Umgang bedauerlicherweise nicht gerecht.
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege respektiert die großen Bemühungen der Stadt Füssen um ein insgesamt schlüssiges und nachhaltiges Gesamtkonzept für das historische Industrieareal und bittet um angemessene Berücksichtigung der nochmals dargelegten Themen.
|
Die Stadt Füssen weist darauf hin, dass in zahlreichen Abstimmungen mit dem Baulastträger der B17 (Staatliches Bauamt) sowie mit Behördenvertretern des Landratsamtes und dem Bayrischen Landesamt für Denkmalpflege geklärt worden ist, dass eine verkehrsgerechte und verkehrssichere Zufahrt (kein spitzer Einmündungswinkel) aufgrund der topografischen Anforderung nur im äußersten Nordosten geboten ist. Darüber hinaus liegt für diesen neuen Erschließungsbereich eine Vorentwurfsplanung zum Straßenbau vor (Steinbacher Consult), die belegt, dass eine gute Verkehrsfunktionalität gegeben ist. Die nach Nordosten verlagerte Zufahrt und Einmündung in die B17 entspricht somit den Forderungen des LRA sowie des StBA KE und ermöglicht eine reduzierte Höhe des Bauwerks.
Die neue Zufahrt hat im südlichen Bereich der Einmündungstrompete (Höhe Mühlgraben) eine Breite von ca. 28 m. Diese zu überbrücken, ist insbesondere angesichts des kurz anschließenden Mobilitätshubs weder wirtschaftlich noch planerisch sinnvoll. Bei einem Brückenbauwerk würde dies bedeuten, dass eine Fläche von ca. 1060 m² auf einer Tiefe von 72 m (zur derzeit bestehenden B17) überbrückt werden müsste, damit der Mühlgraben in seinem historischen Verlauf wieder hergestellt werden könnte. Die ist zum einen wirtschaftlich nicht darstellbar, zum anderem würde das Brückenbauwerk einen wesentlichen Teil des ehemaligen Mühlgrabens überbrücken und somit nicht erlebbar machen. Letztendlich wären auch bei einem Brückenbauwerk nur zwei marginale Öffnungen erlebbar. Einmal direkt an der Lechseite, wie bisher vorgesehen, und zum anderen nordöstlich des Mobilitätshubs von ca. 14 Meter. Diese kleinteilige Erlebbarkeit steht in keinem Verhältnis zum voraussichtlichen Aufwand.
Aufgrund dieser Fakten sieht die Stadt Füssen von einer Überbrückung ab und wird die Einmündungstrompete als klassisches Bauwerk mit Aufschüttungen und Böschungen herstellen. Die im Bebauungsplan festgesetzte neue Erschließung des Magnus Parks beruht auf einer Vorentwurfsingenieurplanung der Steinbacher Consult. Diese wurde wie bereits öfter angeführt, nicht nur mit dem staatlichen Bauamt, sondern auch mit Vertretern vom LRA und BLfD abgestimmt und aufgrund der topografischen und verkehrsfunktionalen Anforderungen weiter nach Nordosten verlegt worden. Dieses Bauwerk hat zur Folge, dass eine Wiederherstellung des historischen Mühlbachgrabens nur noch im Nordosten der Lechseite wie bisher angedacht möglich ist, da die Einmündungstrompete zum Mobilitätshub abgeböscht werden muss.
Der Stellungnahme wird dahingehen Rechnung getragen, dass der Triebwerkskanal im Nordwesten des Plangebiets teilweise topografisch sichtbar gemacht wird und an weiteren fünf Erinnerungspunkten in einer nachfolgenden Freianlagengestaltung eingebunden wird. Dafür wird zwischen Lechbau und Mittelbau die Baugrenze westlich der historischen Verbindungsbrücke erweitert. Die Umsetzung wird in einem städtebaulichen Vertrag geregelt. Hierdurch kann den berechtigten Belangen des Denkmalschutzes Rechnung getragen werden, ohne die bauliche Nutzung und den erschließungsfachlich kritischen Einmündungsbereich zur B17 funktional einzuschränken.
Weiterhin geplant ist die denkmalrechtliche Würdigung des südlichen Mühlgrabens durch den Erhalt von Teilen des historischen Mühlgrabens, welche ebenso weiterhin in die Freiflächengestaltung eingebunden und für die Öffentlichkeit erlebbar gemacht werden, im östlichen Plangebiet. Ergänzend werden entsprechende Infotafeln im Westen und Osten aufgestellt. .
|
|
Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de).
|
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
|
|
Beschlussvorschlag
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt eine Änderung des Bebauungsplans. Die erforderliche Anzahl an Stellplätze wurden in Anlehnung an die GaStellV überarbeitet.
|
|
Beschluss: _20_:_0__
|
- Kreisheimatpfleger – Baudenkmal – Landkreis Ostallgäu vom 10.09.2024
|
Stellungnahme
|
Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Sonstige fachliche Information und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage.
|
|
|
Seitens der Kreisheimatpflege ist der Mobilitätshub nach wie vor viel zu massiv und zu dominant und er wirkt sich äußerst negativ auf die historische Umgebung der Stadt Füssen - Filialkirche Unserer Lieben Frau, rückwärtige Zeilenbebauung, Klosteranlage St. Mang - aus. Mit den parkenden Autos auf den Dachflächen wird die ausgeglichene Balance des historischen Umfelds endgültig zerstört. Sollte die Stadt Füssen dennoch an der Planung festhalten ist der Denkmalschutz durch diesen Präzedenzfall zukünftig schwer der Bevölkerung zu vermitteln.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die Stellungnahme und nimmt diese zur Kenntnis.
Der Wunsch, den Baukörper des Mobilitätshubs s merklich einzukürzen und die oberste Ebene nicht zum Parken für Pkw’s zu verwenden, wurde wiederholt geprüft. Soll das Konzept eines weitgehend autofreien Quartiers mit hoher Aufenthaltsqualität (die letztlich auch die Baudenkmäler in ihrem Erscheinungsbild stärkt) verwirklicht werden, ist das Mobilitätshub in seinen aktuellen Ausmaßen mit allen Parkebenen zwingend erforderlich. Ebenso ein zusätzliches Untergeschoss zu errichten scheidet leider aus, da hierdurch die Statik der Stützwand zur B17 beeinträchtigt würde und zum anderen der Unterwasserkanal, der zwingend für den Retentionsraumausgleich erforderlich ist, entgegensteht.
Im Rahmen des gemeinsamen Abstimmungstermins (Teilnehmer: Vertreter BLfD, Vertreter LRA, Bürgermeister, Vertreter Stadtverwaltung, Eigentümer und Planern) am 10.01.2025 einigten sich die Beteiligten auf eine kürzere Ausführung des Mobilitätshubs. Stattdessen wird der Baukörper in der Breite angepasst, um die notwendigen Stellplätze zu integrieren. Dabei wurde festgelegt, dass die maximale Gesamthöhe des Mobilitätshubs unterhalb der Höhenlage der Bundesstraße B17 bleiben muss und die oberste Parkebene nicht zum Abstellen von PKW genutzt werden darf, um die Blickbeziehungen zur Altstadt Füssen und zum ehemaligen Hanfwerkeareal nicht zu beeinträchtigen.
Der Mobilitätshub bleibt für die Verwirklichung des Urbanes Quartiers mit hoher Aufenthaltsqualität unverzichtbar. Diese Ziele fördern auch das Erscheinungsbild der historischen Baudenkmäler. Das durch den Entfall der obersten Parkebene sowie durch die Reduktion in der Länge entstehende Parkraumdefizit, kann nicht alleine durch eine optimierte Breite kompensiert werden.
Die Überarbeitung der Freiflächen wurde daher maßgeblich durch die Anpassung des Baufelds 5 und die damit einhergehenden Anforderungen an Stellplatzkapazitäten beeinflusst. Hierbei wurde der bestehende Stellplatz westlich des Baufelds 6 in die Planung integriert. Zusätzlich wurden weitere Stellplatzmöglichkeiten entlang der Nord- und Südpassage sowie im Bereich des Eingangsplatzes geschaffen. Diese Anpassungen gewährleisten eine bedarfsgerechte und funktionale Nutzung der Freiflächen in Verbindung mit dem gekürzten Mobilitätshub, die sowohl den verkehrlichen Anforderungen als auch der Aufenthaltsqualität im Plangebiet gerecht werden und stellt den mit BLfD und LRA abgestimmten Kompromiss zwischen dem erforderlichen Parkraum und dem Denkmalschutz dar.
Durch einen Architektenwettbewerb für den geplanten Mobilitätshub wird sichergestellt, dass sich der geplante Mobilitätshub städtebaulich in die nähere (historische) Umgebung einfügt. Die Stadt Füssen trifft hierzu Regelungen in einem städtebaulichen Durchführungsvertrag.
Aus Sicht der Stadt Füssen ist nicht nachvollziehbar, welche „ausgeglichene Balance des historischen Umfelds“ im status quo erhaltenswürdig erscheint. Die überlieferte DNA des ehemaligen Hanfwerke-Areal ist durch Zwischenbauten entstellt, seine historische Substanz droht zu verfallen. Nicht die Entwicklung des Magnus-Park droht die prägende Stadtansicht zu beeinträchtigen, sondern deren Scheitern. Nur eine Entwicklung des Magus Parks verspricht eine Reparatur des heutigen städtebaulichen Missstands, indem die historischen Zeilenbauten wieder freigestellt und mit erheblichem Aufwand saniert und entwickelt werden. Diese Entwicklung kann erhebliche positive Auswirkungen auch auf die denkmalgeschützte Umgebung (Filialkirche Unserer Lieben Frau und Klosteranlage St. Mang und Hohes Schloss) zeitigen.
Die denkmalfachlichen Erwägungen des Landesamtes werden von der Stadt Füssen ernst genommen. Die nun vorliegende Variante spiegelt den mit dem BLfD und LRA abgestimmten Kompromiss der Belange einer städtebaulichen geordneten Revitalisierung des Magnus Parks und den denkmalschutzfachlichen Belangen wieder. Im Übrigen wird darauf verwiesen, dass die denkmalschutzfachlichen Belange auf Ebene der Baugenehmigung noch Berücksichtigung finden werden.
|
|
Beschlussvorschlag
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt eine Änderung des Bebauungsplans. Die erforderliche Anzahl an Stellplätze wurden in Anlehnung an die GaStellV überarbeitet.
|
|
Beschluss: _20_:_0__
|
- Landratsamt Ostallgäu
- Bauplanungsrecht / Städtebau vom 16.09.2024
|
Stellungnahme
|
Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Bauplanungsrecht/Städtebau und Denkmalschutz:
Zu den Entwurfsunterlagen in der Fassung vom 25.06.2024 nehmen wir wie folgt Stellung:
|
|
|
1. Änderungen zum Vorentwurf in der Fassung vom 19.03.2024
|
|
|
a) Beherbergung (§ 1 Nr. 4 der textlichen Festsetzungen)
Die vorgesehene Regelung im sog. Angebotsbebauungsplan beschränkt den ausnahmsweise zulässigen Beherbergungsbetrieb nicht dauerhaft auf einen bestimmten Hoteltyp.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die Stellungnahme und nimmt diese zur Kenntnis. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass es hierzu klare Stadtratsbeschlüsse gibt, durch die nur ergänzende Tourismussegmente zugelassen werden, wie z. B. Familienhotel, Sporthotel.
Der Bebauungsplan lässt eine Hotelnutzung nur ausnahmsweise zu. Die Erteilung der Ausnahme wird entsprechend der Planbegründung nur dann in Betracht kommen, wenn bestehende Angebotslücken im touristischen Angebot geschlossen werden können (z.B. Familienhotel, Einrichtung mit Leuchtturmcharakter) oder wenn die Hotelnutzung eine Komplementärfunktion zu einer anderen Einrichtung hat (z.B. Gesundheitszentrum, Sporteinrichtung/Leistungszentrum oder Indoor-Freizeitnutzungen mit Übernachtungsmöglichkeit).
Die Erteilung der Ausnahme steht im Ermessen der Stadt Füssen (§ 31 Abs. 1 BauGB). Im weiteren Planungsverlauf konnte nunmehr ein möglicher Betreiber gefunden werden, welcher genau diese touristische Angebotslücke schließen kann und einen Mehrwert für die Stadt- und Tourismusentwicklung bringt. Geplant ist ein Familienhotel, u. a. mit Familienzimmern, Familienrestaurant, Kinderspielzimmer/-anlage und Familien-Wellness. Neben der geplanten Hotelnutzung ist weiterhin auch ein Indoor-Freizeit Angebot auf dem Areal vorgesehen, welches sich bestens mit dem nunmehr geplanten Familienhotel ergänzen würde und von den Hotelgästen genutzt werden könnte.
Dem Ansinnen der Landratsamts, nur bestimmte Hoteltypen zuzulassen, kann damit im Rahmen der Ermessensentscheidung der Stadt Rechnung getragen werden.
|
|
b) Stellplätze (§ 4 Nr. 3 der textlichen Festsetzungen)
Die Stadt Füssen kann über den Bebauungsplan (§ 9 Abs. 4 BauGB i..V.m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO, Art. 47 Abs. 2 Satz 2 BayBO) die Stellplatzanforderungen des Art. 47 Abs. 1 – 3 BayBO konkretisieren, aber keine vom Sinn und Zweck dieser Bestimmung völlig abweichende Regelung treffen.
Kern der Stellplatzregelung ist, dass der Stellplatzbedarf einen Bezug zu einer konkreten Nutzung aufweist, vgl. Art. 47 Abs. 1 Satz 1 und 2 BayBO. Die Stadt kann somit einen von den gesetzlichen Bestimmungen des Art. 47 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Anlage 1 der GaStellV oder der städtischen Stellplatzsatzung abweichenden Stellplatzbedarf in Bezug auf einzelne Nutzungen festsetzen, aber keine Regelung treffen, die keine Bezug zu einer Nutzung aufweist.
Ob Stellplätze doppelt genutzt werden können ist keine Frage der Ermittlung des Bedarfs für die konkrete Nutzung, sondern eine Frage, wo und wie der für die Nutzung bestehende Stellplatzbedarf gedeckt werden kann.
|
Art. 47 Abs. 1 BayBO legt fest, dass für bauliche Anlagen Stellplätze "in ausreichender Zahl" auf dem Baugrundstück oder in der Nähe nachzuweisen sind. Der Bedarf dieser Stellplätze wird dabei direkt an die konkrete Nutzung der baulichen Anlage geknüpft, was bedeutet, dass die Art und Intensität der Nutzung entscheidend dafür ist, wie viele Stellplätze erforderlich sind. Dies ist der Kern der allgemeinen Stellplatzregelung.
Art. 47 Abs. 2 Satz 2 BayBO sieht jedoch vor, dass die Anzahl der notwendigen Stellplätze durch örtliche Bauvorschriften oder eine städtebauliche Satzung konkretisiert werden kann. In dem vorliegenden Fall des Bebauungsplans handelt es sich um eine städtebauliche Satzung nach § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO. Diese Vorschriften geben der Stadt Füssen, die Befugnis, im Rahmen ihrer Planungshoheit eine Zahl der notwendigen Stellplätze festzulegen, die von der GastellV bzw. der Stellplatzsatzung der Stadt Füssen abweichen und damit die allgemeinen Anforderungen von Art. 47 BayBO präzisieren.
Der in der Stellungnahme vorgebrachte Einwand, dass die Stellplatzregelungen nicht völlig vom "Sinn und Zweck" des Art. 47 BayBO abweichen dürfen, ist grundsätzlich richtig. Die Stadt Füssen trägt dem mit einer Neufassung der Festsetzung zur Zahl der notwendigen Stellplätze Rechnung.
Die getroffene Regelung bezweckt, dass nicht unnötig Parkraum generiert wird. Das Urbane Quartier soll eine hohe Aufenthaltsqualität erhalten. Die Festsetzung ergeht vor dem Hintergrund der sich wandelnden Anforderungen des motorisierten Individualverkehrs (Ausbau ÖPNV, Carsharing, Autonome Systeme, etc.) und begrenzt die Anzahl der notwendigen Stellplätze.
|
|
c) Dachgärten (§ 11 Abs. 1 Nr. 1 der textlichen Festsetzungen)
Bisher waren Dachgärten nicht vorgesehen. Nach der geplanten Regelung in § 11 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 sollen im Bereich BF 1.1, BF 2.1 und BF 9 Dachgärten ausnahmsweise zulässig sein. Bei den Bereichen BF 1.1 (Lechbau) und BF 2.1 (Mittelbau) handelt es sich um denkmalgeschützte Gebäude.
Der Bebauungsplan enthält keine Regelung unter welchen Voraussetzungen (Größe, Gestaltung, Nutzung) Dachgärten ausnahmsweise zugelassen werden können.
Eine Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde bzgl. der Anlage von Dachgärten hat bisher nicht stattgefunden. Vielmehr wurde aus denkmalfachlichen Gründen in der Stellungnahme vom 15.12.2023 auf die erforderlichen Regelungen zur Gestaltung der Dacheindeckung und der Anordnung von Dachaufbauten inkl. Solaranlagen hingewiesen.
Insbesondere geht aus den Planunterlagen nicht hervor, ob im Bereich des ausnahmsweise zulässigen Hotels (Lechbau) hier eine Nutzung des Dachbereichs für den Hotelbetrieb (sog. Rooftop) vorgesehen ist.
Eine solche Nutzung ist nach einer ersten Einschätzung mit den denkmalfachlichen Anforderungen, gerade in Hinblick auf die Sichtbeziehungen zum Hohen Schloss und Kloster St. Mang problematisch.
|
Bei einer differenzierten Betrachtung der betroffenen Gebäude wird deutlich, dass die Denkmalschutzbelange weniger strikt greifen, als es die Stellungnahme suggeriert. Im Bereich BF 1.1 (Lechbau) steht nur der östliche Teil des Gebäudes unter Denkmalschutz, während der größere westliche Gebäudeteil lediglich in seiner Kubatur denkmalgeschützt ist. Dies impliziert, dass die Dachflächen des westlichen Teils grundsätzlich weniger stark in die denkmalrechtlichen Anforderungen eingebunden sind. Ebenso ist im Bereich BF 2.1 lediglich der östliche Gebäudeteil denkmalgeschützt, während der mittlere Gebäudeteil keiner denkmalrechtlichen Beschränkung unterliegt und die Fassade des westlichen Teils lediglich in ihrem Erscheinungsbild geschützt ist. Diese Fakten legen nahe, dass die Dachflächen als solche, die nicht unter Denkmalschutz stehen, deutlich größere gestalterische Freiräume bieten.
Darüber hinaus handelt es sich bei den betroffenen Dächern um sehr flach geneigte Dächer, die gestalterisch bereits im Bestand als wenig hochwertig bewertet werden können. Dies spricht dafür, dass die Errichtung von Dachgärten keine wesentliche Beeinträchtigung des denkmalgeschützten Charakters der Gebäude hervorrufen würde. Im Gegenteil könnte eine behutsame und gestalterisch durchdachte Nutzung der Dachflächen eine ästhetische Aufwertung bedeuten, die die Architektur der Gebäude in einem positiven Sinne ergänzt.
Die Frage der Sichtbeziehungen ist von Relevanz. Jedoch stellt die Stadt Füssen nach eingehender Prüfung fest, dass keine relevanten Beeinträchtigungen der Sichtbeziehungen durch die Dachgärten bestehen werden. Da die betroffenen Dächer flach geneigt und gestalterisch unauffällig sind, wäre eine maßvolle Nutzung als Dachgarten, insbesondere bei einer Gestaltung, die die bestehende Architektur respektiert, städtebauliche vorstellbar. Im Übrigen kann der Standpunkt des Landratsamts, wonach die Sichtbarkeit und damit Erlebbarkeit eines Denkmals dessen Erscheinungsbild beeinträchtigt, nicht vollständig nachvollzogen werden. Vom Ort einer denkbaren Dachterrasse bis zu den Einzelbaudenkmälern des Hohen Schlosses und Kloster St. Mang beträgt die Entfernung über 200 m.
Abgesehen davon erfordert eine Nutzung der Dachgärten eine konkrete Prüfung der Gestaltungsdetails in der Ausführungsplanung, welche ohnehin bei konkreten Maßnahmen in enger Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde stattfinden wird (Art. 6 Abs. 3 DSchG). Darüber hinaus weist die Stadt Füssen darauf hin, dass erst nach Vorliegen der konkreten Ausführungsplanung eine Abstimmung mit dem Denkmalschutz sinnhaft ist und selbstverständlich stattfinden wird.
|
|
Die gilt im Übrigen auch für eine Nutzung des Dachbereichs des Mobiltätshubs.
|
Soll das Konzept eines weitgehend autofreien Quartiers mit hoher Aufenthaltsqualität (die letztlich auch die Baudenkmäler in ihrem Erscheinungsbild stärkt) verwirklicht werden, ist das Mobilitätshub zwingend erforderlich. Der Entfall der obersten Parkebene hätte zur Folge, dass das Mobilitätshub noch größer und unmaßstäblicher und unverträglicher gegenüber dem Ensemble der Altstadt Füssen und dem ehemaligen Hanfwerkeareal werden müsste, um die notwendigen Stellplätze unterzubringen. Die Stadt Füssen verweist auf den status quo der von einem ungeschönten Blick aus der Stadt Füssen auf die Stützwand der B17 geprägt wird. Die Entwicklung des Magus Parks ist ohne das Mobilitätshub nicht möglich.
Im Rahmen des gemeinsamen Abstimmungstermins (Teilnehmer: Vertreter BLfD, Vertreter LRA, Bürgermeister, Vertreter Stadtverwaltung, Eigentümer und Planern) am 10.01.2025 einigten sich die Beteiligten auf eine kürzere Ausführung des Mobilitätshubs. Stattdessen wird der Baukörper in der Breite angepasst, um die notwendigen Stellplätze zu integrieren. Dabei wurde festgelegt, dass die maximale Gesamthöhe des Mobilitätshubs unterhalb der Höhenlage der Bundesstraße B17 bleiben muss und die oberste Parkebene nicht zum Abstellen von PKW genutzt werden darf, um die Blickbeziehungen zur Altstadt Füssen und zum ehemaligen Hanfwerkeareal nicht zu beeinträchtigen.
Der Mobilitätshub bleibt für die Verwirklichung des Urbanes Quartiers mit hoher Aufenthaltsqualität unverzichtbar. Diese Ziele fördern auch das Erscheinungsbild der historischen Baudenkmäler. Das durch den Entfall der obersten Parkebene sowie durch die Reduktion in der Länge entstehende Parkraumdefizit, kann nicht alleine durch eine optimierte Breite kompensiert werden.
Die Überarbeitung der Freiflächen wurde daher maßgeblich durch die Anpassung des Baufelds 5 und die damit einhergehenden Anforderungen an Stellplatzkapazitäten beeinflusst. Hierbei wurde der bestehende Stellplatz westlich des Baufelds 6 in die Planung integriert. Zusätzlich wurden weitere Stellplatzmöglichkeiten entlang der Nord- und Südpassage sowie im Bereich des Eingangsplatzes geschaffen. Diese Anpassungen gewährleisten eine bedarfsgerechte und funktionale Nutzung der Freiflächen in Verbindung mit dem gekürzten Mobilitätshub, die sowohl den verkehrlichen Anforderungen als auch der Aufenthaltsqualität im Plangebiet gerecht werden und stellt den mit BLfD und LRA abgestimmten Kompromiss zwischen dem erforderlichen Parkraum und dem Denkmalschutz dar.
|
|
d) Zufahrt
Aus den ergänzenden 3D-Modelldarstellungen geht hervor, dass wohl geplant ist die neu zu errichtende Zufahrt als Damm, ohne Brückenkonstruktion über den Mühlbach, auszubilden. Festzuhalten bleibt, dass mit der neu geplanten Einfahrtstrompete, welche gegenüber der aktuellen Zufahrt nach Südwesten verschoben liegt, der Zufahrtspunkt zum Areal höher liegt als bisher und damit die notwendige Rampenlänge länger und der Damm, in den 3D-Darstellungen ist kein Damm sondern eine senkrechte Stützwand dargestellt, höher als bisher wird.
Inwieweit sich hieraus weitere Beeinträchtigungen in der städtebaulich relevanten Sichtbeziehung auf das Ensemble Altstadt Füssen, insbesondere auf die Häuserzeile am Fuße des Kalvarienbergs mit dem Einzeldenkmal „Unserer Lieben Frau am Berg“, ergeben kann aus den vorliegenden Unterlagen nicht beurteilt werden.
Als Grundlage für die sachgerechte Bearbeitung dieses Punktes wären entsprechende Schnittdarstellungen, z.B. 2x Quer- 1x Längsschnitt, bzw. die vielfach zitierte aber bisher nie vorgelegte Planung der Verkehrsanlage mit Angabe der jeweiligen Neigungen der Verkehrsflächen, den hieraus resultierenden Rampenlängen, Böschungsausbildungen, eventuell erforderliche Stützkonstruktionen, Absturzsicherungen, fußläufige Wegeführung usw. geeignet. Die Unterlagen sind in die Begründung, als Grundlage für die Abwägungsentscheidungen, einzustellen.
|
Die Stadt Füssen weist darauf hin, dass die neue Zufahrt schon immer ohne Brückenkonstruktion geplant war. Dies ging auch schon aus den 3D-Modelldarstellungen der vorausgehenden Beteiligung hervor. Bei den 3D-Modelldarstellungen handelt es sich nicht um ein fotorealistisches 3D Rendering, sondern um eine schematische Darstellung, insbesondere zur Höhenentwicklung, nicht aber zur Darstellung der Freiflächengestaltung oder möglicher Fassaden. Durch eine Abböschung der notwenigen Rampe wird es zu keiner Beeinträchtigung der städtebaulich relevanten Sichtbeziehung zum Ensemble Altstadt Füssen geben. Insbesondere die Häuserzeile am Fuße des Kalvarienbergs mit dem Einzeldenkmal „Unserer Lieben Frau am Berg“ liegt oberhalb der B17 und somit auch über der neuen Zufahrt. Die Abböschungen werden diese also nicht verdecken und sind zudem als Grünflächen anzulegen. Dadurch fügen sich der Baukörper der Zufahrt in das das Landschaftsbild ein. Lediglich im äußersten Osten wird aufgrund der Verschiebung der Zufahrt nach Osten (Anregung vom LRA und BLfD) auf einem Teilbereich eine Stützwand notwendig sein.
Die nach Osten verlagerte Zufahrt und Einmündung in die B17 entspricht den Forderungen des LRA sowie des StBA KE und ermöglicht eine reduzierte Höhe des Bauwerks. Dass das Bauwerk höher wird als die bisherige Erschließung, wurde bereits beim ersten Scoping Termin kommuniziert und ist die Folge eines verkehrssicheren Anschlusses an die B17, welche dem aktuellen Stand der Technik entspricht.
Die Stadt Füssen stellt abschließend fest, dass weiterhin ein 3D-Modell wesentlich aussagekräftiger ist, als einen 2D Schnitt. 3D-Modelle ermöglichen eine realistische Darstellung des städtischen Raums und bilden ein umfassendes Bild der Höhen, Tiefen und Volumina ab, was in 2D-Plänen oft schwer vorstellbar ist. 3D-Modelle sind daher zugänglicher und ansprechender für die breite Öffentlichkeit, was die Beteiligung und Akzeptanz von städtebaulichen Projekten erhöht.
|
|
2. Stellungnahmen vom 15.12.2023 und 24.05.2024
Auf die unten stehenden Stellungnahmen wird nochmals verwiesen. Die dort ausgeführten Bedenken und Einwände, insbesondere zu den denkmalfachlichen Belangen wurden bisher nicht im erforderlichen Umfang berücksichtigt.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die Stellungnahme und verweist auf die nachfolgenden Fachlichen Würdigungen / Abwägungen vom 19.03.2024 sowie vom 25.06.2024, die weiterhin Gültigkeit beanspruchen.
|
|
Die Begründung und auch die Vorprüfung im Einzelfall befassen sich inhaltlich im Wesentlichen mit den Baudenkmäler im Plangebiet. Die Auswirkungen insbesondere durch den Mobilitätshub und die neue geplante Zufahrt auf das Ensemble Altstadt Füssen, hier die vor allem den Bereich der Lechvorstadt und, auf das Baudenkmal Kirche „Unseren Lieben Frau am Berg“, das Baudenkmal Kloster Sankt Mang und das landschaftsprägende Baudenkmal „Hohes Schloss“ werden hier nicht entsprechend dargestellt.
|
Die Stadt Füssen weist darauf hin, dass in der Begründung unter Nr. 6.8 die Kultur und Sachgüter (Ensemble, Bodendenkmal, Einzelbaudenkmäler) beschrieben werden. Ebenso wird unter Nr. 7.4 Denkmalschutz die Sichtbeziehungen zwischen dem Magnus Park, der Füssener Altstadt mit ihren Einzelbaudenkmälern des Hohen Schlosses thematisiert. Gleiches gilt für die Vorprüfung des Einzelfalls. Unter Nr. 2.5 sowie 2.6.9 sind die Kultur und Sachgüter behandelt. Mit der Abwägung dieser Einwendungen hat sich die Stadt eingehend mit den Einzelbaudenkmälern befasst. Die Begründung wird diesbezüglich ergänzt.
|
|
Es stellt sich die Frage, ob die denkmalfachlichen Belange, auch vor dem Hintergrund des Staatsziels (Art. 141 Abs. 2 BV), von der Stadt Füssen als Trägerin der Planungshoheit entsprechend Ihre Bedeutung bewertet wurden?
Auf das Urteil des BayVerfG vom 22.07.2008-Vf. 11-VII-07.
|
In Art. 141 Abs. 2 der Verfassung des Freistaats Bayern steht: „[…] Gemeinden […] haben die Aufgabe, die Denkmäler […], der Geschichte […] zu schützen und zu pflegen, herabgewürdigte Denkmäler […] der Geschichte möglichst ihrer früheren Bestimmung wieder zuzuführen, […].
Der vorliegende Bebauungsplan der Stadt Füssen, der die Revitalisierung einer Industriebrache mit zahlreichen Baudenkmälern vorsieht, lässt sich aus denkmalfachlicher Sicht sehr positiv bewerten. Die Maßnahmen tragen sowohl dem Staatsziel des Denkmalschutzes gemäß Art. 141 Abs. 2 der Bayerischen Verfassung als auch den Zielsetzungen eines zeitgemäßen und nachhaltigen Städtebaus Rechnung. Die städtebaulichen Missstände im ehemaligen Hanfwerke-Areal werden repariert, die historische und denkmalfachlich geschützte Zeilenstruktur wieder erlebbar gemacht und damit innerhalb des Quartiers ein herabgewürdigtes Denkmal seiner historischen Bedeutung wieder angenähert. Der Bebauungsplan trägt Art. 141 Abs. 2 BV damit im Gegenteil Rechnung. Der vorgesehene autofreie Charakter der neuen Bebauung und die damit verbundene gesteigerte Erlebbarkeit der Baudenkmäler stellen einen beachtlichen Fortschritt dar, der den denkmalfachlichen Belangen gerecht wird und einen wertvollen Beitrag zur Pflege des historischen Erbes der Stadt leistet.
Die Kernfrage, ob die denkmalfachlichen Belange in der Planung ausreichend berücksichtigt wurden, lässt sich klar bejahen. Die Stadt Füssen, als Trägerin der Planungshoheit, hat ihre Verpflichtung nach Art. 141 Abs. 2 BV ernst genommen. Die Verfassung fordert nicht nur den Schutz, sondern auch die Pflege und, wenn möglich, die Wiederzuführung herabgewürdigter Denkmäler zu ihrer früheren Bestimmung. In diesem Sinne wird durch die Revitalisierung der denkmalgeschützten Bauten die Grundlage geschaffen, die historische Substanz zu erhalten und neu zu beleben, was dem verfassungsmäßigen Auftrag entspricht.
Ohne den geplanten Bebauungsplan und die damit verbundene Instandsetzung droht den Denkmälern der schleichende Verfall. Der Einsatz des privaten Grundstückseigentümers in diesem Fall ist nicht nur begrüßenswert, sondern für den Erhalt der historischen Bausubstanz unerlässlich. Ungeachtet staatlicher Anreize (Sonderabschreibung) ist, die finanzielle und planerische Beteiligung privater Akteure eine notwendige Ergänzung, um Denkmäler langfristig vor dem Verfall zu bewahren und sie in einen modernen Nutzungskontext zu überführen.
Ein weiterer Aspekt, der im Rahmen der Abwägung positiv hervorsticht, ist die Aufwertung der Blickbeziehungen und des Landschaftsbildes. Die optische und räumliche Integration von Baudenkmälern in die umgebende Landschaft ist ein wesentlicher Bestandteil des Denkmalschutzes. Durch die geplante Revitalisierung wird nicht nur der Bestand gesichert, sondern auch die ästhetische und historische Verbindung der Bauten zur Landschaft nachhaltig verbessert. Diese Maßnahmen tragen zur Schaffung eines hochwertigen stadträumlichen Umfelds bei, das der Bedeutung der Denkmäler – insbesondere auch des Hohen Schlosses und Klosters St. Mang – gerecht wird und ihre kulturelle und geschichtliche Relevanz für die Allgemeinheit stärker ins Bewusstsein rückt.
Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass die Stadt Füssen die denkmalfachlichen Belange im Rahmen der Planung umfassend und den Rahmenbedingungen angemessen berücksichtigt hat. Der Bebauungsplan entspricht nicht nur den verfassungsrechtlichen Anforderungen des Art. 141 Abs. 2 BV, sondern stellt auch sicher, dass die Denkmäler erhalten und für kommende Generationen erlebbar gemacht werden. Ohne die geplante Entwicklung droht ein unwiederbringlicher Verfall der historischen Bausubstanz, der nicht nur für Füssen, sondern für das kulturelle Erbe Bayerns insgesamt einen erheblichen Verlust darstellen würde. Daher ist die Revitalisierung der Industriebrache nicht nur wünschenswert, sondern aus Sicht der Stadt unabdingbar.
Die Stadt dankt für den Hinweis auf die Entscheidung des BayVerfGH. Nach dieser Entscheidung verstößt ein Bebauungsplan erst dann gegen das Willkürverbot in Art. 118 Abs. 1 BV, wenn die Belange des Denkmalschutzes in schlecht hin nicht mehr zu rechtfertigender Weise missachtet werden. Die Belange des Denkmalschutzes sowohl innerhalb als auch außerhalb des Magnus Parks sind vorliegend mit hohem Gewicht in die Abwägung eingestellt worden. Den Denkmalbelangen wurde mit Festsetzungen und ergänzenden vertraglichen Regelungen angemessen Rechnung getragen. Der Vorwurf, dass Denkmalbelange missachtet worden sind, kann nicht nachvollzogen werden.
Der geplante Bebauungsplan verdient daher volle Unterstützung und ist als ein wichtiger Schritt in Richtung eines verantwortungsvollen Umgangs mit dem historischen Erbe der Stadt Füssen zu betrachten.
|
|
Stellungnahme vom 15.12.2023
|
Fachliche Würdigung und Abwägung vom 19.03.2024:
|
|
Das Planungsareal wird im Westen und Norden durch den Wildfluss Lech und im Süden durch den Steilhang des Hutlersberg räumlich und topografisch scharf abgegrenzt. Die einzige Erschließungsmöglichkeit befindet sich an der nach Osten spitz zulaufenden Grundstücksecke, welche aufgrund der nachfolgend exemplarisch dargelegten, zahlreichen Einschränkungen eine städtebaulich schwierige und hoch relevante Engstelle darstellt.
Das ehem. Hanfwerkeareal wird sowohl südöstlich als auch nordöstlich vom Ensemble, „Altstadt Füssen“ umschlossen, was die vielfachen und wichtigen wechselseitigen Sichtbeziehungen unterstreicht. Mit dem Hohen Schloss, dem ehem. Benediktiner Kloster St. Mang, einem Baudenkmal von nationaler Bedeutung, und dem südlichen Abschluss des Ensembles „Altstadt Füssen“, am Fuße des Hutlersberg, nach Westen durch die Filialkirche „unserer Lieben Frau am Berg“ samt Kreuzweg auf den Kalvarienberg begrenzt, dürfte es sich hier um eine der relevantesten Sichtbeziehungen für die Altstadt von Füssen handeln! Insbesondere die stark bewegte Topografie mit Blickbeziehungen auch von höher gelegenen Standorten wie z.B. Baumgarten, Hohes Schloss, Kloster St. Mang, Lechhalde, Hutlers- und Kalvarienberg erfordert eine sehr differenzierte und fachlich fundierte Betrachtung und Bearbeitung der wichtigen wechselseitigen Beziehungen. Zudem stellt das Areal der ehem. Hanfwerke Füssen AG mit der zugehörigen, nördlich der historischen Altstadt gelegenen, Arbeiterwohnsiedlung einen wichtigen und anschaulich erhaltenen Baustein in der Stadtentwicklung von Füssen dar, der sowohl in wirtschaftlicher als auch sozialer Hinsicht richtungsweisend war und ist.
Die Engstelle, in ausgesprochen sensibler und exponierter Lage, muss damit eine Vielzahl an Funktionen erfüllen und auch mit dem Thema der sackgassenartigen Erschließung des mit ca. 5,6 ha doch beachtlich großen Areals umgehen. Ziel der Planung muss damit, unter Berücksichtigung der nachfolgend exemplarisch aufgezeigten Rahmenbedingungen, die qualitative Sicherung der städtebaulich hochwertigen Situation sein.
Orts- und Landschaftsbild;
Der südliche Teil des Ensembles Altstadt Füssen ist bzw. war mit seiner einzeiligen Hangbebauung am Fuß des Hutlersbergs sowohl topografisch als auch durch die vorhandenen Grünstrukturen organisch in den Landschaftsraum eingebettet. Mit der nicht genehmigten Veränderung der Zufahrtssituation im Jahr 2016 wurden u.a. die nördlich der Straße vorhandenen Gehölzstrukturen ebenso wie die in Teilbereichen vorhandenen Anböschungen ersatzlos, zugunsten der neuen Erschließungsstraße samt Parkflächen, von der Zufahrt bis auf die Höhe des Mittelbaus nach Westen, entfernt. Damit wurde die mehrere Meter hohe, nach Westen ansteigende, Stützwandkonstruktion der Tiroler Straße freigelegt und der südliche Abschluss des Ensembles mit seinen zahlreichen Einzeldenkmälern optisch aus dem Landschaftskontext herausgerissen. Gerade in der Fernwirkung, von der gegenüberliegenden Lechseite und der Lechbrücke wurde die organische Einbindung durch den grünen Hangfuß gleichsam abgeschnitten und durch den technoiden Sockel eines Verkehrsbauwerks ersetzt.
Trotz der zahlreichen Vorabstimmungen in denen dieser Punkt mehrfach thematisiert wurde befasst sich die vorliegende Planung weiterhin nicht mit dem bekannten Problem und zeigt auch keinerlei Lösungsansätze auf.
Ganz im Gegenteil sieht der vorliegende Entwurf nach wie vor ein sehr groß dimensioniertes Parkhaus bis unmittelbar zur Engstelle vor. Damit wird der bestehende Missstand verschärft, die ohnehin schon stark beengte Zufahrtssituation noch weiter eingeengt und somit die optische Anbindung ebenso wie die Fernwirkung von der gegenüberliegenden Lechseite weiter massiv verschlechtert. Im Nachgang zur letzten Abstimmungsbesprechung vor Ort am 05.04.2023 wurde Seitens des LRA hierzu folgende Anmerkung zu Protokoll gegeben;
„…Zum Parkhaus habe ich angeregt, dass als mögliche, städtebaulich verträglichere, Standorte z.B. das Faserzentrum bzw. eine Position in Verlängerung der nördlich des Faserzentrums gelegenen Gebäudeachse in Frage kommen könnte. Hintergrund ist, dass die extrem beengte und topografisch schwierige Zufahrtssituation zum Gesamtareal hier das Thema des grünen Hangfußes zum Hutlers- und Kalvarienberg als ortsbildprägende Geländeformation mitberücksichtigen muss. Dies insbesondere wegen des gegenüberliegenden Einzeldenkmals von nationaler Bedeutung „ehem. Klosteranlage St. Mang“ und der stadträumlich sehr präsenten, wechselseitigen Sichtbeziehungen von den beiden Lechuferseiten und der Brücke.
Entsprechend habe ich aus städtebaulichen Aspekten darauf gedrängt den Hangfußbereich soweit als möglich von einer weiteren Bebauung frei zu halten und den städtebaulichen Missstand, der mit der jüngsten Freilegung der Stützwandkonstruktion entlang der Tiroler Straße und der Entfernung der ursprünglich vorhandenen Eingrünung entstanden ist, bei den weiteren Planungen wieder zu bereinigen! Hieraus leitet sich auch mein Hinweis zur Verschiebung des Parkhauses so weit als möglich nach Südwesten, weg von der problematischen Engstelle, ab. …“
Eine planerische Bearbeitung der im Frühjahr aufgeworfenen Probleme ist augenscheinlich noch nicht erfolgt. Eine weitgehende Freistellung der Engstelle von unnötigen Funktionen und insbesondere von weiteren baulichen Einengungen wird sowohl in Hinblick auf eine adäquate und attraktive Anbindung des Magnus Park an die Stadt als auch unter städtebaulichen Gesichtspunkten weiterhin als zwingend erforderlich erachtet!
Es ist zwingend eine qualifizierte Freiflächenplanung im Rahmen der Bauleitplanung erforderlich. Eine Verlagerung auf das Einzelgenehmigungsverfahren ist hier nicht zielführend, da es einer umfassenden Gesamtbetrachtung bedarf.
Hier ist auf eine denkmalverträgliche Rückführung der Missstände zu achten und nicht auf eine Verfestigung derselben!
Erschließung, Verkehr, Wegebeziehungen:
Neben einer attraktiven Sichtbeziehung von der Altstadt in das Hanfwerkeareal sowie der verkehrstechnischen Anbindung ist auch eine attraktive fußläufige Anbindung zwingend mit in die Überlegungen aufzunehmen. Hierbei erscheint die Betrachtung des natürlichen Landschaftsraums mit Lech, Ufergehölz sowie einer möglichst natürlich in Erscheinung tretenden, begrünten Hangfußausbildung von besonderer Bedeutung.
In der weiteren Planung ist somit der Platzbedarf für eine attraktive fußläufige Erschließung inkl. der erforderlichen, zugehörigen Grundordnungsmaßnahmen mit darzustellen.
Die in der Besprechung vom 05.04.2023 vereinbarte Reduktion bzw. grundsätzliche städtebaulich verträgliche Umstrukturierung der Parkierung ist nicht erfolgt. Aus der angegebenen Stellplatzermittlung, je 260 m² sanierter BGF ein Stellplatz ist weder der rechnerisch ermittelte Bedarf dargelegt noch die Anzahl der erforderlichen Parkplätze ausgewiesen. Ebenso fehlt die Angabe wie die Parkhausgröße aus dem sich ergebenden Stellplatzbedarf ermittelt wurde und welche dezentralen Parkmöglichkeiten hier mitberücksichtigt wurden. Die vorgesehene Regelung berücksichtigt nicht, den von der konkreten Nutzung abhängenden stark differenzierenden Stellplatzbedarf. Ein produzierender Gewerbebetrieb mit wenigen Beschäftigten hat bei gleicher Grundfläche einen ganz anderen Stellplatzbedarf, wie z.B. eine Gaststätte mit umfangreicher Außengastronomie. Im Übrigen fehlt für diese Regelung im Bebauungsplan eine Rechtsgrundlage und ein sachgerechter Vollzug im Baugenehmigungsverfahren wäre nicht möglich. Im Baugenehmigungsverfahren wird bei Baumaßnahmen und Nutzungsänderungen nur der zusätzliche Stellplatzbedarf betrachtet. Eine Differenzierung, ob die den Stellplatzbedarf auslösende Maßnahme in einem sanierten, unsanierten, neugebauten oder auf einer Freifläche stattfindet, ist hier ohne Belang.
Denkmalschutz:
Mit Bescheid vom 27.12.2016, Gz. 40-659/16 wird die Wiederöffnung des ohne denkmalrechtlich Erlaubnis verfüllten ehem. Triebkanals angeordnet. Auf die Aspekte wie der Triebkanal wieder anschaulich hergestellt werden kann, vgl. zahlreiche Vorbesprechungen, wird nicht eingegangen. Dieser Punkt ist noch fachlich und inhaltlich nachzuarbeiten. Vgl. hierzu Ergänzung zum Protokoll der Besprechung vom 05.04.2023;
„… Von meiner Seite wurde nicht geäußert, dass über eine Überbauung des denkmalgeschützten Mühlgrabens gesprochen werden kann. Korrekt ist, dass ich mitgeteilt habe, dass der Vollzug der Rückbauanordnung, im Einvernehmen mit Frau Hummel, seiner Zeit ausgesetzt wurde um die Situation anhand eines zeitnah zu erstellenden städtebaulichen Gesamtkonzeptes, das auch konkret auf die denkmalfachlichen Aspekte eingeht, ganzheitlich zu beurteilen. Erst auf Grundlage dieses Entwicklungskonzeptes und einer entsprechend geänderten Stellungnahme des BLfD kann dann seitens des LRA eine Neubeurteilung der Situation mit dem verfüllten Mühlbach und der angestrebten Planung erfolgen. …“
Ohne die Abarbeitung und Klärung der vielfach vorbesprochenen Punkte erscheint die vorliegende Planung derzeit in Frage gestellt.
Zur Beurteilung noch zu ergänzende Unterlagen:
Abschließend bleibt festzuhalten, dass der vorliegende Planungsentwurf wesentliche Punkte der Vorabstimmung nicht bearbeitet bzw. geklärt hat und auch die zur Verfügung gestellten Unterlagen keine fachlich inhaltliche Beurteilung ermöglichen.
Neben der Bearbeitung und Klärung der aufgeführten Punkte sind zumindest Geländeschnitte im Bereich der Zufahrt, des östlichen sowie westlichen Endes des geplanten Parkhauses erforderlich. In den Schnitten ist der Ansatz des Steilhangs zum Hutlerberg, inkl. schematischer Darstellung der Ensemblegebäude, die Tirolerstraße inkl. Stützwand, Gehweg und Absturzsicherung, die neuen Zufahrt, das Parkhaus sowie das Planungsareal bis zum Lech darzustellen.
Für die Feinabstimmung der Zufahrtssituation sowie aller weiteren Maßnahmen erscheint ein Geländeeinsatzmodell zur Überprüfung der städtebaulichen Überlegungen und Planungen als sehr geeignet und grundsätzlich erforderlich. Schnitte und 3D Darstellungen lassen eine sichere Beurteilung der schwierigen Zugangssituation nicht bzw. nur sehr bedingt zu. Gerade auch für die Einbindung der Öffentlichkeit in ein solch wichtiges Projekt ist ein Modell, dass der Öffentlichkeit im Rahmen der Beteiligung präsentiert wird, von Bedeutung.
Einzelne Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung
Bei Festsetzung eines Urbanen Gebiets im Rahmen eines Angebotsbebauungsplans für ein begrenztes Areal in Hand eines Projektträgers, sollte auf jeden Fall eine Feinsteuerung nach Art. 6a Abs. 4 BauNVO erfolgen und sich das angestrebte Mischungsverhältnis der Hauptnutzungen entsprechend niederschlagen. Sofern der Masterplan hier bereits eine entsprechende Differenzierung enthält, sollte diese im Bebauungsplan berücksichtigt werden.
Eine Regelung zu den einzelnen Nutzungsarten in einem städtebaulichen Vertrag im Rahmen eines Angebotsbebauungsplans ist nicht ausreichend. Dieser ist für Baugenehmigungsverfahren nicht bindend. Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit ergibt sich bei einem Angebotsbebauungsplan ausschließlich aus dessen Festsetzungen.
Regelungen auf vertraglicher Basis, die auch für das Baugenehmigungsverfahren bindend sind, können nur über einen Durchführungsvertrag als Teil eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans getroffen werden.
Beherbergungsbetriebe (z.B. Hotel) werden ausgeschlossen. Ein Ausschluss einer allgemein zulässigen Nutzung über § 1 Abs. 5 BauNVO stellt einen Grundzug der Planung dar, so dass eine spätere Zulassung im Einzelfall nicht über eine Befreiung im Rahmen von § 31 Abs. 2 BauGB möglich ist, vgl. BVerwG v. 01.11.1999 – 4 B 3/99 Nr. 4. Ferienwohnung sind im geplanten Urbanen Gebiet zulässig, da diese in der Regel als sonstige Gewerbebetriebe gelten, vgl. § 13 a Satz 1 BauNVO.
Maß der baulichen Nutzung:
Die geplante Regelung zur Höhe des Parkhauses ist unzureichend. Oberer Bezugspunkt für die Höhe des Parkhauses soll die Oberkante der Fahrbahn der Bundesstraße B17 sein. Die Lage des oberen Bezugspunkts auf der Bundesstraße B17 wird aber nicht angegeben. Ist oberer Bezugspunkt für die Höhe des Parkhauses die nördliche Außenwand oder die südliche Außenwand? Die Bundesstraße B17 steigt im Bereich des Baufensters um ca. 4,5 m. Die Gebäudehöhe des Parkhauses sollte entweder wie bei den übrigen Gebäuden über eine Gesamthöhe mit definiertem unterem Bezugspunkt (z.B. OK FB EG üNN) oder eine für das Gesamtgebäude geltende Höhe üNN geregelt werden. Auf die denkmalrechtlichen und städtebaulichen Belange bzgl. der möglichen Positionierung und Dimensionierung eines Parkhauses wird nochmals hingewiesen.
Überbaubare Grundstücksflächen:
Die Regelung im letzten Satz von § 3 Abs. 2 Nr. 1 der textlichen Festsetzungen ist unklar. Auf der Nordseite des Baufelds B 2.1 schließt sich das Baufeld 2.4 an. Es gibt also für das Baufeld 2.1 keine nördlichen Baulinie. Im Übrigen ist auch der Mittelbau ein Baudenkmal, so dass ein Rückbau von Außenwänden grundsätzlich ausscheidet.
Gestaltungsregelungen:
Trotz der Tatsache, dass im Geltungsbereich bedeutende Baudenkmäler vorhanden sind und sich entsprechende Baudenkmäler im unmittelbare Umfeld befinden (siehe oben) enthält der Bebauungsplan wenig konkrete Regelung zur Baugestaltung. Zwar ist für Maßnahmen an Baudenkmäler eine denkmalrechtliche Erlaubnis erforderlich und wegen der unmittelbaren Denkmalnähe in der Regel auch für die nicht unter Denkmalschutz stehenden Gebäude, dennoch sollte der Bebauungsplan Regelungen enthalten, die die denkmalfachlichen Anforderungen berücksichtigen. Die Regelung zur Fassadengestaltung sowie zu den Dacheindeckungen ist diesbezüglich zu wenig aussagekräftig. Es handelt sich um Regelungen, die in jedem beliebigen Neubaugebiet üblich sind. Hier sind auf die denkmalfachlichen Belange abgestimmte Festsetzungen zur Fassadengestaltung, den Materialien und Farben der Dacheindeckung sowie der Anordnung von Dachaufbauten inkl. Solarenergieanlagen zu treffen.
Auch die Regelung zur den Werbeanlagen unter § 11 Abs. 3 Nr. 2 der textlichen Festsetzungen lässt keinen Berücksichtigung von denkmalfachlichen Belangen erkennen.
In den Regelungen zur Baugestaltung und zu den Werbeanlagen sollte in Hinblick auf die Verfahrensfreiheit (vgl. Art. 57 Abs 1 Nr. 11 Buchstabe e, Art. 57 Abs. 1 Nr. 12 Buchstabe c und Art. 57 Abs. 2 Nr. 6 BayBO) auf die denkmalrechtliche Erlaubnispflicht hingewiesen werden.
Es werden neben Flachdächern auch geneigte Dächer in Form von Sattel-, Walm- und Zeltdächer zugelassen. Auf die Festsetzung von zulässigen Dachneigungen wird mit dem Hinweis verzichtet, dass sich diese aus der Wandhöhe und Gesamthöhe ergibt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass z.B. beim Baufeld 4 die Festsetzung einer Wandhöhe fehlt und es sich bei den festgesetzten Wandhöhen um Maximalhöhen handelt. Wird also ein Gebäude ersetzt und die zulässige Wandhöhe nicht ausgenutzt, können sich vom Bestand erheblich abweichende Dachneigungen ergeben. Die vorhandenen Dachneigungen sind aufzunehmen und entsprechende Regelungen zu treffen.
In den textlichen Festsetzungen ist lediglich die maximal zulässige Fläche für Terrassen, insbesondere auch Außenbewirtschaftungsflächen getroffen. Regelung zur Gestaltung dieser Bereiche enthält der Bebauungsplan nicht. Gerade für die in der Planzeichnung als Außengastronomiefläche A1 bezeichnete Fläche nördlich des Lechbaus sind konkrete Regelung erforderlich. Diese Außenbewirtschaftungsfläche befindet sich an exponierte Lage mit direktem Sichtbezug vom und zum Kloster St. Mang etc.
In diesem Bereich ist die ehemals vorhandene Eingrünung wieder herzustellen und für die Außengastronomiefläche sind Gestaltungsregelungen (z.B. Bodenbelag, keine festen Überdachungen, keine Nebengebäude zur Bewirtung etc.) zu treffen, die den denkmalfachlichen Belangen Rechnung tragen.
Regelung zum Abstandsflächenrecht:
Nach § 3 Abs. 3 sollen die Abstandsflächenvorschriften des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO keine Anwendung finden. Bestimmt werden sollen die Abstandsflächen durch die festgesetzten Baulinien, Baugrenzen sowie die Regelungen zu den Wand- und Gebäudehöhen. Auf Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO wird verwiesen. Werden Regelungen getroffen, die zu einer Unterschreitung der gesetzlichen Regelabstandsflächen führen, bedarf es hier im Bebauungsplan einer dezidierten Auseinandersetzung mit der Thematik Brandschutz, Belichtung, Besonnung, Teilhabe am sozialen Umfeld. Eine sachgerechte Abarbeitung setzt auch voraus, dass die zulässige Art der baulichen Nutzung berücksichtigt wird. So stellt ein gewerblicher Lagerraum andere Anforderung, als ein Aufenthaltsraum einer Wohnung.
Begründung zum Bebauungsplan
In der Begründung sind die Ziele und Zwecke des Bebauungsplans, sowie seine Auswirkungen darzulegen. Mit der Begründungspflicht soll sichergestellt werden, dass die städtebauliche Rechtfertigung und Erforderlichkeit sowie die Grundlagen der Abwägung in ihren zentralen Punkten dargestellt werden.
In der Fortschreibung der Begründung im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wird auf die oben genannten Ausführungen verwiesen und es sind folgende Punkte zu berücksichtigen bzw. ist die Auseinandersetzung mit folgenden Fragestellungen angezeigt:
- Welche grünordnerischen Maßnahmen wurden getroffen um eine Stärkung der städtebaulichen und denkmalfachlichen Qualität zu erhalten? Bisher ist das aus dem Vorentwurf der Begründung und dem Vorentwurf der Planung nicht ersichtlich. Es muss eine dezidierte Abarbeitung der augenscheinlichen Problemfelder, Zufahrt, Straßenführung, Landschaftsraum, Sichtbeziehungen und Topografie erfolgen.
- Es ist darzulegen wie durch den Bebauungsplan und seine Umsetzung das Ensemble und das Kloster St. Mang, der Landschaftsraum Lech und der Kalvarienberg gestärkt werden. Hierzu findet sich im Vorentwurf noch keine konkrete Aussage. Im Gegenteil ist eine weitere und weitreichende Verunstaltung der vorgefundenen Strukturen durch das Parkhaus zu befürchten.
- Insbesondere bei den gestalterischen Festsetzungen ist darauf einzugehen, wie hier die denkmalfachlichen Anforderungen berücksichtigt wurden.
- Es ist darzulegen, welche Bauabschnitte in welchem zeitlichen Rahmen (Inhalt Masterplan?) vorgesehen sind.
Art des Bebauungsplans:
Für das Projekt, das in der Hand eines Projektträger liegt, würde sich ein vorhabenbezogener Bebauungsplan nach § 12 BauGB anbieten. Sollten einzelne (Teil-)Vorhaben des Projekts noch keinen solchen Verfahrensstand erreicht haben, das hierzu schon umfassende Vorhabenspläne erstellt werden können, wäre es möglich im Rahmen von § 12 Abs. 3a BauGB wie beim derzeit vorgesehenen Angebotsbebauungsplan ein Urbanes Gebiet festzusetzen. Der Projekt-/Vorhabenträger müsste sich im Durchführungsvertrag zur Realisierung der darin beschriebenen Vorhaben verpflichten. Dies hätte den Vorteil, dass die Stadt für einzelne Teilbereiche bestimmte Nutzungen zuweisen könnte und z.B. auch Regelungen zum Parkhaus, sowie der Bau- und Freiraumgestaltung getroffen werden könnten. Die Realisierungszeiträume könnten festgelegt und der Bebauungsplan bei Nichtrealisierung ohne die Gefahr eines Planungsschadens aufgehoben werden, vgl. § 12 Abs. 6 Satz 1 BauGB.
Der Durchführungsvertrag hätte diesbezüglich auch Regelungscharakter im Baugenehmigungsverfahren. Zulässig wären demnach Vorhaben, die den Vorgaben des Bebauungsplans entsprechen und zusätzlich der im Durchführungsvertrag vereinbarten Regelungen.
Sollte sich im Rahmen der Realisierung zeigen, dass einzelne Vorhaben nicht wie geplant realisiert werden sollen oder können, bedarf es, sofern die Bestimmung des Bebauungsplans eingehalten werden, keiner Bebauungsplanänderung, sondern lediglich einer Änderung der Realisierungsverpflichtung im Durchführungsvertrag. Dies würde für die Stadt Rechtssicherheit (die Stadt bekommt das, was im Durchführungsvertrag steht) schaffen und dennoch eine Flexibilität zur Projektanpassung ermöglichen.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die Stellungnahme. Die Ausführungen zur Lage, Topografie, dem Denkmalschutz, Erschließung und Bestand dienen der Kenntnisnahme.
Die Stadt Füssen teilt die Einschätzungen zu den bauleitplanerischen Herausforderungen. Allerdings ist ersichtlich keine städtebauliche hochwertige Situation vorhanden, sondern eine nahezu vollversiegelte Gewerbe- und Indutriebrache. Ziel der Bauleitplanung ist die Schaffung einer städtebaulich hochwertigen Situation.
Die Verlegung der ehemaligen Zufahrt ist notwendig geworden, da die alte Zufahrtsbrücke zum Gewerbe- und Industrieareal nicht mehr tragfähig für den motorisierten Individualverkehr, insbesondere der LKW war. Die aktuell über 100 Mieter und Nutzer des Magnus-Parks drohten ihre einzige wegemäßige Erschließung zu verlieren. Klargestellt wird, dass auch vor Anlage der neuen Zufahrt keine komplette Anböschung an der Stützwand vorhanden war, da zwischen Stützwand und dem ehemaligen Gehölzbestand ein Fußweg für die Arbeiter bestand (s. nachfolgendes Bild). Wie auch das Staatliche Bauamt im Rahmen eines Scoping Termins gefordert hat, muss die Rückverankerungen der Stützwand für regelmäßige Revisionen uneingeschränkt zugänglich sein.
Die geplante Bebauung mit einem Mobilitätshub stellt einerseits die Zugänglichkeit der Rückverankerungen sicher (im städtebaulichen Vertrag abgesichert) und kann andererseits die Einbindung in das Landschaftsbild verbessern (z. B. begrünte Fassade).
Bsp.: Parkhaus TONIPark in Augsburg und einer Grünfassade, Jakob Rope Systems
Bestehender Weg bevor die neue Zufahrt erstellt wurde:
Die der Stellungnahme vorausgegangene Beschreibung der Blickbeziehungen, insbesondere von und zur Filialkirche "unserer Lieben Frau am Berg" war bis dato aufgrund der Gehölze gar nicht möglich (s. nachfolgendes Bild, GoogleStreetview, Privataufnahme).
 Bei dem auf Initiative der Stadt Füssen und Eigentümers einberufenen Scoping-Termin am 05.04.2023 wurde vom Büro OPLA die Charakteristik des Masterplans erläutert. Der städtebauliche Masterplan sowie der daraus entwickelte Bebauungsplan haben gemeinsam das Hauptziel, die bestehende historische Bebauung zu sichern und als solche wieder erlebbar zu machen. Als Ergänzung zum Bestand soll zudem der „Südbau“ in seiner Zeilenstruktur bis auf die Höhe des Lechbaus verlängert werden, wodurch die neue Platzgestaltung beim Eingang des Magnus Parks städtebaulich hervorgehoben wird. Eine strenge Grünordnung betont zudem die Zeilenbebauung. Die notwendigen und öffentlichen Stellplätze sollten nach bisheriger Planung in einem zentralen Mobilitätshub untergebracht werden, sodass das historische Ensemble durch den ruhenden Verkehr nicht beeinträchtigt wird und ein weitestgehend autofreies Quartier mit hochwertiger Freianlagen entstehen kann.
Der angestrebte attraktive urbane Nutzungsmix (Gewerbe, Handwerk, Dienstleitungen, Gastronomie, Indoor-Freizeit Nutzungen, Bildung, ergänzendes Wohnen) benötigt selbst dann eine erhebliche Erhöhung des Stellplatzbedarfs im Magnus Park, wenn von der Stellplatzsatzung der Stadt Füssen abweichende Stellplatzzahlen festgesetzt werden.
Die Anzahl der notwendigen Stellplätze wären selbst um den Preis einer noch weitergehenden Flächenversieglung gegenüber dem Bestand nicht abbildbar. Eine Verteilung der notwendigen Stellplätze im gesamten Quartier stünde zudem im diametralen Widerspruch zu den oben genannten städtebaulichen Zielen einer Aufwertung und Attraktivierung der Freiraumgestaltung und Erlebbarkeit des Industriedenkmals.
Die Konsequenz aus den oben genannten städtebaulichen Zielen ist die Bündelung der Stellplätze in einem Mobilitätshub. Für diesen wurden unter Berücksichtigung der oben angeführten städtebaulichen, landschaftlichen und denkmalschutzfachlichen Leitziele verschiedene Standortvarianten untersucht.
Bei dieser Alternativenprüfung wurden folgende Kriterien beachtet:
denkmalgeschützte Gebäude mit vorgegebenem Raster und beschränkter Statik
Sicherung von bestehendem Gewerbe (Faserzentrum als Ankermieter des Magnus Parks)
Einbindung in das historische Ensemble und Landschaft
hohe Grundwasserstände und schwierige Bodenbeschaffenheit.
Eine Integration des Mobilitätshubs in die historischen Gebäude scheidet aus mehreren Gründen aus. Die historische Bausubstanz weist keine hinreichende Tragkraft auf. Eine statische Ertüchtigung lässt sich weder wirtschaftlich noch denkmalschutzrechtlich darstellen. Darüber hinaus lässt die baukonstruktive Rasterung keine effiziente Parkraumverteilung zu. Die erforderlichen Erschließungsanlagen würden grob verunstaltend wirken und dem Leitziel eines autofreien Quartiers widersprechen.
Konsequenz hieraus ist, dass nur der Neubau eines Mobilitätshubs diesen städtebaulichen Zielen Rechnung tragen kann. Für den Neubau wurden verschiedene Varianten geprüft.
Die Stellungnahme fordert in der Sache einen Rückbau des bestandsgeschützten Gewerbebetriebs Erhart, der aktuell über 50 Arbeitsplätze, der aktuell Investitionen in Millionenhöhe tätigt, verfügt und einer der Ankermieter des Magnus Parks ist. Eine Überplanung des Standortes muss aus Sicht der Stadt Füssen auch die Belange der Wirtschaft und Sicherung und des Erhalts von Arbeitsplätzten Rechnung tragen.
Eine Verortung an der Stelle der südlichen Gewerbehalle scheidet aus. Das ehem. Faserzentrum ist Ende der 1980er Jahre aus Mitteln der Wirtschaftsförderung von Bund und Länder unter Einsatz des damaligen bayrischen Ministerpräsidenten gefördert worden und war Bestandteil einer Kooperation des Freistaats Bayern mit dem Land Baden-Württemberg. Das Faserzentrum sollte in Kooperation mit dem wissenschaftlichen Transferzentrum für nachwachsende Faserrohstoffe in Reutlingen Prozesse der Aufbereitung, der Spinnerei, des Webens, des Färbens und der Ausstattung untersuchen sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit praktischem Bezug für die industrielle Weiterverarbeitung der Flachsfaser im textilen und nichttextilen Bereich leisten (siehe etwa LT-Drs. Baden-Württemberg 10/2488, S. 7). Das Faserzentrum ist damit – wie der Magnus-Park insgesamt – ein Zeugnis bayrischer und baden-württembergischer Industriepolitik und des Niedergangs der deutschen Textilindustrie. Zugleich ist das ehem. Faserzentrum auch heute noch mit dem wichtigsten Ankermieter (Erhart GmbH, Werkzeug- und Gerätebau) des Magnus Park belegt. Eine nachhaltige und wirtschaftlich darstellbare Entwicklung des Quartiers kann nur mit Rücksicht auf die bestehenden Mieter gelingen. Ein Bestandschutz der bestehenden Mieter ist für den Stadtrat neben der Revitalisierung des Gesamtquartiers vorrangiges Planungsziel.
Eine Überbauung der Halle wurde vom Eigentümer geprüft, ist aber aus bautechnischen und statischen Gründen nicht wirtschaftlich darstellbar und wäre auch denkmalfachlich nicht adäquat. Die Anregung, den Mobilitätshub weitestgehend als Verlängerung an die südliche Gewerbehalle zu rücken, nähme der Gewerbehalle ihre zentrale Zufahrt sowie Aufstell- und Wendeflächen, die auch weiterhin jedenfalls für LKW von 7,5 bis jedenfalls 20 t gewährleistet bleiben müssen. Die vorgeschlagene Verortung würden zwar denkmalfachliche Belange noch weiter stärken, zugleich jedoch die Existenz bestandsgeschützter gewerblicher Nutzungen und einen Gewerbebetrieb mit über 50 Arbeitsplätzen, der aktuell Investitionen in Millionenhöhe tätigt, gefährden. Sie scheidet vor diesem Hintergrund aus.
Ergebnis dieser städtebaulichen Ziele und Variantenuntersuchung ist, dass eine Neuerrichtung eines Mobilitätshubs nur an der geplanten Stelle städtebaulich sinnvoll ist und den denkmalschutzfachlichen Ansprüchen des Industrieareals Rechnung trägt.
Das BLfD hat selbst im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens signalisiert, dass die Wiederöffnung des Mühlgrabens kein denkmalschutzfachliches Dogma ist und einer hochwertigen städtebaulichen Entwicklung des Quartiers nicht im Weg stehen soll. Vorrangiges Ziel der Bauleitplanung ist es, die derzeitige historische Bebauung wieder erlebbar zu machen. Weiterhin wolle man die südliche Zeile bis Höhe des Lechbaus verlängern, um die Platzgestaltung beim Eingang des Magnus Parks städtebaulich hervorzuheben. Eine strenge Grünordnung betone zudem die Zeilenbebauung. Die notwendigen und öffentlichen Stellplätze sollten nach bisheriger Planung in einem zentralen Mobilitätshub untergebracht werden, sodass das historische Ensemble durch den ruhenden Verkehr nicht beeinträchtigt wird. Von der Vertreterin und dem Vertreter des Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege wurde zudem betont, dass der Mühlbachgraben nicht im Vordergrund stehe, wenn die städtebauliche Zeilenstruktur als Mehrwert gewonnen werde.
Ergebnis der Vorabstimmung war, dass für die Verfüllung des Mühlgrabens kompensatorische Maßnahmen denkbar sind.
Wie die Stellungnahme selbst feststellt, hat die vorliegende Bauleitplanung eine Vielzahl städtebaulicher Probleme zu bewältigen, welche zueinander in einem Zielkonflikt stehen. Die Stadt hat sich im Rahmen Ihrer kommunalen Planungshoheit eingehende Gedanken zum städtebaulichen Konzept gemacht. Die Verortung des Mobilitätshubs ist an der einzig umsetzbaren Stelle geplant (s. o.).
Die Bauleitplanung trägt den Sanierungszielen der Stadt Füssen Rechnung. Nach den vorbereitenden Untersuchungen der F64 Architekten vom 28.04.2020 wird als städtebauliches Ziel für Verkehr und Erschließung in Kapitel 10.4 die „Entwicklung eines Konzeptes, das den ruhenden Verkehr innerhalb der räumlichen Gegebenheiten des Planungsgebiets sinnvoll ordnet“ und als Maßnahme in Kapitel 11.2 konkret der „Bau einer Parkgarage zur flächensparenden Anordnung der erforderlichen Stellplätze gefordert.“ Diese Sanierungsziele setzt der Bebauungsplan um.
Der Bebauungsplan mit seiner Freiflächenkonzeption verfolgt stringent das Konzept, die historische Zeilenbebauung als Ensemble prägendes Merkmal des historischen Industriealreals herauszuarbeiten und erlebbar zu machen. Der pauschalierte Vorwurf der unqualifizierten Freiflächenplanung spiegelt die subjektive Auffassung des Verfassers der Stellungnahme wieder. Die Stadt teilt diese Auffassung nicht.
Die Stadt sieht durch den vorliegenden Bebauungsplan eine qualifizierte Sicherung und vor allem Stärkung des historischen Charakters und gleichzeitig eine qualitativ hochwertige Freiflächengestaltung. Die überlieferte Gewerbe- und Industriebrache soll durch einen Rückbau von Zwischenbauten in ihrer historischen Zeilenstruktur wieder erlebbar gemacht werden; die geplante Entsiegelung wird die vorhandenen Grünflächen nahezu verdoppeln (+ 47 %).
Die Erschließung des Grundstücks ist durch den neuen Erschließungskörper im Westen gesichert. Die ursprüngliche Planung, den alten Brückenübergang für den Fußgängerverkehr zu erhalten, wurde auf Wunsch des Landratsamtes und ein möglicher öffentlicher Lecherlebnisweg aufgrund fehlender finanzieller Mittel von Seiten der Stadt Füssen verworfen.
Die interne Erschließung sieht einerseits Anlieferungen der einzelnen Gewerbebetriebe mit dem Auto / Transporter / LKW vor, will das Quartier im Übrigen jedoch weitestgehend vom motorisierten Individualverkehr freihalten und die fußläufige Wegeverbindungen durch den Rückbau der Zwischenbauten und des Konzepts eines im Übrigen autofreien Quartiers stärken und ausbauen.
Die Planung sieht im Ergebnis aus der Sicht der Stadt Füssen eine nicht nur ausreichende, sondern deutlich gestärkte, attraktive fußläufige Erschließung vor.
Beim genannten Scoping-Termin wurde keine Vereinbarung zur Reduktion des Mobilitätshubs getroffen. Es wurde vereinbart, die Situation nochmals städtebaulich zu prüfen und den Mobilitätshub nach Möglichkeit entsprechend zu reduzieren bzw. weiter nach Südwesten zu verlagern. Die angeregte Reduktion und Verlagerung des Mobilitätshubs in südwestliche Richtung wurde vom Stadtplanungsbüro OPLA nochmals geprüft. Wie bereits vorausgehend erläutert, ist dies aus Gründen des Denkmalschutzes, Blickbeziehungen und des zu sichernden Gewerbes, insbesondere der bestandsgeschützten Nutzung im ehem. Faserzentrum, nicht möglich.
Die Zahl der notwendigen Stellplätze wurde anhand der zu erwartenden Nutzungen im Urbanen Gebiet und der Stellplatzsatzung der Stadt Füssen überschlägig ermittelt und läge ohne Berücksichtigung der geplanten Indoor-Nutzung allein bei ca. 380 Stellplätzen. Mit der Indoor Nutzung wird die Zahl der notwendigen Stellplätze um mehrere 100 ansteigen. Im Mobilitätshub nachgewiesen würden im best case ca. 360 Stellplätze untergebracht werden. Der Bebauungsplan schöpft mit seiner abweichenden Festsetzung zu den notwendigen Stellplätzen die Reduzierungsmöglichkeiten bereits vollständig aus. Der Einwand der Stellungnahme ist nicht nachvollziehbar.
Die Festsetzungsgrundlage für die Anzahl der notwendigen Stellplätze bietet Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB. Zutreffend ist, dass bei Nutzungsänderungen nur der zusätzliche Stellplatzbedarf nachzuweisen ist. Die Stellungnahme verkennt jedoch, dass zahlreiche bestehende Freiflächen-Stellplätze im Zuge der geplanten Neuordnung des Quartiers entfallen und zu ersetzen sein werden. Die Stadt Füssen kann im Übrigen bei der Festsetzung der Anzahl notwendiger Stellplätze bereits vorsorglich berücksichtigt werden, dass es zu Nutzungsänderungen baulicher Anlagen kommen kann und den damit einhergehenden Mehrbedarf an Stellplätzen schon im Vorhinein festlegen.
Des Weiteren steht die neue Zufahrt durch den verschwenkten Radweg in Abhängigkeit mit dem Mobilitätshub, da der zu versetzende Radweg zu Teilen über dem Mobilitätshub verlaufen muss.
Beim gemeinsamen Scoping-Termin (05.04.2023) von der Vertreterin und dem Vertreter des Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege betont, dass der Mühlbachgraben nicht im Vordergrund stehe, wenn die städtebauliche Zeilenstruktur als Mehrwert gewonnen werde. Durch den geplanten Rückbau der Zwischenbauten sowie der strengen Grünordnung wird dieses städtebauliche Ziel eindeutig erreicht. Des Weiteren wurde beim gemeinsamen Scoping-Termin von Seiten des Landesamtes erklärt, dass der Mühlbachgraben unter Umständen auch auf einer nur begrenzten Länge von zwei bis drei Meter oder am Anfangspunkt (z.B. die Lecheinbuchtung mit 2-3 Meter unter der Brücke) und am Endpunkt (Rückgebäude Kesselhaus) präsentiert werden könne.
Im Gesprächsverlauf hat man sich auf die zwei Standorte Anfang- und Endpunkt verständigt.
Im städtebaulichen Masterplan, welcher beim Scoping-Termin erläutert wurde und Grundlage des Bebauungsplans darstellt, wurden die zwei Standorte zur historischen Würdigung „Lecheinbuchtung unter der Brücke“ und „Rückgebäude Kesselhaus“ dargestellt. An dieser Variante der historischen Würdigung hält der Grundstückseigentümer auch weiterhin fest. Um dieser Planung nochmals Nachdruck zu verleihen werden in der Planzeichnung die zwei Standorte durch Hinweise gekennzeichnet und in der Begründung genauer erläutert.
Eine Öffnung des Mühlgrabens steht zudem im Konflikt mit dem Mobilitätshub-Standort. Wie bereits vorausgehen erläutert, ist ein alternativer Standort für den Mobilitätshub nicht ohne Eingriffe in die Baudenkmäler oder das bestehende und zu haltende Gewerbe möglich.
Der Mühlgraben ist seit Anfang der 90er Jahre mit dem sogenannten Faserzentrum überbaut und im vorderen Bereich bereits seit 2016 verfüllt und als temporäre Erschließung genutzt, da die Bestandsbrücke nicht länger insbesondere für LKW tragfähig war. Die Stadt Füssen erkennt das denkmalfachliche Bestreben, den Mühlgraben wieder zu öffnen, durchaus an, stellt diesen Belang in der Gesamtabwägung mit dem primären Ziel einer Revitalisierung der Industriebrache und Neugestaltung der Freiflächen (Entsiegelung, möglichst autofreies Quartier) jedoch zurück. Die Neuordnung des ruhenden Verkehrs und der Bau einer Parkgarage zur flächensparenden Bündelung der notwenigen Stellplätze setzten die vom Stadtrat beschlossenen Sanierungsziele konsequent um (s. vorbereitende Untersuchungen F64 Kap. 10.4 und 11.2).
Aus Sicht der Stadt Füssen ist die Wiederherstellung des Status Quo ante, also einer Industriebrache mit einem wiedergeöffneten, trockengelegten Graben, die städtebaulich schlechteste Lösung. Die Stadt ist froh, dass ein privater Grundstückseigentümer – zumal in der aktuellen immobilienwirtschaftlichen Situation – bereit ist, mit erheblichen Kapitaleinsatz den heutigen Magnus-Park als städtebaulichen Missstand im Einklang mit den städtebaulichen und Sanierungszielen der Stadt Füssen zu entwickeln.
Es wird ebenso deutlich darauf hingewiesen, dass das bestandsgeschützte ehem. Faserzentrum – seinerseits ein Zeugnis bayerischer Industriegeschichte – einer Wiederherstellung des Mühlgrabens als durchgängiges Fließgewässer, entgegensteht.
Die Stellungnahme erweckt den unzutreffenden Eindruck, dass der Mühlbach als wasserführende Triebkanal wiederhergestellt werden könnte. Dieser wurde im Zuge der Errichtung des ehem. Faserzentrums – einem Förder- und Kooperationsprojekt von Bund, Freistaat Bayern und Land Baden-Württemberg – vor über 30 Jahren endgültig stillgelegt. Seitdem ist kein Fließgewässer mehr vorhanden. Lediglich im Falle eines Hochwassers, wurde der stillgelegte Mühlgraben geflutet. Seit dem letzten Hochwasser war der Mühlgraben nur noch eine Schmutzlache.
Das Faserzentrum ist Ende der 1980er Jahre aus Mitteln der Wirtschaftsförderung von Bund und Länder unter Einsatz des damaligen bayrischen Ministerpräsidenten gefördert worden und war Bestandteil einer Kooperation des Freistaats Bayern mit dem Land Baden-Württemberg. Das Faserzentrum sollte in Kooperation mit dem wissenschaftlichen Transferzentrum für nachwachsende Faserrohstoffe in Reutlingen Prozesse der Aufbereitung, der Spinnerei, des Webens, des Färbens und der Ausstattung untersuchen sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit praktischem Bezug für die industrielle Weiterverarbeitung der Flachsfaser im textilen und nichttextilen Bereich leisten (siehe etwa LT-Drs. Baden-Württemberg 10/2488, S. 7). Das Faserzentrum ist damit – wie der Magnus-Park insgesamt – ein Zeugnis bayrischer und baden-württembergischer Industriepolitik und des Niedergangs der deutschen Textilindustrie. Zugleich ist das ehem. Faserzentrum auch heute noch mit dem wichtigsten Ankermieter (Erhart GmbH, Werkzeug- und Gerätebau) des Magnus Park belegt. Eine nachhaltige und wirtschaftlich darstellbare Entwicklung des Quartiers kann nur mit Rücksicht auf die bestehenden Mieter gelingen. Ein Bestandschutz der bestehenden Mieter ist für den Stadtrat neben der Revitalisierung des Gesamtquartiers vorrangiges Planungsziel.
Eine Überbauung der Halle wurde vom Eigentümer geprüft, ist aber aus bautechnischen und statischen Gründen nicht wirtschaftlich darstellbar und wäre auch denkmalfachlich nicht adäquat. Die Anregung, den Mobilitätshub weitestgehend als Verlängerung an die südliche Gewerbehalle zu rücken, nähme der Gewerbehalle ihre zentrale Zufahrt sowie Aufstell- und Wendeflächen, die auch weiterhin jedenfalls für LKW von 7,5 bis jedenfalls 20 t gewährleistet bleiben müssen. Die vorgeschlagene Verortung würden zwar denkmalfachliche Belange noch weiter stärken, zugleich jedoch die Existenz bestandsgeschützter gewerblicher Nutzungen und einen Gewerbebetrieb mit über 50 Arbeitsplätzen, der aktuell Investitionen in Millionenhöhe tätigt, gefährden. Sie scheidet vor diesem Hintergrund aus.
Der vorliegende Planungsentwurf wurde auf der Grundlage der stattgefundenen Abstimmungen der Fachbehörden, Workshops und Bürgerbeteiligungen sowie auf der Grundlage der nachfolgend angeführten, vertieften Planungen erarbeitet.
Der Bereich der Zufahrt wurde mehrfach mit dem Staatlichen Bauamt abgestimmt. Hierfür wurde eine Vorplanung bis zur LPh 2 ausgearbeitet, um nachweisen und mit dem Staatlichen Bauamt abstimmen zu können, dass der neue Einmündungsbereich den Richtlinien des Straßenbaus entspricht.
Darüber hinaus wurde ein digitales Massenmodell mit Umgebung erarbeitet um die Kubatur des einzigen Neubaus (Mobilitätshub) neben der Zeilenerweiterung Süd beurteilen zu können. Dieses Massenmodell lässt das geplante Mobilitätshub in seiner Kubatur sehr viel besser beurteilen, als dies die vom Landratsamt eingeforderten Geländeschnitte täten.
Insbesondere auch für den Bereich der Zufahrtssituation wurde mit Schemaschnitten die Problematik der Höhenlagen überprüft.
Die Stadt Füssen weist darauf hin, dass immer noch die Stadt die Planungshoheit über die Bauleitplanung hat (Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG) und in eigener Verantwortung, unabhängig vom Projektträger, aber auch den Trägern öffentliche Belange die Baurechtssatzung des Bebauungsplanes festlegt.
Nachdem derzeit ein Nutzungscluster vorhanden ist und auch weiter angestrebt wird, das dem Gebietscharakter des urbanen Gebietes (MU) entspricht, gibt es für die Stadt keine weitere Veranlassung einer Feinsteuerung. Eine Nutzungsmischung muss in einem Urbanen Gebiet – anders als in einem Mischgebiet – nicht zwingend gesichert werden (§ 6a Abs. 1 Satz 2 BauNVO).
Es ist derzeit nicht beabsichtigt, im städtebaulichen Vertrag die Zulässigkeiten des MU noch weiter zu präzisieren und zu gliedern, hierfür liegt weder ein städtebaulicher Grund noch eine kommunale Erforderlichkeit vor.
Die Stadt Füssen hat im Vorfeld der Aufstellung des Bebauungsplanes die Vor- und Nachteile eines Angebotsbebauungsplanes im Vergleich zu einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan intensiv diskutiert und abgewogen.
Nachdem es sich bei dem Planvorhaben nicht um einen klassischen „Grüne-Wiese-Bebauungsplan“ handelt, bei dem im Wesentlichen neues Baurecht geschaffen wird, sondern mit Ausnahme des Mobilitätshubs eine Gewerbe- und Industriebrache als Bestand überplant und unter sensiblem Umgang mit den vorhandenen Bestandsnutzern revitalisiert werden soll, erscheint ein vorhabenbezogener Bebauungsplan nicht zielführend. Der Angebotsbebauung sieht hinreichende Festsetzungen vor, um in diesem Zusammenhang die denkmalschutzwürdigen Zeilen zu sichern und zur erhalten
Der Bebauungsplanentwurf sieht bislang einen Ausschluss des Beherbergungsgewerbes vor. Der Stadtrat der Stadt Füssen mit seinem Beschluss zur Billigung des Vorentwurfs in Aussicht gestellt, dass in Ausnahme von diesem Grundsatz Hotelnutzungen die eine bislang nicht besetzte Nische und Lücke im bestehenden Angebot der Stadt Füssen besetzten könnten (z. B. Familienhotel in Verbindung mit Indoor-Freizeitnutzungen oder Sporthotel für Leistungssportler) vorstellbar wären. Insbesondere Indoor-Freizeiteinrichtungen wären für die Stadt Füssen und ihren Nachbarkommunen eine große Bereicherung. Der Eigentümer ist aufgefordert, hierzu konkrete Konzepte vorzulegen. Diese werden mit der Füssen Tourismus untersucht und abgestimmt.
Die Stadt Füssen dankt im Übrigen für die Anregung zu den Ferienwohnungen, und wird diese bauplanungsrechtlich ausschließen.
Die Sinnhaftigkeit der Festsetzung zur Höhe des Mobilitätshubs ist aus Sicht der Stadt gegeben. Die Oberkante Dachhaut des Mobilitätshubs soll nicht die Oberkante der Fahrbahn der B 17 überschreiten, diese Festsetzung wird noch rechtsbestimmt und rechtsklar umformuliert.
Wenn man sich die Planzeichnung genauer anschaut, hat das Baufeld 2.1 (gesamter Mittelbau von Westen bis zum im Osten liegenden Baufeld 2.4) eine nördliche Baulinie, welche im Bereich des Laborgebäudes (BF 7) unterbrochen wird. Von dieser Baulinie darf aufgrund des Gebäudeversatzes um bis zu 2,0 m abgewichen werden. Ziel ist hierbei, insbesondere im Bereich des mittleren Zwischenbaus Flexibilität einzuräumen. Zum derzeitigen Stand kann nicht abschließend geklärt werden, wo nach dem Rückbau der Zwischenbauten der exakte Wandverlauf liegen wird und wie damit der Gebäudeverlauf fortgeführt wird. Die Stadt möchte zudem darauf hinweisen, dass der Mittelbau nicht im Gesamten unter Denkmalschutz steht. Bei dem westlichen Gebäudeteil (im nachfolgenden Bild mit roter Dachfläche erkennbar) steht lediglich die Fassade unter Denkmalschutz, während der östliche Gebäudeteil (im Bild rosa markiert) ein Gesamtdenkmal darstellt.
 Die Regelung im letzten Satz von § 3 Abs. 2 Nr. 1 der textlichen Festsetzungen soll eben diese Flexibilität zulassen.
Die Stadt Füssen sieht keinen Grund darin konkretere Festsetzungen zur Dachfarbe, Materialität, Fassadengestaltung oder der Anordnung von Dachaufbauten inkl. Solarenergieanlagen zu treffen. Grund dafür ist die ohnehin, wie in der Stellungnahme beschrieben, notwendige denkmalrechtliche Erlaubnis (Art. 6 DSchG). Die Stadt wie auch der Grundstückseigentümer erachten es als zielführender, die einzelnen Bausteine (Gebäudeteile) bei konkreten Maßnahmen in enger Abstimmung mit dem BLfD zu planen. Hinzukommt, dass aktuell nicht absehbar ist, was nach dem Rückbau der Zwischenbauten zum Vorschein kommen wird. Bei der Dachfarbe ist bereits jetzt ein Mix aus braunen, rotbraunen und grauem Farbspektrum vorhanden.
Bzgl. der Dachaufbauten insb. der Solarenergieanlagen wird keine Festsetzung getroffen, da sich der Stand der Technik über die nächsten Jahre hinweg durchaus ändern kann. Auch insoweit wird im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren eine Abstimmung mit dem BLfD vorzunehmen sein.
Selbst das BLfD hat vor diesem Hintergrund keine weitergehenden Festsetzungen eingefordert.
Wie in der Satzung unter § 11 Abs. 3 Nr. 1 zu erkennen ist, sind Werbeanlagen an denkmalgeschützten Anlagen nicht zulässig. Soweit die Stellungnahme ausführt, dass denkmalfachliche Belange nicht berücksichtigt würden, ist dies schlichtweg falsch.
Ein Hinweis auf gesetzliche Regelungen, die auch ohne Hinweis gelten und von der Baugenehmigungsbehörde zu beachten sind, bietet aus Sicht der Stadt keinen Mehrwert.
Die Stellungnahme verkennt, dass im denkmalgeschützten Bestand die genannten Dachformen mit stark unterschiedlichen Dachneigungen vorhanden sind. Der Stellungnahme wird insoweit Rechnung getragen, als für die drei historischen Zeilenbauten eine max. Dachneigung (abgeleitet aus dem Bestand) festgesetzt wird.
Die Stellungnahme unterstellt einen konkreten Vorhabenbezug, den es vorliegend nicht gibt. Die Stadt stellt bewusst einen Angebotsbebauungsplan auf (siehe schon oben).
Die immer wieder angeführten Sichtbeziehungen sind im Frühjahr, Sommer und Frühherbst nicht uneingeschränkt, wie behauptet, vorhanden. Die großen Gehölzstrukturen entlang beider Lechseiten grenzen diese enorm ein. Durch die wieder geforderte Eingrünung, ostwestlich des Lechbaus, würde eine Sichtbeziehung weiter eingeschränkt werden.
Der jetzige Zustand der Außenbereichsflächen der Gewerbe- und Industriebrache mit ihrer weitgehenden Flächenversiegelung, ist nicht einladend und wird durch die geplante Revitalisierung, Flächenentsiegelung und Freianlagengestaltung in jeglicher Hinsicht verbessert. Die Stadt Füssen sieht es daher nicht als notwendig an, auf Ebene des Bebauungsplans die Außenbewirtschaftungsfläche durch Gestaltungsfestsetzungen zu regulieren. Dies kann auch noch auf Ebene des Baugenehmigungsverfahrens im Rahmen der Abstimmung mit dem BLfD erfolgen.
Bei der vorliegenden Bauleitplanung handelt es sich primär um die Revitalisierung der historischen Industriebrache. Ziel ist es, die Zwischenbauten zurückzubauen, um die historischen Zeilenbauten wieder erlebbar zu machen. Die Schutzzwecke der Abstandsflächenvorschriften, namentlich eine hinreichende Belichtung, Belüftung, Besonnung und Sozialstand, werden sämtlich durch den geplanten Rückbau der Zwischenbauten gegenüber dem Status quo verbessert. Die Stadt Füssen weist erneut darauf hin, dass es sich im Wesentlichen um eine bestandgeschützte, in Teilen sogar um eine denkmalgeschützte Bebauung handelt.
Der Bestand wird lediglich an zwei Stellen geringfügig erweitert. Eine der Erweiterungen befindet sich östlich des Südbaus, diese wird zweigeschossig vom BLfD mitgetragen. Der Abstand zum nördlichen Gebäude beträgt ca. 25 m. Zur südlichen Bestandshalle ca. 7,0 m.
Bei einer max. zulässigen Gesamthöhe des Neubaus (östlicher Teilbereich des BF 3.4) von 9,5 m und einer max. Gesamthöhe des nördlichen Mittelbaus (BF 2.1) von 21 m, ergeben sich keine Überscheidungen bei den Abstandsflächen zwischen Süd und Mittelbau. Ebenso gibt es zur südlichen Bestandshalle keine Abstandsflächenüberscheidungen.
Der zweite Neubau, das Mobilitätshub, wird in Teilbereichen direkt an die Stützwand der Tiroler Straße gebaut und ist in seiner Höhenentwicklung begrenzt auf die OK Fahrbahn (Fuß- und Radweg) der Tiroler Straße. Eine Beeinträchtigung (Verschattung) der südlichen Wohngebäude ist nicht gegeben. Nördlich des Mobilitätshubs befinden sich Erschließungs- und Freiflächen. Es kommt auch hier zu keinen Abstandsflächenüberscheidungen.
Der Stadt Füssen ist bekannt, dass die Begründung die Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes darlegt.
Die Begründung wird in Teilen ergänzt und fortgeschrieben. Die Stadt weist erneut darauf hin, dass der Bebauungsplan – vom Mobilitätshub abgesehen – eine Gewerbe- und Industriebrache im baulichen Bestand überplant. Insbesondere weist die Stadt darauf hin, dass durch den festgesetzten Rückbau der Zwischen- und Anbauten der Zeilenbauten sowohl eine immense städtebauliche und denkmalschutzfachliche Qualität erzielt wird.
Die Stellungnahme verschließt die Augen vor dem aktuellen Zustand der Industriebrache, die durch den Bebauungsplan und der anspruchsvollen Freianlagengestaltung sowie das Herausstellen der Zeilenbebauung der Industriedenkmäler und das Konzept eines möglichst weitgehend Kfz-freien Quartiers erheblich verbessert werden wird.
Den Belangen der Denkmalpflege wird durch das Herausarbeiten der historischen Zeilenbebauung nebst unterstützenden Festsetzungen zur Grünordnung und durch diverse Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung angemessen Rechnung getragen. Auch das BLfD fordert keine weitergehenden gestalterischen Festsetzungen. Die Belange des Denkmalschutzes werden im Rahmen der konkreten Bauanträge abgestimmt.
Es wird kein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt, der konkrete Durchführungsfristen fordert. Im Gegenteil soll der Angebotsbebauungsplan eine behutsame Transformation unter Rücksichtnahme auf die über 100 vorhandenen Mieter des Magnus Parks ermöglicht werden.
Die Stadt Füssen hat sich zur Wahl der Verfahrensart eingehend Gedanken gemacht und bewusst für einen Angebotsbebauungsplan entschieden. Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan mit einem starren Plankonzept (Vorhaben- und Erschließungsplan) und denknotwendig harten Durchführungsfristen könnte dem bauleitplanerischen Ziel einer behutsamen Transformation des Magnus-Park unter Rücksicht auf die über 100 im Bestand vorhandenen Nutzer und Mieter der Bestandsgebäude nicht angemessen Rechnung tragen.
Darüber hinaus und abgesehen von dem anscheinen kritisch bewerteten Mobilitätshub geht es in dem Bebauungsplan um Rückbau und im Wesentlichen darum, die Nutzungsbrache im Bestand nach Sanierung zu revitalisieren.
Hier ist der Stadt Füssen mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht gedient, im Gegenteil, nachdem der Eigentümer erst Nutzer aus dem Nutzungsspektrum, das erläutert wurde, finden und die Belegung im Bestand verteilen muss, wäre ein vorhabenbezogener Bebauungsplan, der insbesondere die Nutzungen feinteilig steuert, gänzlich das falsche Instrument, mit dem Ergebnis, dass die Stadt permanenten Änderungsbedarf hat und Bauleitplanungen für Satzungsänderungen durchführen müsste.
Die Stadt dankt für die kritische Anmerkung, behält sich aber vor, ihre Planungshoheit als Kern der kommunalen Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 GG), auch zur Wahl der Verfahrensart, selbst auszuüben.
|
|
Stellungnahme vom 24.05.2024:
|
Fachliche Würdigung und Abwägung vom 25.06.2024:
|
|
|
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Vorabstimmungen mit den Trägern öffentlicher Belange dienen selbstredende dazu, die Abwägungsbelange zu ermitteln und sachgerechten Lösungen zuzuführen.
Die Stadt Füssen erachtet ein 3D-Modell als wesentlich aussagekräftiger als einen 2D Schnitt. 3D-Modelle ermöglichen eine realistische Darstellung des städtischen Raums und bilden ein umfassendes Bild der Höhen, Tiefen und Volumina ab, was in 2D-Plänen oft schwer vorstellbar ist. 3D-Modelle sind daher zugänglicher und ansprechender für die breite Öffentlichkeit, was die Beteiligung und Akzeptanz von städtebaulichen Projekten erhöht.
Das 3D Modell basiert auf einem digitalen Geländemodell, das von der Bayer. Vermessungsverwaltung zur Verfügung gestellt wurde. Der dargestellte Mobilitätshub entspricht dem baurechtlich zulässigen Maß der Nutzung und ist maßstabsgetreu erstellt. Das 3D Modell bildet die Proportionen und die tatsächlichen Höhen des geplanten Moblitätshubs auch unabhängig vom Darstellungsmaßstab ab. Eine Vermaßung des in Modells wird nunmehr in der Begründung ergänzend abgebildet.
In einem Angebotsbebauungsplan können – abgesehen von einer Fassadenbegrünung (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) – keine detaillierten Fassadengestaltungen festgesetzt werden. Die Stadt Füssen wird in einem städtebaulichen Durchführungsvertrag regeln, dass eine qualifizierte Fassadenplanung (ggf. Begrünung) das Mobilitätshub in die nähere Umgebung einfügt.
Eine aktuelle Aufnahme (Aufnahmetag: 12.06.2024) zeigt die (sehr eingeschränkt vorhandenen) Blickbeziehung von der Brücke (Stadt Füssen) zum Magnus Park und dem Denkmal „Unserer Lieben Frau am Berg“:
Abb.: Blick von der Brücke Füssens (Lechhalde) in Richtung Magnus Park, Standort südlicher Brückenabschnitt, 12.06.2024, eigene Aufnahme
Abb.: Blick von der Brücke Füssens (Lechhalde) in Richtung Magnus Park, Standort südlich-mittlerer Brückenabschnitt, 12.06.2024, eigene Aufnahme
Abb.: Blick von der Brücke Füssens (Lechhalde) in Richtung Magnus Park, Standort nördlich-mittlerer Brückenabschnitt, 12.06.2024, eigene Aufnahme
Abb.: Blick von der Brücke Füssens (Lechhalde) in Richtung Magnus Park, Standort nördlicher Brückenabschnitt, 12.06.2024, eigene Aufnahme
Der Wunsch des LRA, den Baukörper des Parkhauses merklich einzukürzen, wurde wiederholt geprüft. Soll das Konzept eines weitgehend autofreien Quartiers mit hoher Aufenthaltsqualität (die letztlich auch die Baudenkmäler in ihrem Erscheinungsbild stärkt) verwirklicht werden, ist das Mobilitätshub in seinen aktuellen Ausmaßen zwingend erforderlich.
Das LRA setzt sich nicht mit den bisherigen Abwägungen auseinander, die weiterhin Gültigkeit beanspruchen:
Die Konsequenz aus den oben genannten städtebaulichen Zielen ist die Bündelung der Stellplätze in einem Mobilitätshub. Für diesen wurden unter Berücksichtigung der oben angeführten städtebaulichen, landschaftlichen und denkmalschutzfachlichen Leitziele verschiedene Standortvarianten untersucht.
Bei dieser Alternativenprüfung wurden folgende Kriterien beachtet:
denkmalgeschützte Gebäude mit vorgegebenem Raster und beschränkter Statik
Sicherung von bestehendem Gewerbe (Faserzentrum als Ankermieter des Magnus Parks)
Einbindung in das historische Ensemble und Landschaft
hohe Grundwasserstände und schwierige Bodenbeschaffenheit.
Eine Integration des Mobilitätshubs in die historischen Gebäude scheidet aus mehreren Gründen aus. Die historische Bausubstanz weist keine hinreichende Tragkraft auf. Eine statische Ertüchtigung lässt sich weder wirtschaftlich noch denkmalschutzrechtlich darstellen. Darüber hinaus lässt die baukonstruktive Rasterung keine effiziente Parkraumverteilung zu. Die erforderlichen Erschließungsanlagen würden grob verunstaltend wirken und dem Leitziel eines autofreien Quartiers widersprechen.
Konsequenz hieraus ist, dass nur der Neubau eines Mobilitätshubs diesen städtebaulichen Zielen Rechnung tragen kann. Für den Neubau wurden verschiedene Varianten geprüft.
Eine Verortung an der Stelle der südlichen Gewerbehalle scheidet aus. Das ehem. Faserzentrum ist Ende der 1980er Jahre aus Mitteln der Wirtschaftsförderung von Bund und Länder unter Einsatz des damaligen bayrischen Ministerpräsidenten gefördert worden und war Bestandteil einer Kooperation des Freistaats Bayern mit dem Land Baden-Württemberg. Das Faserzentrum sollte in Kooperation mit dem wissenschaftlichen Transferzentrum für nachwachsende Faserrohstoffe in Reutlingen Prozesse der Aufbereitung, der Spinnerei, des Webens, des Färbens und der Ausstattung untersuchen sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit praktischem Bezug für die industrielle Weiterverarbeitung der Flachsfaser im textilen und nichttextilen Bereich leisten (siehe etwa LT-Drs. Baden-Württemberg 10/2488, S. 7). Das Faserzentrum ist damit – wie der Magnus-Park insgesamt – ein Zeugnis bayrischer und baden-württembergischer Industriepolitik und des Niedergangs der deutschen Textilindustrie. Zugleich ist das ehem. Faserzentrum auch heute noch mit dem wichtigsten Ankermieter (Erhart GmbH, Werkzeug- und Gerätebau) des Magnus Park belegt. Eine nachhaltige und wirtschaftlich darstellbare Entwicklung des Quartiers kann nur mit Rücksicht auf die bestehenden Mieter gelingen. Ein Bestandschutz der bestehenden Mieter ist für den Stadtrat neben der Revitalisierung des Gesamtquartiers vorrangiges Planungsziel.
Eine Überbauung der Halle wurde vom Eigentümer geprüft, ist aber aus bautechnischen und statischen Gründen nicht wirtschaftlich darstellbar und wäre auch denkmalfachlich nicht adäquat. Die Anregung, den Mobilitätshub weitestgehend als Verlängerung an die südliche Gewerbehalle zu rücken, nähme der Gewerbehalle ihre zentrale Zufahrt sowie Aufstell- und Wendeflächen, die auch weiterhin jedenfalls für LKW von 7,5 bis jedenfalls 40 t gewährleistet bleiben müssen. Die vorgeschlagene Verortung würden zwar denkmalfachliche Belange noch weiter stärken, zugleich jedoch die Existenz bestandsgeschützter gewerblicher Nutzungen und einen Gewerbebetrieb mit über 50 Arbeitsplätzen, der aktuell Investitionen in Millionenhöhe tätigt, gefährden. Sie scheidet vor diesem Hintergrund aus.
Ergebnis dieser städtebaulichen Ziele und Variantenuntersuchung ist, dass eine Neuerrichtung eines Mobilitätshubs nur an der geplanten Stelle städtebaulich sinnvoll ist und den denkmalschutzfachlichen Ansprüchen des Industrieareals Rechnung trägt.
Der Bebauungsplan schafft das Baurecht, das erst auf der Ebene der Ausführungsplanung detailliert werden kann. Die Stadt Füssen weist darauf hin, dass in zahlreichen Abstimmungen mit dem Baulastträger der B17 (Staatliches Bauamt) sowie mit Behördenvertretern des Landratsamtes und dem Bayrischen Landesamt für Denkmalpflege geklärt worden ist, dass eine verkehrsgerechte und verkehrssichere Zufahrt (kein spitzer Einmündungswinkel) aufgrund der topografischen Anforderung nur im äußersten Nordosten geboten ist. Darüber hinaus liegt für diesen neuen Erschließungsbereich eine Vorentwurfsplanung zum Straßenbau vor (Steinbacher Consult), die belegt, dass eine gute Verkehrsfunktionalität gegeben ist. Die nach Nordosten verlagerte Zufahrt und Einmündung in die B17 entspricht somit den Forderungen des LRA sowie des StBA KE und ermöglicht eine reduzierte Höhe des Bauwerks.
Die neue Zufahrt hat im südlichen Bereich der Einmündungstrompete (Höhe Mühlgraben) eine Breite von ca. 28 m. Diese zu überbrücken, ist insbesondere angesichts des kurz anschließenden Mobilitätshubs weder wirtschaftlich noch planerisch sinnvoll. Bei einem Brückenbauwerk würde dies bedeuten, dass eine Fläche von ca. 1060 m² auf einer Tiefe von 72 m (zur derzeit bestehenden B17) überbrückt werden müsste, damit der Mühlgraben in seinem historischen Verlauf wieder hergestellt werden könnte. Die ist zum einen wirtschaftlich nicht darstellbar, zum anderem würde das Brückenbauwerk einen wesentlichen Teil des ehemaligen Mühlgrabens überbrücken und somit nicht erlebbar machen. Letztendlich wären auch bei einem Brückenbauwerk nur zwei marginale Öffnungen erlebbar. Einmal direkt an der Lechseite, wie bisher vorgesehen, und zum anderen nordöstlich des Mobilitätshubs von ca. 14 Meter. Diese kleinteilige Erlebbarkeit steht in keinem Verhältnis zum voraussichtlichen Aufwand.
Aufgrund dieser Fakten sieht die Stadt Füssen von einer Überbrückung ab und wird die Einmündungstrompete als klassisches Bauwerk mit Aufschüttungen und Böschungen herstellen. Die im Bebauungsplan festgesetzte neue Erschließung des Magnus Parks beruht auf einer Vorentwurfsingenieurplanung der Steinbacher Consult. Diese wurde wie bereits öfter angeführt, nicht nur mit dem staatlichen Bauamt, sondern auch mit Vertretern vom LRA und BLfD abgestimmt und aufgrund der topografischen und verkehrsfunktionalen Anforderungen weiter nach Nordosten verlegt worden. Dieses Bauwerk hat zur Folge, dass eine Wiederherstellung des historischen Mühlbachgrabens nur noch im Nordosten der Lechseite wie bisher angedacht möglich ist, da die Einmündungstrompete zum Mobilitätshub abgeböscht werden muss.
Die neue Zufahrt hat im südlichen Bereich der Einmündungstrompete (Höhe Mühlgraben) eine Breite von ca. 28 m. Diese zu überbrücken, ist insbesondere angesichts des kurz anschließenden Mobilitätshubs weder wirtschaftlich noch planerisch sinnvoll.
Die städtebauliche Qualität wird mit der Entwicklung des Magnus Park ein Vielfaches gegenüber dem status quo der Industriebrache erhöht werden.
Der Stellungnahme wird dahingehen Rechnung getragen, dass der Triebwerkskanal im Nordwesten des Plangebiets teilweise topografisch sichtbar gemacht wird und an weiteren fünf Erinnerungspunkten in einer nachfolgenden Freianlagengestaltung eingebunden wird und für die Besucher des Magnus Park erlebbar gemacht wird. Die Umsetzung wird in einem städtebaulichen Vertrag geregelt. Hierdurch kann den berechtigten Belangen des Denkmalschutzes Rechnung getragen werden, ohne die bauliche Nutzung und den erschließungsfachlich kritischen Einmündungsbereich zur B17 funktional einzuschränken.
Das Zitat von Martin/Krautzberger unterschlägt, dass hier lediglich eine Meinung einzelner Auffassungen im Schrifttum wiedergeben wird. Ein Beleg aus der baurechtlichen Kommentarliteratur und insbesondere der Rechtsprechung existiert nicht. Eine Abwägungsdirektive bedürfte einer normativen Grundlage. Der Denkmalschutz wird in § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB als ein zweifellos wichtiger, aber eben auch nur als einer unter mehreren Abwägungsbelangen genannt. Der BayVGH hat hierzu erst jüngst wieder entschieden, dass mit der ausdrücklichen Erwägung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege keine im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigenden Prioritäten eingeführt worden sind (BayVGH, Beschl. v. 20.07.2023, 2 NE 23.1159, Rn. 22 unter Verweis auf BayVGH Urt. v. 19.12.1983, 8 B 81 A.2459; siehe auch Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB. 15. Aufl., § 1 Rn. 62).
Es ist Aufgabe der Gemeinden, die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege in die Abwägung der Bauleitplanung einzustellen. Hierzu sind nicht nur Einzelbaudenkmäler und denkmalgeschützte Ensembles, sondern ist auch eine angemessene Gestaltung zur Umgebung dieser Denkmäler einzubeziehen. Eine Gemeinde ist freilich nicht bloß berechtigt, sondern nach Maßgabe des § 1 Abs. 6 BauGB auch verpflichtet, sich mit diesen Belangen im Wege der Abwägung auseinander zu setzen und diese Belange in Verfolgung städtebaulicher Ziele mit dem Gewicht, das sie ihnen aufgrund der jeweiligen Gegebenheiten beimessen darf, in die Abwägungsentscheidung einzustellen.
Dies ist hier erfolgt: Die Stadt Füssen stellt die denkmalfachlichen Belange mit hohem Gewicht in die Abwägung ein und mutet dem Eigentümer des Areals erhebliche Anstrengungen zu, das Industriedenkmal in seiner ursprünglichen Gestalt der Zeilenbauten wiederherzustellen und für die Öffentlichkeit erlebbar zu machen. Auch auf die umliegenden Baudenkmäler, etwa der Filialkirche „Unserer Lieben Frau am Berg“, wird durch Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung (Zweck: Aufrechterhaltung der Sichtbeziehungen) Rechnung getragen. Die denkmalgeschützte Substanz auf dem Areal des Magnus-Park wird durch den Rückbau der Zwischenbauten und die Freistellung der Baudenkmäler, ergänzend aber auch über vertragliche Regelungen zur Fassadengestaltung, angemessen Rechnung getragen. Weiterhin wird der Mühlgraben im Nordwesten des Plangebiets wiedergeöffnet und angemessen gewürdigt.
Erst die vorliegende Planung ermöglicht es, die bislang durch die Zwischenbauten zwischen den Historischen Zeilen, die nahezu Vollversiegelung der Freianlagen und den desolaten Zustand der Bausubstanz (u. a. ist teilweise der Südbau eisturzgefährdet aufgrund der maroden und undichten Dächer) herabgewürdigte Denkmal zu altem Glanz zu verhelfen und erlebbar zu machen. Hierzu trägt auch das autofreie Konzept im Quartier bei.
Die Stadt Füssen trägt der Anregung Rechnung und weist darauf hin, dass ein Ausschluss von Beherbergungsbetrieben zum damaligen Zeitpunkt bewusst gewählt wurde. Im weiteren Planungsverlauf hat sich nun ein passender Betreiber für ein Nischenhotel gefunden, sodass die ausnahmsweise Zulässigkeit von Beherbergungsbetrieben, die eine Ergänzung von touristischen Angeboten in der Stadt darstellen wiederaufgenommen wird.
Die Stad Füssen nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Der Bebauungsplan regelt bereits jetzt im § 11 Abs. 3 der Satzung enge Grenzen der Zulässigkeit von Werbeanlagen. Eine noch weitere Reglementierung von Werbeanlagen im bisherigen faktischen Gewerbegebiet, welches zu einem Urbanen Gebiet entwickelt werden soll, ist aus Sicht der Stadt Füssen rechtlich problematisch und wäre von der Ermächtigungsgrundlage in Art. 81 BayBO womöglich nicht mehr gedeckt. Die Stadt geht im Rahmen ihrer Abwägung davon aus, einen Sachgerechten Kompromiss zwischen den Belangen des Denkmalschutzes und dem Gebietscharakter des heutigen GE und künftigen MU, in dem gewerbliche Nutzungen zu den generell zulässigen Nutzungen gehören, gefunden zu haben. Eine Kommune unterliegt bei der Reglementierung von Werbeanlagen in einem MU-Gebiet einem erhöhten Rechtfertigungsdruck.
Der Einwendung wird aber dahingehend Rechnung getragen, dass Fremdwerbeanlagen ergänzend ausgeschlossen, d.h. Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung (Eigenwerbung) zugelassen werden. Zudem sind ausnahmsweise Werbeanalgen an denkmalgeschützten Anlagen an der Stätte der Leistung je Gewerbe mit einer Größe von 0,25 m² zulässig.
Die Stadt dankt dem LRA seiner kritischen Anregung. Der Bebauungsplan wird auch im Hinblick auf den Denkmalschutz keine erheblichen (Umwelt-) Auswirkungen haben. Die Entwicklung des Plangebiets wird zu einer Erheblichen Aufwertung der heutigen Industriebrache beitragen, indem die denkmalgeschützte Substanz durch Rückbauten freigestellt wird und die historischen Zeilenbauten sukzessive aufwändig saniert werden. Der Bebauungsplan wird daher positive Auswirkungen auf die Belange des Denkmalschutzes haben. Die denkmalverträgliche Entwicklung wird im Übrigen über Festsetzungen und dem städtebaulichen Vertrag sichergestellt. Das abwägungsbeachtliche Umweltbelange als solche berührt sind, führt entgegen der Auffassung des LRA gerade nicht dazu, dass das beschleunigte Verfahren nicht Durchgeführt werden dürfte. Entscheidend kommt es darauf an, dass der Bebauungsplan keine erheblichen Umweltauswirkungen hat. Ob dies der Fall ist, ist von der Stadt Füssen als Trägerin der Planungshoheit in einer wertenden Entscheidung zu beurteilen.
Die Vorprüfung des Einzelfalls ist zwischenzeitlich fortgeschrieben. Aufgrund der zwischenzeitlichen Fortschreibung der Planung erfolgt eine erneute Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB. Mit der Bekanntmachung werden die Hinweise nach § 13a Abs. 3 BauGB erteilt.
|
|
Beschlussvorschlag
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung wird die Begründung zum Bebauungsplan redaktionell überarbeitet. Weitere Änderungen am Bebauungsplan erfolgen nicht.
|
|
Beschluss: __13_:_7__
|
- Untere Wasserrechtsbehörde vom 16.09.2024
|
Stellungnahme
|
Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage.
|
|
|
Die Stellungnahme, die die Untere Wasserrechtsbehörde am 14.12.2023 abgegeben hat, wird dahingehend modifiziert, dass eine Bebauung im festgesetzten Überschwemmungsgebiet des Lechs einer Ausnahmegenehmigung im Einzelfall gemäß § 78 Abs. 5 WHG bedarf, wobei die dort genannten Voraussetzungen vorliegen müssen.
Zutreffend stellt die Stadt Füssen in der Fachlichen Würdigung/Abwägung lt. Beschlussvorlage vom 07.03.2024 fest, dass kein neues Baugebiet ausgewiesen wird; somit bedarf es keiner Ausnahmegenehmigung für die Bauleitplanung gem. § 78 Abs. 2 WHG.
Im Übrigen verweisen wir auf die Stellungnahmen des WWA Kempten vom 05.09.2024.
|
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, es ist kein Vollzugshindernis des Bebauungsplans erkennbar.
|
|
Beschlussvorschlag
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt eine Änderung des Bebauungsplans. Die erforderliche Anzahl an Stellplätze wurden in Anlehnung an die GaStellV überarbeitet.
|
|
Beschluss: _13_:_7__
|
- Untere Naturschutzbehörde vom 29.09.2024
|
Stellungnahme
|
Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Begründung
Es wird darauf hingewiesen, dass im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB die Eingriffsregelung § 1a Abs. 3 BauGB abzuarbeiten ist, vgl. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB. Der Eingriff bezieht sich auf die Überbauung des Mühlkanal, welche illegal durchgeführt wurde. Eine Eingriffs/ Ausgleichsbilanzierung ist bisher nicht erfolgt, auch nicht in der Vorprüfung des Einzelfalls. Deshalb ist diese vorzulegen.
|
Die vorgebrachte Stellungnahme ist in diesem Zusammenhang nicht nachvollziehbar. Nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB „gelten in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1 Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Absatz 3 Satz 6 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig“. Nach der Fiktion des § 13a Abs. 2 Nr. 4. BauGB sind die zu erwartenden Eingriffe gerade nicht ausgleichspflichtig. Dies folgt zudem auch aus § 1a Abs. 3 S. 6 BauGB: „Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren“.
Dieser Eingriff ist bereits lange vor der aktuellen planerischen Entscheidung erfolgt. Die Planung betrifft eine nahezu vollständig versiegelte Industriebrache, auf der insbesondere auch die Überbauung des Mühlkanals zu großen Teilen bereits in den 1980er Jahren erfolgt ist; der östliche Teil des Mühlkanals ist im März/April 2016 im Zuge der Herstellung einer Behelfszufahrt verfüllt worden. Damit ist der Eingriff faktisch seit vielen Jahren abgeschlossen. Maßgebender Zeitpunkt für die Sach- und Rechtslage ist freilich die Beschlussfassung über den Bebauungsplan (§ 214 Abs. 3 S. 1 BauGB).
Darüber hinaus sind sämtliche relevanten Umweltbelange umfassend ermittelt und sorgfältig bewertet worden. Dies ist detailliert in den Kapiteln 6.1 bis 6.8 der Planbegründung dargelegt, ebenso in der Vorprüfung des Einzelfalls. Weiterhin liegt eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung und eine spezielle artschutzrechtliche Prüfung (saP) vor. Die Anforderungen an eine gerechte Abwägung der Umweltbelange sind erfüllt. Darüber hinaus besteht keinerlei Notwendigkeit, eine gesonderte Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung vorzulegen, da alle umweltrelevanten Aspekte bereits umfassend berücksichtigt wurden.
|
|
6.1 Schutzgebiete
Bei dem widerrechtlich verfüllten Kanal handelt es sich um einen erheblichen Eingriff gem. §14 Abs. 2 BNatSchG. Zumal es einen Lebensraum für Makrozoobenthos, Insekten und temporär auch für Fische darstellt, Eine temporäre Wasserführung wurde durch Inaugenscheinnahme bestätigt. Die Aussage der Mühlgraben sei seit Ende 1980er Jahre nicht mehr wasserführend ist nicht korrekt. lm Zweifelsfall ist die Fachbehörde das WWA Kempten zu befragen.
Für die Säuberung von Verunreinigungen ist der Betreiber verantwortlich. Nach § 39 Abs. 1 Ziff. 3 BNatSchG ist es verboten, Lebensstätten zu zerstören. Deshalb ist das wasserrechtlich bestätigte Gewässer wiederherzustellen und zu öffnen. Die Planung ist entsprechend abzuändern und anzupassen.
|
Der südlichwestliche Mühlgraben ist seit der Errichtung der Erharthalle in den späten 1980er Jahren nachweislich nicht mehr dauerhaft wasserführend; seit März/April 2016 ist auch der südwestliche Abschnitt des Mühlgrabens verfüllt. Die Eingriffsregelung und damit § 14 Abs. 2 BNatSchG finden auf den vorliegenden Bebauungsplan keine Anwendung (s.o.). Die Behauptung, der Mühlgraben stelle einen ständigen Lebensraum für Makrozoobenthos, Insekten oder Fische dar, entspricht nicht den Tatsachen. Der angegebene Zeitpunkt der Inaugenscheinnahme ist nicht nachvollziehbar (nicht dokumentiert) und entbehrt jeglicher belastbaren Grundlage. Aus historischen Aufzeichnungen und langjährigen Beobachtungen geht klar hervor, dass der Mühlgraben allenfalls bei Starkregen oder außergewöhnlichen Überschwemmungsereignissen kurzfristig wasserführend war. Über die überwiegende Zeit jedoch war das Gewässer trocken und bildete keinen dauerhaften Lebensraum für aquatische Lebewesen.
Es ist ebenso zu betonen, dass der fragliche Eingriff bereits vor vielen Jahren und nicht im Rahmen der aktuellen Planung erfolgt ist. Die Verfüllung stellt keinen planbedingten Vorgang dar und kann daher nicht der jetzigen Planung angelastet werden.
Abschließend wird nochmals hervorgehoben, dass der Mühlgraben seit Jahrzehnten seine wasserführende Funktion verloren hat und daher weder die Forderung nach einer Wiederherstellung noch eine Anpassung der Planung gerechtfertigt ist. Die naturschutzrechtlichen Belange sind in diesem Fall ausreichend berücksichtigt, und es besteht kein Anlass für eine Abänderung der aktuellen Planung.
|
|
7.2 Verkehrskonzept
lm Hinblick auf übergeordnete Konzepte wie ein Mobilitätskonzept oder die Problematik der Zunahme des Individualverkehrs ist es äußerst zweifelhaft ein Parkhaus in dieser Dimension zu errichten. Dies entschärft sicherlich nicht den immer währenden Stau durch die Innenstadt. Vielmehr wäre es zielführend, den ÖPVN auszubauen und entsprechende Haltestellen für Busse, Sammeltaxis u.ä. zu errichten.
|
Der Anregung, den ÖPNV weiter auszubauen, wird gedankt. Allerdings entbindet dieser berechtigte Vorschlag die Bauleitplanung nicht von ihrer Verpflichtung, das notwendige Baurecht für Stellplätze nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO) sicherzustellen. Die Errichtung des Parkhauses ist ein wesentlicher Bestandteil der Gesamtplanung und notwendig, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Ein verbessertes ÖPNV-Angebot ist zweifellos wünschenswert und langfristig zu fördern, jedoch muss parallel auch der Bedarf an Stellplätzen gedeckt werden, um die aktuelle und künftige Verkehrssituation ganzheitlich zu bewältigen. Das vorgesehene Parkhaus ist ein zentraler Baustein, um den Parkdruck zu verringern und den Verkehrsfluss zu verbessern. Die Festsetzungen des Bebauungsplans reduzieren die Anzahl der notwendigen Stellplätze schon auf das vertretbare Minimum, das – ganz im Interesse der UNB – unter der Anzahl nach der Füssener Stellplatzsatzung liegt.
|
|
7.3 Grünordnungskonzept
Der Magnuspark liegt außerhalb des Stadtkerns und stellt den Übergang zum Hutlers- und Kalvarienberg dar, getrennt durch die B17. Deshalb stellt - wie bereits am 14.12.23 dargelegt - eine rasterförmige Bepflanzung keinesfalls eine qualifizierte Grünordnung dar. Industriebrachen sind oftmals geprägt von aufkommenden Gehölzen, nicht von strenger urbaner Symmetrie. Aus hiesiger Sicht wird eine strenge Freiflächengestaltung nicht befürwortet.
|
Der Magnuspark befindet sich auf einer denkmalgeschützten Industriebrache, die aufgrund der markanten Zeilenstruktur der ehemaligen Industriebauten unter Schutz steht. Die Stadt Füssen verfolgt daher bewusst das Ziel, die denkmalpflegerischen Qualitäten dieses Quartiers durch eine klare und strenge Freiflächengestaltung im Inneren zu unterstützen. Ziel der Planung ist es, die Industriebrache zu revitalisieren, städtebauliche Missstände zu bereinigen und heute herabgewürdigte denkmalgeschützte Substanz ganz im Sinne des Art. 141 Abs. 2 BV möglichst weitgehend ihrer historischen Bedeutung wieder zuzuführen. Dies unterstützt die Freiflächengestaltung. Dies betrifft insbesondere die Nord- und Süd-Passagen sowie den neu gestalteten Eingangsbereich, wo diese gestalterische Strenge die historische Bedeutung des Areals betont und hervorhebt.
Gleichzeitig wird in den Randbereichen des Quartiers eine gezielt aufgelockerte Grünordnung geschaffen, die einen fließenden Übergang zum natürlichen Bewuchs des Berghangs und zum Uferbereich des Lechs bildet. Diese zweigleisige Planung gewährleistet sowohl den Schutz des denkmalgeschützten Charakters als auch eine harmonische Einbindung in die umgebende Naturlandschaft.
Es ist festzuhalten, dass das Planungsbüro sämtliche relevanten Belange erkannt und in die Planung integriert hat – weit über die Aspekte hinaus, die von der Unteren Naturschutzbehörde aufgegriffen wurden. Diese differenzierte Gestaltung dient der nachhaltigen Entwicklung des gesamten Areals und trägt sowohl den denkmalpflegerischen als auch den naturschutzrechtlichen Anforderungen in vollem Umfang Rechnung.
|
|
Satzung
§ 8 Grünordnung Ziff. (1) 4
Die geplante Fläche für ein Schwimmbecken muss einen Mindestabstand von 10m zum Lechufer einhalten. Die bestehenden Ufergehölze sind zu erhalten. ln diesem Uferstreifen dürfen weder Abgrabungen, Aufschüttungen, sonstige Nutzungen noch Versiegelungen jeglicher Art stattfinden.
|
Die Stadt Füssen weist mit Nachdruck darauf hin, dass es sich bei dem Plangebiet um eine ehemalige Industriebrache handelt, deren Flächen weitestgehend versiegelt sind und bereits einer gewerblichen Nutzung unterliegen. Zwar haben Gewässerrandstreifen grundsätzlich eine hohe ökologische und wasserwirtschaftliche Bedeutung, im vorliegenden Fall jedoch trennt die bestehende Stützmauer den nördlich gelegenen Gewässerrandstreifen vom südlich angrenzenden, ehemals industriell genutzten Grundstück. Das geplante Schwimmbecken befindet sich somit auf einer bereits gewerblich genutzten und versiegelten Fläche und hat keinerlei negative Auswirkungen auf die nördliche Uferböschung oder die naturnahen Strukturen am Lechufer.
Zudem verfolgt die Stadt das Ziel, durch die neue Nutzung dieses Bereichs einen wichtigen Erinnerungsort für den ehemaligen Triebwerkskanal zu schaffen und das historische Erbe der Stadt zu bewahren. Die bestehenden Ufergehölze, die sich hinter der Stützmauer befinden, sind durch die geplante Baumaßnahme in keiner Weise betroffen, wie dies eindeutig aus der beigefügten Planzeichnung hervorgeht. Es wird nochmals bekräftigt, dass im Bereich des Lechufers (hinter der Stützmauer) weder Abgrabungen, Aufschüttungen, noch sonstige Nutzungen oder Versiegelungen vorgesehen sind. Dieser Uferbereich ist als naturnahe Böschung festgesetzt, und die Erhaltung der Bestandsbäume wird ebenfalls sichergestellt.
Die Planung erfüllt somit in vollem Umfang die wasserwirtschaftlichen und ökologischen Anforderungen und stellt sicher, dass sowohl der Schutz des Uferbereichs als auch die Bewahrung des historischen Erbes der Stadt Füssen gleichermaßen berücksichtigt werden. Der Gewässerschutzstreifen bis zur bestehenden Stützmauer bleibt unverändert.
|
|
Beschlussvorschlag
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplans.
|
|
Beschluss: __13_:_7__
|
- Regionaler Planungsverband Allgäu vom 10.09.2024
|
Stellungnahme
|
Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
wir verweisen auf das Schreiben vom 27.05.2024 hin. Dessen Inhalte gelten nach wie vor.
|
Die Stadt Füssen nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Es wird auf die bisherige Abwägung verwiesen:
|
|
„Wir weisen darauf hin, dass am 1. Mai 2024 die Vierte Verordnung zur Änderung des Regionalplanes der Region Allgäu (16) – Fortschreibung des Teilfachkapitels B I 3 „Wasserwirtschaft“ – in Kraft getreten ist.
Den Planungsunterlagen zufolge können im Plangebiet infolge von Starkregenereignissen Überflutungen auftreten. Zudem ist teilweise ein festgesetztes Überschwemmungsgebiet berührt. Darüber hinaus befinden sich laut Umweltatlas des Bayerischen Landesamtes für Umwelt am südöstlichen Rand des Plangebietes Gefahrenbereiche für Steinschlag/Blockschlag.
Deshalb bitten wir den (im Rahmen der o.g. Fortschreibung neu festgelegten) Grundsatz des Regionalplans der Region Allgäu (RP 16) B I 3.4.1 zu berücksichtigen. Gemäß diesem Grundsatz sollen Risiken durch Hochwasser, Starkregenereignisse, hohe Grundwasserstände und alpine Naturgefahren durch vorsorgende Maßnahmen minimiert werden. Bei bestehenden Siedlungen und Infrastruktureinrichtungen und bei neuen, die nicht außerhalb errichtet werden können, sollen diese Risiken berücksichtigt werden. Durch die Freihaltung von Gefährdungsbereichen von Siedlungsflächen und Infrastruktureinrichtungen das Gefährdungspotenziale erheblich reduziert werden (siehe Begründung zu RP 16 B I 3.4.1 (G)).
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme sowie den darin enthaltenen Informationen aus der Gefahrenhinweiskarte.
Wie der Stellungnahme und der Gefahrenhinweiskarte zu entnehmen ist, wird im Süd- und Südostteil des Planungsgebiets Bereiche mit Steinschlag/Blockschlag (ohne und mit Wald) ausgewiesen. Der überwiegend bereits bebaute Gebäudebestand befindet sich außerhalb dieses potenziellen Gefahrenbereichs. Lediglich das ehem. Faserzentrum als bestandsgeschützte Gewerbehalle im Süden ist im Bestand davon betroffen.
Der Bebauungsplan sieht im Übrigen im potentiellen Gefahrenbereich nur den Neubau des Mobilitätshubs vor. Dieses Gebäude soll bestimmungsgemäß dem ruhenden Verkehr dienen. In ihm werden sich keine Personen dauerhaft, sondern nur vorübergehend aufhalten. Eine längere Aufenthaltsdauer von Personen ist nicht zu erwarten. Dem Ziel des Regionalplans RP 16 in B I 3.4.3 ist damit Rechnung getragen. Es kann dahinstehen, ob es sich hierbei um ein echtes Ziel der Raumordnung als abschließend abgewogene, verbindliche Vorgabe zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums (§ 3 Abs 1 Nr. 2 ROG) und nicht nur um einen Grundsatz der Raumordnung als Vorgabe für nachfolgende Abwägungsentscheidungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG) handelt. Für letzteres spricht die offene Formulierung in B I.3.4.3, wonach die (nicht näher bestimmten) Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser, Muhren, Erosionen und Lawinen fortgeführt werden sollen. Auch die Begründung, wonach in den Siedlungsgebieten im Rahmen der Bauleitplanung der vorbeugenden Freihaltung der Gefährdungsräume besondere Bedeutung zukommt, spricht gegen ein abwägungsfestes, abschließend abgewogenes Ziel der Raumordnung.
Im Hinblick auf das Überschwemmungsgebiet besteht für die Überplanung des Innenbereichs nach dem WHG kein Planungsverbot. Hier sind die Belange des Hochwasserschutzes im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Der Retentionsraumausgleich ist von einem Fachplaner ausgearbeitet und mit dem WWA Kempten abgestimmt worden. Das WWA Kempten hat den geplanten Retentionsraumausgleich mit E-Mail vom 05.02.2024 wasserrechtlich als genehmigungsfähig angesehen. Die Belange des Hochwasserschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB) werden damit angemessen berücksichtigt.
Darüber hinaus weist die Stadt Füssen darauf hin, dass der Bebauungsplan den Uferbereich des Lechs nicht beinhaltet.
Die Stadt Füssen erlaubt sich darauf hinzuweisen, dass es sich beim Magnus Park um eine Industriebrache handelt, deren bestandsgeschützte Bebauung bereits zu Teilen wieder mit Nutzungen belegt werden konnte. Die Planung wird dazu führen, dass die im Bestand überwiegend versiegelten Flächen erheblich entsiegelt werden. Durch den Rückbau der Zwischenbauten und die festgesetzte Grünordnung werden die Freiflächen erheblich ökologisch und landschaftsästhetisch entsprechend aufgewertet. Durch die geplanten Maßnahmen werden im Vergleich zum Bestand voraussichtlich ca. 6.523 m² mehr an Grünflächen geschaffen. Dies entspricht einer Entsiegelung von ca. 47 %. Damit wird der Abfluss bei Starkregenniederschlägen erheblich verbessert.
|
|
Des Weiteren bitten wir die Stadt Füssen, in Bezug auf die geplante Bebauungsplanänderung geeignete Maßnahmen zu treffen, um Regionalplan der Region Allgäu B V 2.3 (Z) ausreichend Rechnung zu tragen. Gemäß diesem Regionalplanziel soll darauf hingewirkt werden, dass die Region von der Errichtung überwiegend eigengenutzter Freizeitwohngelegenheiten (Zweitwohnungen) freigehalten wird.“
|
Die Stadt Füssen schließt in dem Bebauungsplan Ferienwohnungen i.S.d. § 13a BauNVO, die nach ihrer Lage, Größe, Ausstattung, Erschließung und Versorgung für den Erholungsaufenthalt geeignet und dazu bestimmt sind, überwiegend und auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur Erholung zu dienen, aus. Ein Ausschluss von gewerblich vermieteten Ferienwohnungen als Unterart einer gewerblichen Nutzung ist nach § 1 Abs. 9 BauNVO möglich.
Demgegenüber gibt es für einen Ausschluss von Zweitwohnungen aus der Sicht der Stadt Füssen keine Festsetzungsgrundlage. Entscheidend für eine Wohnnutzung ist, dass diese im Sinne einer „auf Dauer angelegten Häuslichkeit“ genutzt wird, also nach Ausstattung und Bestimmung das dauerhafte Wohnen ermöglicht (ohne dass der Eigentümer auch tatsächlich dauerhaft dort Wohnen muss). Liegt diese „Häuslichkeit“ vor, ist auch eine Zweitwohnung Wohnen i.S.d. § 3 und § 4 BauNVO (siehe etwa Bönker/Bischopink, BauNVO, 2. Aufl., § 3 Rn. 27; Fickert/Fieseler, BauNVO, 13. Aufl., § 3 Rn. 1.2; König/Roeser/Stock, BauNVO, 5. Aufl., § 3 Rn. 17a; Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Der Erwerb von Zweitwohnungen, S. 9). Die Nutzung von Wohnungen als Erstwohnsitz kann in einem Bebauungsplan nicht festgesetzt werden.
Auch bei der Regelung in B V 2.3 dürfte es sich aufgrund ihrer Formulierung („es soll darauf hingewirkt werden“ um kein abschließend abgewogenes Ziel der Raumordnung handeln.
|
|
Beschlussvorschlag
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplans.
|
|
Beschluss: __18_:_2__
|
- Staatliche Bauamt Kempten vom 05.08.2024
Az.: GZ S432-46220.OAL.Füssen
|
Stellungnahme
|
Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Das geplante Baugebiet ist straßenrechtlich in der Ortsdurchfahrt von Füssen unmittelbar an die Bundesstraße 17 angeschlossen.
Bei den Abbauarbeiten darf keine übermäßige, den Verkehr beeinträchtigende, Staubentwicklung entstehen.
Den Straßengrundstücken und den Straßenentwässerungsanlagen dürfen keine Abwässer und kein Niederschlagswasser zugeleitet werden.
Die Straßenbauverwaltung ist von jeglichen Ansprüchen des Bauwerbers freizustellen, die sich aus dem Bestand und dem Betrieb der Straße ergeben. Das bedeutet, dass gegen die Straßenbauverwaltung keinerlei Ansprüche in Bezug auf Lärmsanierung geltend gemacht werden können.
Des Weiteren sind gemäß der RAST 06 beidseits Sichtdreiecke mit einer Schenkellänge von 30 m, gemessen 3 m von Mitte des Geh- & Radweges, gewährleistet werden.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die Stellungnahme und nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Durch die Höhenlage der Bundesstraße B17 ist ein Abfließen von Niederschlagswasser aus dem Plangebiet ausgeschlossen.
Die Verkehrslärmproblematik ist von der Stadt Füssen erkannt, gutachterlich untersucht und durch Festsetzung der Bereiche, in denen Wohnnutzungen zulässig sind und zur Grundrissgestaltung bewältigt worden.
Die angeregten Sichtdreiecke sind im B-Plan bereits dargestellt und werden im Rahmen der Ausführungsplanung berücksichtigt.
|
|
Beschlussvorschlag
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplans.
|
|
Beschluss: __18_:_2__
|
- Wasserwirtschaftsamt Kempten vom 05.09.2024
Az.: 2-4622-OAL 129-20555/2024
|
Stellungnahme
|
Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir begrüßen die Aufnahme der Textteile zum HQ100 und zum HQextrem im Teil A textliche Festsetzungen im Bebauungsplan.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die Stellungnahme.
|
|
Wie auch schon in den bereits vergangenen Stellungnahmen vorgebracht, fehlt aus unserer Sicht immer noch eine Abwägung nach §1 Absatz 7 des Baugesetzbuches für das Extremhochwasser. Wir verweisen hierzu nochmals auf die Bauleitplanungen im Weidach, bei denen diese Abwägung vorbildlich durchgeführt wurde (siehe z. B. Bebauungsplan O 75 – Weidach Nordost 2, Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange zum Vorentwurf, Stand 11.01.2022, Beschluss bei Stadtratssitzung am: 28.03.2023, vom Architekt BDA Franz Arnold)
|
Die Stadt Füssen verkennt nicht, dass gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB die Belange des Hochwasserschutzes bei der Aufstellung des B-Plans zu berücksichtigen, d.h. mit ihrer jeweils konkret nach Planungsanlass, Planungsziel und örtlichen Gegebenheiten zu gewichtenden Bedeutung in die Abwägung einzustellen sind. Dass der Verbotstatbestand des § 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG - wie auch die untere Wasserrechtsbehörde in ihrer Stellungnahme festgestellt hat - der Umplanung eines bereits bestehenden Baugebiets nicht entgegensteht, enthebt die planende Stadt Füssennicht von der Pflicht, die Belange des Hochwasserschutzes in der Abwägung zu berücksichtigen. Eben diese Abwägung erfolgt: Hochwasserschutzanlagen sind in der Regel für ein Hochwasser ausgelegt, das statistisch gesehen einmal in 100 Jahren (100-jährliches Hochwasser oder HQ100) eintritt. Bei einem Extremhochwasser, das noch seltener vorkommt, können beispielsweise Hochwasserschutzmauern überströmt und die dahinterliegenden Flächen überflutet werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein HQ100 an einem Fluss mindestens einmal in einem Menschenleben von 80 Jahren auftritt, beträgt nach Angaben des LfU 55 %.
Der Bebauungsplan überplant keine grüne Wiese, sondern einen aktuell nahezu vollversiegelten Bestand. Der Bebauungsplan schafft nur untergeordnet das Baurecht für zusätzliche Flächenversiegelungen (etwa beim Mobilitätshub im Baufeld BF 5), führt jedoch im Ergebnis durch den Rückbau der Zwischenbauten zu einer erheblichen Entsiegelung, welche die vorhandenen Grünflächen nahezu verdoppeln wird (+ 47 %). Durch diese Entsiegelung der Freiflächen verbessert sich der status quo und wird eine Versickerung von Oberflächenwasser begünstigt. Der durch die Verfüllung des Mühlgrabens verloren gegangene Retentionsraum wird in Abstimmung mit dem WWA ausgeglichen. Das WWA erklärt den Retentionsraumausgleich zwar nicht zur Wunschlösung, aber aus seiner Sicht für wasserrechtlich genehmigungsfähig. Die verbleibenden Hochwassergefahren werden durch Festsetzungen zu einer hochwasserangepassten Bauweise für Neubauten (Festsetzung Rohfußbodenoberkante des Erdgeschosses und zu wasserdichter Errichtung bis zu dieser Höhe) und Hinweise im Bebauungsplan angemessen berücksichtigt.
Die bestehenden Restrisiken werden in Abwägung mit den oben genannten Belangen für zumutbar gehalten. Auf die verbleibenden Restrisiken wird hingewiesen und eine hochwasserangepasste Bauweise empfohlen. Im Ergebnis geht die Stadt Füssen als Trägerin der Planungshoheit im Rahmen ihrer Abwägung davon aus, dass sich der status quo auch im Hinblick auf die Belange des Hochwasserschutzes nicht verschlechtert, sondern verbessert. Weitergehende Hochwasserschutzmaßnahmen werden – auch mit Rücksicht auf die Belange des Denkmalschutzes im Hinblick auf den Nähebezug zu mehreren Baudenkmälern – nicht für erforderlich angesehen. Hiergegen ist nichts einzuwenden (siehe etwa BVerwG, Urt. v. 03.06.2014, 4 VN 6/12, Rn. 38 – juris).
|
|
Bzgl. des Retentionsraumverlustes durch die widerrechtlich durchgeführte Auffüllung des alten Mühlkanals behält unsere Stellungnahme vom 29.05.2024 ihre Gültigkeit.
|
Die Stadt Füssen verweist auf die Fachliche Würdigung und Abwägung vom 25.06.2024, welche weiterhin Gültigkeit behält.
|
|
Auszug aus der Stellungnahme vom 29.05.2024 zum Retentionsraumverlustes:
|
Auszug aus der Fachlichen Würdigung und Abwägung vom 25.06.2024 zum Retentionsraumverlustes:
|
|
Retentionsraumverlust durch die Auffüllung des alten Mühlkanals
Die aus unserer Sicht rechtskräftige Rückbauanordnung wurde seinerseits im Jahre 2016 nicht nur aufgrund des Denkmalschutzes, sondern auch aufgrund von Einwendungen anderer Träger öffentlicher Belange erlassen. U. a. hat auch das WWA Kempten mit Stellungnahme vom 13.04.2016 an das Landratsamt Ostallgäu folgende Feststellungen getätigt:
1. Bei Hochwasser staut der Lech in den Mühlkanal zurück. Durch die Auffüllung wird der Retentionsraum in diesem Bereich nun zerstört.
2. Durch die Auffüllung werden Rückzugsbereiche für Fische im Hochwasserfall zerstört, die sich bisher in den Mühlkanal zurückziehen konnten.
3. Das Erdmaterial ist eventuell belastet (Bauschutt). Im Hochwasserfall könnten hier Stoffe in den Lech ausgetragen werden.
Des Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass im landschaftspflegerischen Begleitplan für den Neubau des Kraftwerkes Füssen am Lechfall beschrieben ist, dass die „alten“ Mühlkanäle erhalten werden sollen. Zudem wurde im Verfahren zum Kraftwerksneubau auch auf die Denkmalschutzwürdigkeit der alten Kraftwerksteile eingegangen.
Aus Sicht des WWA Kemptens war zum damaligen und ist auch zum jetzigen Zeitpunkt ein Rückbau der Auffüllung, also der Vollzug der Rückbauanordnung, das wasserwirtschaftlich sinnvollste. Wird der Rückbau der Auffüllung nicht durchgeführt, dann sind vor der Bauleit-planung die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, damit die überplante Fläche lastenfrei wird. Dafür ist aus unserer Sicht die Rückbauanordnung rückabzuwickeln und für die Auffüllung des Mühlkanals das notwendige rechtliche Verfahren, in Abstimmung mit der zuständigen Wasserrechtsbehörde am LRA OAL, zu klären und durchzuführen. Aus unserer Sicht ist die in der Beschlussvorlage vom 19.03.2024 durchgeführte fachliche Würdigung/Abwägung deshalb fehlerhaft.
Des Weiteren ist auch der Punkt des Retentionsraumausgleiches nicht ausreichend in der Beschlussvorlage gewürdigt. Die Aussage, dass der Retentionsraumausgleich abgestimmt wurde, ist richtig. Jedoch fand unseres Wissens nach nur eine Abstimmung mit dem WWA Kempten statt, andere Träger öffentlicher Belange sind nicht beteiligte worden. Wie bereits in unserer Stellungnahme vom 15.12.2023 geschrieben, ist auch hier erst das Wasserrecht und erst im Anschluss das Bauleitplanverfahren durchzuführen. Andernfalls besteht keine Rechtssicherheit, ob die Bauleitplanung in der vorgelegten Form umsetzbar ist.
|
Wie das WWA Kempten im Rahmen dieser Stellungnahme feststellt, wurde der Retentionsraumausgleich mit dem WWA als wasserwirtschaftlicher Fachbehörde abgestimmt. Es ist nicht Aufgabe des WWA, denkmalfachliche Belange zu erörtern. Die nun erstmalig eingebrachten Einwendungen sind vor dem Hintergrund der E-Mail vom 05.02.2024 (Sachgebietsleitung Wasserbau und Gewässerentwicklung) nicht nachvollziehbar. Darin heißt es: „Falls die Rückbauanordnung nicht vollzogen wird, dann sehen wir immer noch die im Mai 2021 abgestimmte Planung für den Retentionsraumausgleich unter der Erharthalle als aus wasserwirtschaftlicher Sicht genehmigungsfähig an.“
Der Bebauungsplan plant damit zulässig in eine Genehmigungslage hinein. Ein Vollzugshindernis ist daher nicht ersichtlich.
Der Mühlgraben ist seit dem Bau der Erharthalle Ende der 1980er Jahre nicht mehr wasserführend. Seit dem Jahr 2016 ist er vollständig verfüllt. Der Eingriff ist bereits vor Jahren erfolgt und nicht planbedingt.
Die Besorgnis, dass Bauschutt in den Mühlgraben einbracht worden ist, ist unbegründet. Im Gegenteil hat der aktuelle Eigentümer mit Aufwendungen im Millionenbereich frühere Altlasten aus der vormaligen industriellen Nutzung aufwändig saniert.
Der landschaftspflegerischen Begleitplan für den Neubau des Kraftwerkes Füssen am Lechfall hat keine Bindungswirkung für diesen Bebauungsplan. Wie bereits mehrfach eingeführt ist der Eingriff bereits vor Jahren erfolgt und nicht planbedingt. Die Entwicklung des Magnus Park wird zu einer erheblichen Aufwertung auch der Freiflächengestaltung im Vergleich zum status quo der Industriebrache führen. Der Mühlkanal und Triebwerkskanal werden denkmalfachlich an sechs Erinnerungsorten gewürdigt. Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes wird die qualifizierte Freiflächengestaltung auf Genehmigungsebene umzusetzen sein.
Die Stadt Füssen nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht des WWA ein Rückbau aus wasserwirtschaftlicher sinnvollster Weg angesehen wird, zugleich hält das WWA wie dargestellt, die Retentionsausgleichs-Lösung für genehmigungsfähig. Zweifel an der Planerforderlichkeit nach § 1 Abs. 3 BauGB bestehen nicht.
Die untere Wasserrechtsbehörde im LRA Ostallgäu hat inzwischen zutreffend erkannt, dass die Überplanung einer bebauten Innenbereichslage nicht an § 78 Abs. 2 WHG zu messen ist. Die Genehmigung im Einzelfall nach § 78 Abs. 5 WHG für die Errichtung und Erweiterung baulicher Anlagen kann erst im Zuge der Genehmigung der konkreten Bauvorhaben beantragt und geprüft werden.
Abgesehen davon geht das WWA selbst von einer wasserrechtlichen Genehmigungsfähigkeit aus. Bedenken gegenüber der Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplans bestehen nicht.
Die Stadt Füssen stellt die wasserwirtschaftlichen Belange mit den Ihnen gebührenden Gewicht in die Abwägung ein und gelangt im Hinblick auf die Revitalisierung der Industriebrache, des Vorrangs der Innenentwicklung vor der Ausweisung neuer Bauflächen, der umfangreichen Entsiegelung der Freiflächen und nicht zuletzt die Belange der Wirtschaft zu dem Ergebnis, die Einwände des WWA zurückzustellen.
|
|
Beschlussvorschlag
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplans.
|
|
Beschluss: __18_:_2__
|
Stellungnahmen mit Hinweisen
Träger öffentlicher Belange
- Deutsche Telekom Technik GmbH vom 05.09.2024
Az.: 2024498 ID 1011999
|
Stellungnahme
|
Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:
Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben PTI Aktenzeichen 2024262 vom 07.05.2024 Stellung genommen. Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter.
Für die Beteiligung danken wir Ihnen.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die Stellungnahme und verweist auf die Fachliche Würdigung / Abwägung vom 19.03.2024 sowie vom 25.06.2024.
|
|
Stellungnahme vom 07.05.2024:
|
Fachliche Würdigung / Abwägung vom 25.06.2024:
|
|
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:
Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben PTI Aktenzeichen 2023667 vom 11.12.2023 Stellung genommen. Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter.
Für die Beteiligung danken wir Ihnen.
|
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
|
|
Stellungnahme vom 27.11.2024:
|
Fachliche Würdigung / Abwägung vom 19.03.2024:
|
|
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:
|
|
|
Im Planungsbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Deutschen Telekom. Deren Bestand und Betrieb müssen weiterhin gewährleistet bleiben. Sollten diese Anlagen von den Baumaßnahmen berührt werden, müssen diese gesichert, verändert oder verlegt werden, wobei die Aufwendungen der Telekom hierbei so gering wie möglich zu halten sind.
Es sind Kupfer- und Glasfaserleitungen im südlichen Bereich des Plangebiets vorhanden.
Falls im Planungsbereich Verkehrswege, in denen sich Telekommunikationsanlagen der Deutschen Telekom befinden, entwidmet werden, bitten wir gesondert mit uns in Verbindung zu treten.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme und darin enthaltene Hinweise zu den bestehenden Telekommunikationsanlagen. Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme und sind auf Ebene der nachfolgenden Ausführungsplanung vom jeweiligen Grundstückseigentümer / Bauherrn zu berücksichtigen.
|
|
Sollten Sie im Rahmen dieses Verfahrens Lagepläne unserer Telekommunikationsanlagen benötigen, können diese angefordert werden bei:
E-Mail: Planauskunft.Sued@telekom.de
Fax: +49 391 580213737
Telefon: +49 251 788777701
Die Verlegung neuer Telekommunikationslinien zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsinfrastruktur im und außerhalb des Plangebiets bleibt einer Prüfung vorbehalten.
Damit eine koordinierte Erschließung des Gebietes erfolgen kann, sind wir auf Informationen über den Ablauf aller Maßnahmen angewiesen. Bitte setzen Sie sich deshalb so früh wie möglich, jedoch mindestens 4 Monate vor Baubeginn, in Verbindung mit:
Deutsche Telekom Technik GmbH
Technik Niederlassung Süd, PTI 23
Gablinger Straße 2
D-86368 Gersthofen
Diese Adresse bitten wir auch für Anschreiben bezüglich Einladungen zu Spartenterminen zu verwenden.
Für die Beteiligung danken wir Ihnen.
|
|
|
Beschlussvorschlag
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplans.
|
|
Beschluss: _18_:_2_
|
- Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co. KG vom 06.08.2024
|
Stellungnahme
|
Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Unsere Stellungnahme vom 27.11.2023 hat weiterhin Gültigkeit!
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die Stellungnahme und verweist auf die Fachliche Würdigung / Abwägung vom 19.03.2024.
|
|
Stellungnahme vom 27.11.2023:
|
Fachliche Würdigung / Abwägung vom 19.03.2024:
|
|
Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage.
|
|
|
Die Elektrizitätsversorgung des Bebauungsplangebietes „Mühlbachgasse“ ist sichergestellt über unser regionales Verteilungsnetz (20 kV Leitungen), sowie der 20 kV-Trafostationen „Tiroler Straße“ welche sich außerhalb des überplanten Bereiches befindet.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die vorgebrachte Stellungnahme. Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme.
|
|
Der überplante Bereich ist momentan ein sog. geschlossenes Verteilernetz welches im Kundeneigentum ist. Das o. g. Bebauungsplangebiet ist derzeit nicht erschlossen. Der Stromanschluss der Neubauten erfolgt grundsätzlich über 1 kV-Erdkabel, welche im Zuge der Erschließung noch zu verlegen sind.
|
Die Ausführungen dienen der Kenntnisnahme und sind auf Ebene der nachfolgenden Ausführungsplanung vom jeweiligen Grundstückseigentümer / Bauherrn zu berücksichtigen.
|
|
Beschlussvorschlag
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplans.
|
|
Beschluss: __18_:_2__
|
- Regierung von Schwaben vom 17.09.2024
Az.: 24-4622.8095-42/3
|
Stellungnahme
|
Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Sehr geehrte Damen und Herren,
dem o.a. Bauleitplanvorhaben stehen landesplanerische Belange nicht entgegen.
Wir weisen rein vorsorglich erneut darauf hin, dass die Zuordnung der Sortimente in Bedarfsgruppen im vorliegenden Bebauungsplanentwurf gemäß Anlage 1 "Nahversorgungs- und innenstadtrelevante Sortimente - Füssener Liste" nicht der Einteilung gemäß Anlage 2 zur Begründung des LEP entspricht. Bei etwaigen landesplanerischen Stellungnahmen oder Beurteilungen wird auf die Einteilung der Sortimente in Bedarfsgruppen gemäß Anlage 2 des LEP abgestellt werden.
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die Stellungnahme und verweist auf das städtische Einzelhandelskonzept (das spezifiziert für das integrierte Ortsentwicklungskonzept erarbeitet wurde und damit konkreter und fachbezogener die Belange bewertet als die Anlage 2 des LEP), in welcher die „Nahversorgungs- und innenstadtrelevante Sortimente - Füssener Liste“ definiert wird.
Die Hinweise dienen der Kenntnisnahme.
|
|
Das Regierungssachgebiet Städtebau gibt folgenden Hinweis:
Voraussetzung für den Einsatz von Städtebaufördermitteln ist, dass den Belangen der Denkmalpflege Rechnung getragen wird. Entsprechend schließt sich das Sachgebiet Städtebauförderung der Stellungnahme des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege vom 22.05.2024 vollumfänglich an
|
Die Hinweise dienen der Kenntnisnahme.
|
|
Beschlussvorschlag
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplans.
|
|
Beschluss: __18_:_2__
|
- Schwaben Netz vom 07.08.2024
Az.: Ke-Ri/ma
|
Stellungnahme
|
Fachliche Würdigung / Abwägung
|
|
Sehr geehrte Damen und Herren,
in Beantwortung Ihres oben genannten Schreibens teilen wir Ihnen mit, dass wir gegen den Bebauungsplan keine Einwände erheben.
Um entsprechende Hinweise im weiteren Planungsverfahren dürfen wir ebenso bitten, wie um rechtzeitige Information vor Beginn eventueller Bauarbeiten im Planungsbereich. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Planungsbereich bereits Gasleitungen von uns betrieben werden, deren Bestand und Betrieb zu sichern ist. Aktuelle Bestandspläne können auf der Homepage der schwaben netz gmbh unter folgender Adresse angefordert werden: ,,http://planauskunft.schwaben-netz.del''
|
Die Stadt Füssen bedankt sich für die Stellungnahme. Die Hinweise dienen der Kenntnisnahme. Die Sicherung der im Bestand vorhandenen Gasleitungen obliegt dem jeweiligen Grundstückseigentümer.
|
|
Beschlussvorschlag
|
|
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwägung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplans.
|
|
Beschluss: __18_:_2__
|
Beschlussvorschlag
- Der Stadtrat beschließt die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gemäß den zuvor gefassten Einzelentscheidungen.
- Der Stadtrat billigt den vom Büro OPLA ausgearbeiteten Bebauungsplan S 55 „Mühlbachgasse“ in der Fassung vom 28.01.2025 mit den heute beschlossenen Änderungen. Die Verwaltung wird beauftragt das Verfahren nach § 4a Abs. 3 i. V. m. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. Die Möglichkeit zur Abgabe von Stellungnahmen wird auf die geänderten oder ergänzten Teile beschränkt.
Beschluss
- Der Stadtrat beschließt die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gemäß den zuvor gefassten Einzelentscheidungen.
- Der Stadtrat billigt den vom Büro OPLA ausgearbeiteten Bebauungsplan S 55 „Mühlbachgasse“ in der Fassung vom 28.01.2025 mit den heute beschlossenen Änderungen. Die Verwaltung wird beauftragt das Verfahren nach § 4a Abs. 3 i. V. m. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. Die Möglichkeit zur Abgabe von Stellungnahmen wird auf die geänderten oder ergänzten Teile beschränkt.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 14, Dagegen: 6
Dokumente
Download VA2025-01-17_BV_22047_MG.pdf
Download VA2025-01-17_P_22047_MG.pdf
Download VA2025-01-17_TF_22047_MG.pdf
Download VA2025-01-22_B_22047_MG.pdf
Download VA2025-01-22_BV_Zusammenfassung_Würdigung_Planungskonzept_22047_MG.pdf
zum Seitenanfang
8. Revitalisierung des Lorchhauses, Floßergasse 2 in Füssen
Erteilung der weiterführenden Planungsfreigabe
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
28.01.2025
|
ö
|
beschliessend
|
8 |
Sachverhalt
Mit Beschlussvorlage vom 14.05.2024 hat der Erste Bürgermeister den Stadtrat über die vom Architekturbüro Pfanzelt durchgeführten Untersuchungen im Rahmen der Vorplanung sowie die vorliegende Kostenberechnung für die zwei vorgelegten Varianten in Kenntnis gesetzt. Nach den geführten Diskussionen sowie der Klärung der offenen Fragen wurde die Variante B als Vorzugsvariante für die weiterführenden Verhandlungen mit den potenziellen Fördergebern festgelegt. Im Wesentlichen beinhaltet die Vorzugsvariante B folgende Nutzung;
|
Bezeichnung
(Geschoss/Teilfläche)
|
Bruttofläche
(überschlägig)
|
Nutzung
(angenommen)
|
|
|
|
|
|
Untergeschoss
|
ca. 24 m²
|
Lagerraum
|
|
Erdgeschoss
|
ca. 195 m²
|
Gastronomie / Küche
|
|
Obergeschoss
|
ca. 195 m²
|
Personalraum / Büro / Kursraum 1+2
|
|
Dachgeschoss
|
ca. 195 m²
|
Betriebsleiterwohnung
|
Vor dem Hintergrund der mit dem Landesamt für Denkmalpflege (LFD) geführten Förder-verhandlungen wurde erkennbar, dass die in der ursprünglichen Planung vorgesehene Betriebs-leiterwohnung im Dachgeschoss nicht förderfähig ist. Dabei ist zu beachten, dass der Ausbau des Dachgeschosses hin zu einer Wohnung fast die doppelte Kostengrößenordnung im Vergleich zu einem Neubau erreicht. Darüber hinaus ist auf Probleme bei der Abwicklung der Technischen Gebäudeausrüstung hinzuweisen. Im Ergebnis soll aus wirtschaftlichen und funktionalen Gründen im Zusammenhang mit der Revitalisierung des Lorchhauses auf eine sogenannte Betriebsleiter-wohnung im Dachgeschoss verzichtet werden.
Die inzwischen erfolgte Weiterbearbeitung der in der Vorentwurfsplanung entwickelten Ursprungs-variante führte unter Berücksichtigung der Kosten und technischen Randbedingungen zu folgenden Modifikationen:
- Entfall der vorgeschlagenen Betriebsleiterwohnung im Dachgeschoss aufgrund
unverhältnismäßig hohen Herstellungskosten.
- Entflechtung der Ein-/Ausgänge.
- Funktionale Optimierung der Technischen Gebäudeausrüstung (WC) mit dem Ergebnis
der Flächen- und Gestaltungsoptimierung
Die optimierte Planung inkl. der vertieften Kostenaufstellung durch das Architekturbüro, auch mit dem Ziel zu Einsparungen zu gelangen, ist den beiliegenden Anlagen zu entnehmen. Ergänzend erfolgt mündlicher Bericht durch das beauftragte Architekturbüro Pfanzelt. Die aktuelle Planung wird vom beauftragten Architekturbüro Pfanzelt in der Sitzung erläutert.
Fazit
In der Gegenüberstellung ist die optimierte Variante (ohne Betriebsleiterwohnung) unter verschiedenen Gesichtspunkten erheblich günstiger zu bewerten. Die ursprüngliche Kostenschätzung für die Revitalisierung, kann daher nach derzeitigem Kenntnisstand deutlich reduziert werden.
Kosten
Die aktuelle Gesamtkostenschätzung (Baukosten, Planungskosten und Gutachterkosten) zur
Umsetzung dieses Projektes beläuft sich aktuell auf rund 2,10 Mio. Euro. Das Ergebnis der Kostenschätzung kann zum derzeitigen Planungszeitpunkt nur mit einer Genauigkeit von +/- 10% ermittelt werden. Die voraussichtlich Eigenanteil für die Stiftung wird auf rd. 450 T€ geschätzt.
Entsprechend den einzelnen Kostengruppen stellen sich die Kosten folglich dar;
Kostengruppe (KG)
|
Kostenberechnung 3. Ebene
|
|
|
KGR 200 - Vorbereitende Maßnahmen
|
80 Tsd. €
|
KGR 300 - Bauwerk - Baukonstruktionen
|
1,4 Mio. €
|
KGR 400 - Bauwerk - Technische Anlagen
|
130 Tsd. €
|
KGR 500 - Außenanlagen und Freiflächen
|
ohne Ansatz
|
KGR 600 - Ausstattung und Kunstwerke
|
ohne Ansatz
|
KGR 700 - Baunebenkosten
|
440 Tsd. €
|
Summe KG 200 - 700 inkl. MwSt. (gerundet)
|
2,10 Mio. €
|
Zuwendungen
Nach zahlreichen Abstimmungsterminen mit der Regierung von Schwaben und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, ist die Maßnahme dem Grunde nach zuwendungsfähig. Auf Grundlage der vorliegenden Kostenkalkulation ist mit einem Förderbetrag von ca. 1,6 Mio. € zu rechnen. Dies entspricht einer Förderquote von ca. 80 % des Gesamtprojekts (nicht rein förderfähige Kosten).
Der Antrag hierzu muss spätestens Ende des 1. Quartals 2025 bei der Regierung von Schwaben und beim BLFD eingereicht werden, ansonsten können vs.in den nächsten Jahren keine Fördermittel mehr abgerufen werden.
Weiteres Vorgehen
Für die nächsten Planungsphasen ist erforderlich, um Fördermittel beantragen zu können, das planerische Konzept detaillierter auszuarbeiten. Daher müssen für den weiteren Planungsverlauf Architekten- und Fachplanungsleistungen vergeben werden. Für die anstehenden Planungsphasen sind die Tragwerks- und Fachplanung Technische Gebäudeausrüstung (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektrotechnik) usw. in einem europaweiten VgV-Verfahren an geeignete und qualifizierte Büros zu vergeben. Im Vordergrund steht dabei, Fördermittel für Einzelmaßnahmen beantragen zu können, da durch die RvS und dem BLFD wie o.g., mündlich eine Förderung in Höhe von rd. 1,6 Mio. Euro in Aussicht gestellt wurde.
Anmerkung Vergabe Objektplanung
Aufgrund der extrem kurzen noch verbleibenden Zeit bis zum Ende der Einreichung des Fördermittelantrags und der Bedingung mit diesem die Baugenehmigung für das Vorhaben einzureichen, um die in Aussicht gestellten Fördermittel verbindlich in Anspruch zu nehmen, wird auf Grundlage § 30 Abs. 2 KomHKV i.V.m. den ANBest-K und dem Rundschreiben vom 31.01.2024 durch das Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, auf ein sehr zeitaufwendiges VgV-Verfahre (4 - 5Monate) für die Objektplanung verzichtet, da ansonsten die Revitalisierung des Lorchhauses nicht realisiert werden kann. Einzeln betrachtet liegen die geschätzten Honorarkosten für die Objektplanung Gebäude und Innenräume (LPH 1- 9) nach HOAI unter dem aktuellem EU-Schwellenwert von netto 221.000 € für Liefer- und Dienstleistungen.
In der Haushaltsplanung wurden rund 871.000 Euro Eigenanteil eingeplant. Die aktuelle Situation stellt sich so dar, dass der Eigenanteil darunter, bei rund 400.000 Euro liegen wird.
Somit ist die Finanzierung in der Haushaltsplanung gesichert.
Beschlussvorschlag
Dem Planungskonzept nach der optimierten Entwurfsplanung zur Revitalisierung des Lorchhauses mit voraussichtlichen Kosten von insgesamt brutto ca. 2,05 Mio. € wird zugestimmt.
Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Vergabeverfahren zur Planerauswahl einzuleiten und wird zugleich ermächtigt an den günstigsten Anbieter zu vergeben und anschließend bekanntzugeben. Die letztendliche Entscheidung über den Start zur baulichen Umsetzung steht unter dem Vorbehalt einer grundsätzlichen Finanzierbarkeit des geplanten Vorhabens.
Die Verwaltung wird beauftragt, Fördermittel aus dem Programm des Entschädigungsfonds (BLFD) und Städtebauförderung - Lebendige Zentren (RvS) zu beantragen und die Mittel vorbehaltlich einer Bewilligung für die aufgeführte Einzelmaßnahme einzusetzen.
Der Stadtrat beschließt die erforderlichen Haushaltsmittel, wie in den haushaltrechtlichen
Auswirkungen dargestellt, für die Haushaltsjahre 2025 ff. bereitzustellen. Entsprechende Verpflichtungsermächtigungen sind in den Haushaltsplänen für die Maßnahmen zu berücksichtigen.
Beschluss
Dem Planungskonzept nach der optimierten Entwurfsplanung zur Revitalisierung des Lorchhauses mit voraussichtlichen Kosten von insgesamt brutto ca. 2,05 Mio. € wird zugestimmt.
Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Vergabeverfahren zur Planerauswahl einzuleiten und wird zugleich ermächtigt an den günstigsten Anbieter zu vergeben und anschließend bekanntzugeben. Die letztendliche Entscheidung über den Start zur baulichen Umsetzung steht unter dem Vorbehalt einer grundsätzlichen Finanzierbarkeit des geplanten Vorhabens.
Die Verwaltung wird beauftragt, Fördermittel aus dem Programm des Entschädigungsfonds (BLFD) und Städtebauförderung - Lebendige Zentren (RvS) zu beantragen und die Mittel vorbehaltlich einer Bewilligung für die aufgeführte Einzelmaßnahme einzusetzen.
Der Stadtrat beschließt die erforderlichen Haushaltsmittel, wie in den haushaltrechtlichen
Auswirkungen dargestellt, für die Haushaltsjahre 2025 ff. bereitzustellen. Entsprechende Verpflichtungsermächtigungen sind in den Haushaltsplänen für die Maßnahmen zu berücksichtigen.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 20, Dagegen: 0
Dokumente
Download Entwurfsplanung_Kosten_Lorchhaus.pdf
zum Seitenanfang
9. Bildung einer Erschließungseinheit - Baugebiet Weidach-Nord - O 75
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
28.01.2025
|
ö
|
beschliessend
|
9 |
Sachverhalt
Die Bauplatzgrundstücke im Baugebiet „O75 Weidach Nordost II“ werden von der Stadt Füssen voll erschlossen veräußert, soweit diese im Besitz der Stadt sind. Die Stadt Füssen hat zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwands für Erschließungsanlagen einen Erschließungsbeitrag zu erheben. Nach § 130 Abs. 2 S. 3 BauGB kann der Erschließungsaufwand für mehrere Erschließungsanlagen jedoch insgesamt ermittelt werden, wenn mehrere Anlagen eine Einheit bilden und in funktioneller Abhängigkeit zueinanderstehen. Als Beispiel
für eine solche Abhängigkeit können hier die sog. Stichwege und die Ringstraße genannt werden, denn diese Anlage münden regelmäßig in eine Hauptstraße ein und sind insofern von dieser abhängig, weil die Anlieger der Stichwege oder Ringstraße diese Anlage beim Befahren/Verlassen ihrer Stichwege oder Ringstraße nutzen müssen. Die Entscheidung, ob eine Erschließungseinheit gebildet wird, hat der Stadtrat durch Ratsbeschluss zu treffen.
Die Erschließungsbeiträge für Baugrundstücke im Baugebiet O75 Weidach Nordost II die im Eigentum der Stadt Füssen stehen, werden mit Abschuss der notariellen Grundstücks-kaufverträge abgelöst. Hierdurch werden alle Verpflichtungen des Käufers zur Zahlung und alle Rechte der Stadt auf Erhebung eines endgültigen Erschließungsbeitrages abgegolten. Die Stadt kann nach Abschluss der Kaufverträge keine Forderungen für evtl. angefallene Mehrkosten stellen. Im Gegenzug hat der Käufer keinen Anspruch von evtl. zu viel gezahlten Beiträgen.
Grundstücke, die nicht im Eigentum der Stadt stehen (Rückbehaltsgrundstücke), sind per Bescheid zur Zahlung von Erschließungsbeiträgen heranzuziehen. Hierfür ist es notwendig, gemäß der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Füssen eine Einheit zur Verteilung der beitragsfähigen Erschließungskosten zu bilden, welche wie o.g. vom Stadtrat zu beschließen ist. Die Beschlussfassung bewirkt, dass der Herstellungsaufwand nach Maßgabe der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Füssen auf alle erschlossenen Grundstücke verteilt wird. Erschließungsbeitragsbescheide werden nur die sogenannten Rückbehaltsgrundstücke aus Voreigentümerschaft, die nicht von der Stadt veräußert werden, erhalten.
Fazit
Die Bildung einer Einheit dient lediglich der erschließungsbeitragsrechtlichen Grundlage zur Berechnung eines Beitragssatzes, welcher für die Ablösung des Erschließungsbeitrags für die im Privateigentum befindliche Grundstücke herangezogen wird, und trägt andererseits zu einer besseren Akzeptanz bei den Beitragspflichtigen bei.
Bildung einer Abrechnungseinheit
Der im Lageplan (siehe Anlage) rot dargestellte Bereich bildet die notwendige Erschließungseinheit gemäß § 130 Abs. 2 Satz 3. Sie geht über das gesamte Baugebiet und stellt eine faire Kostenverteilung über das Gesamtgebiet dar.
Weiter ist zu bemerken, dass erst die Widmung der Verkehrsanlagen die rechtliche Voraussetzung zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen bildet, da erst durch die Widmung die Öffentlichkeit der Anlagen hergestellt wird. Zudem entsteht in der Regel erst durch die Widmung die Beitragspflicht.
Beschlussvorschlag
Der Stadtrat der Stadt Füssen stimmt der Bildung einer Abrechnungseinheit für die Erschließung des Baugebietes O75 - Weidach Nordost II gemäß der rot dargestellten Fläche im beigefügten Lageplan zu.
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Füssen stimmt der Bildung einer Abrechnungseinheit für die Erschließung des Baugebietes O75 - Weidach Nordost II gemäß der rot dargestellten Fläche im beigefügten Lageplan zu.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 20, Dagegen: 0
zum Seitenanfang
10. Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) und Entwässerungssatzung (BGS-EWS) der Stadt Füssen; Einmalige Abweichung vom ersten Fälligkeitstermin der Vorauszahlungen für die Wasser- und Abwassergebühren für das Jahr 2025
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
28.01.2025
|
ö
|
beschliessend
|
10 |
Sachverhalt
Die Stadtwerke Füssen befinden sich derzeit im Umwandlungsprozess zu einem Kommunalunternehmen – Anstalt des öffentlichen Rechts. In diesem Zusammenhang setzen die Stadtwerke Füssen auch ein neues, leistungsstarkes Softwareprogramm zur Abrechnung Ihrer Verbrauchsgebühren ein. Die Gebührenabrechnung für das Jahr 2024 erfolgt noch mit dem bisher eingesetzten Programm (CIP).
Ab dem 15.03.2025 ist dann die neue Anwendersoftware DATEV im Einsatz. Bedingt durch den Wechsel des Anbieters werden die zukünftigen Abschläge für das Jahr 2025 mit der neuen Software berechnet und zu einem späteren Zeitpunkt mit einem eigenen Vorauszahlungsbescheid versendet (voraussichtlich Mitte/Ende März 2025).
Das bedeutet, dass auf dem Abrechnungsbescheid für das Jahr 2024 keine Abschlagssummen für das neue Jahr 2025 ausgewiesen werden. Die Fälligkeit für den ersten Abschlag wird aller Voraussicht nach Mitte/Ende April 2025 erfolgen.
Nach Auskunft des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes ist eine Satzungsänderung nicht notwendig. Es reicht aus, die einmalige Abweichung vom ursprünglichen ersten Fälligkeitstermin durch das Gremium beschließen zu lassen.
Alle übrigen Vorauszahlungstermine für das Jahr 2025 bleiben lt. den Satzungen unverändert.
Beschlussvorschlag
Der Stadtrat beschließt aufgrund des vorgetragenen Sachverhalts den ersten Fälligkeitstermin (15.03.2025) für die Wasser- und Abwassergebühren auf voraussichtlich Mitte/Ende April 2025 einmalig für das Jahr 2025 zu verschieben.
Beschluss
Der Stadtrat beschließt aufgrund des vorgetragenen Sachverhalts den ersten Fälligkeitstermin (15.03.2025) für die Wasser- und Abwassergebühren auf voraussichtlich Mitte/Ende April 2025 einmalig für das Jahr 2025 zu verschieben.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 20, Dagegen: 0
zum Seitenanfang
11. Erwachsenenbildungszuschuss (Pflichtaufgabe) 2025/2026; Volkshochschule Füssen e.V. (Erneute Behandlung)
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
25.06.2024
|
ö
|
beschliessend
|
7 |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
28.01.2025
|
ö
|
beschliessend
|
11 |
Sachverhalt
Sachverhalt:
Mit Beschluss des Zweckverbandes vom 04. Juni 2024 wurde eine Erhöhung der Pro-Kopf-Förderung für die Volkshochschule (VHS) auf 1,50 Euro im Jahr 2025 und 2,00 Euro im Jahr 2026 empfohlen.
Der Stadtrat hat am 25.06.2024 die Erhöhung mit Auflagen beschlossen.
Verweis auf Sitzungsvorlage vom 25.06.2024:
Dieser Beschluss war an sieben Auflagen geknüpft, unter anderem die Fusion zur VHS Ostallgäu. Die VHS Ostallgäu Mitte hat jedoch mitgeteilt, dass eine Fusion frühestens 2027 möglich ist. Zudem wurde die Einstellung einer 20-Stunden-Stelle durch den Stadtrat abgelehnt.
Beschlossen wurde zudem die Auflage, nur auf 2,00 Euro pro Einwohner, wenn Fokusthema Fusion „Volkshochschule Ostallgäu“ ist. Ist es nun nicht, daher müssen die 2,00 Euro nochmals beschlossen/debattiert werden. Im Jahr 2026 soll der Fusionswille erneut geprüft werden.
Zudem beantragt die VHS Füssen die Genehmigung einer Minijob-Stelle zur Unterstützung der Organisation der Außenstellen in Pfronten und Nesselwang. Die Kosten betragen 556 Euro pro Monat (zzgl. Nebenkosten) und können durch die erhöhte Pro-Kopf-Förderung finanziert werden. Die Stelle soll Aufgaben in der Akquise von Räumen, Dozenten und Teilnehmenden übernehmen sowie den Kontakt zu den Bürgermeistern pflegen. Zusätzlich soll die Person über Kenntnisse im Bereich Social Media verfügen, um die VHS in der Region stärker bei der jüngeren Generation zu positionieren.
Vorteile der Minijob-Stelle:
Höhere Verbindlichkeit: Fest angestellte Person mit klar definierten Aufgaben und Verantwortlichkeiten.
Höhere Zuverlässigkeit: Stetige Betreuung der Außenstellen.
Nachhaltigkeit: Möglichkeit zur Einarbeitung in Verwaltungsprogramme und perspektivische Übernahme der VHS-Leitung.
Beschlussvorschlag:
Beschlussvorschlag
- Der Stadtrat hält am Beschluss fest, für 2025 den Erwachsenenbildungszuschuss (Pflichtaufgabe) zur VHS Füssen e.V. auf 1,50 Euro pro Einwohner zu erhöhen.
- Der Stadtrat stellt fest, dass eine Fusion in 2025 und 2026 nicht kommen wird und nimmt zur Kenntnis, dass erneute Verhandlungen in 2027 stattfinden wird, was Grundlage zur Erhöhung auf 2,00 Euro pro Einwohner war.
Unabhängig davon muss die VHS mit soliden Finanzmitteln (Pflichtaufgabe) ausgestattet sein, um handlungsfähig zu sein, daher bleibt der Stadtrat dabei, den Erwachsenenbildungszuschuss (Pflichtaufgabe) zur VHS Füssen e.V. auf 2,00 Euro pro Einwohner im Jahr 2026 zu erhöhen.
Optional/Alternativ: Somit beschließt der Stadtrat für das Jahr 2026 den Erwachsenenbildungszuschuss (Pflichtaufgabe) zur VHS Füssen e.V. auf 1,50 Euro pro Einwohner zu belassen. Die Erhöhung auf 2,00 Euro pro Einwohner wird im Jahr 2026 geprüft, ob neue Fusionsverhandlungen geführt wurden.
- Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt für die angemieteten Räume der VHS in 2025 keine Mieterhöhung umzusetzen und erst für 2026 zu prüfen.
- Die VHS Füssen erhält die Genehmigung zur Einrichtung einer Minijob-Stelle zur Unterstützung der Außenstellen Pfronten und Nesselwang, sofern die Stelle im Haushalt der VHS berücksichtigt ist, die Finanzierung gesichert ist und keine Haushaltschieflage entsteht.
- Die VHS Füssen wird beauftragt, im Stadtrat über die Entwicklung am Jahresende 2025 zu berichten.
Beschluss
- Der Stadtrat hält am Beschluss fest, für 2025 den Erwachsenenbildungszuschuss (Pflichtaufgabe) zur VHS Füssen e.V. auf 1,50 Euro pro Einwohner zu erhöhen.
- Der Stadtrat stellt fest, dass eine Fusion in 2025 und 2026 nicht kommen wird und nimmt zur Kenntnis, dass erneute Verhandlungen in 2027 stattfinden wird, was Grundlage zur Erhöhung auf 2,00 Euro pro Einwohner war.
Unabhängig davon muss die VHS mit soliden Finanzmitteln (Pflichtaufgabe) ausgestattet sein, um handlungsfähig zu sein, daher bleibt der Stadtrat dabei, den Erwachsenenbildungszuschuss (Pflichtaufgabe) zur VHS Füssen e.V. auf 2,00 Euro pro Einwohner im Jahr 2026 zu erhöhen.
Optional/Alternativ: Somit beschließt der Stadtrat für das Jahr 2026 den Erwachsenenbildungszuschuss (Pflichtaufgabe) zur VHS Füssen e.V. auf 1,50 Euro pro Einwohner zu belassen. Die Erhöhung auf 2,00 Euro pro Einwohner wird im Jahr 2026 geprüft, ob neue Fusionsverhandlungen geführt wurden.
- Der Stadtrat der Stadt Füssen beschließt für die angemieteten Räume der VHS in 2025 keine Mieterhöhung umzusetzen und erst für 2026 zu prüfen.
- Die VHS Füssen erhält die Genehmigung zur Einrichtung einer Minijob-Stelle zur Unterstützung der Außenstellen Pfronten und Nesselwang, sofern die Stelle im Haushalt der VHS berücksichtigt ist, die Finanzierung gesichert ist und keine Haushaltschieflage entsteht.
- Die VHS Füssen wird beauftragt, im Stadtrat über die Entwicklung am Jahresende 2025 zu berichten.
Abstimmungsergebnis
Dafür: 20, Dagegen: 0
zum Seitenanfang
12. Vollzug der Geschäftsordnung - Genehmigung der Niederschrift vom 17.12.2024
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
28.01.2025
|
ö
|
beschliessend
|
12 |
Beschluss
Abstimmungsergebnis
Dafür: 20, Dagegen: 0
zum Seitenanfang
13. Anträge, Anfragen
|
Gremium
|
Sitzung
|
Sitzungsdatum
|
ö / nö
|
Beratungstyp
|
TOP-Nr. |
|
Stadtrat
|
Sitzung des Stadtrates
|
28.01.2025
|
ö
|
beschliessend
|
13 |
Diskussionsverlauf
Zwecks der doch sehr geringen Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren bittet Stadtrat Dopfer um eine Vergleichsberechnung alt/neu, die in einer kurzen Pressemitteilung veröffentlicht werden kann.
Datenstand vom 25.03.2025 16:44 Uhr